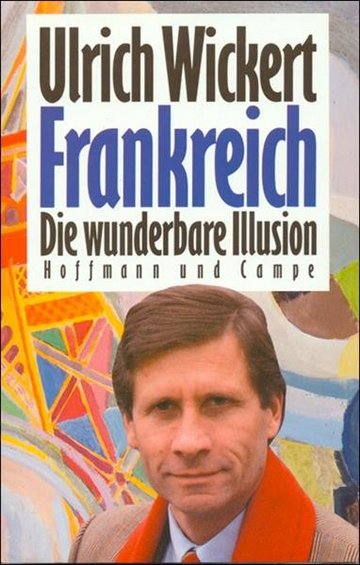›X‹
In Kalifornien oder Florida schirmen die Superreichen ihre prächtigen Villenanlagen von ungebetenem Volk ab. Wer sie besuchen will, hat sich beim Sicherheitsposten anzumelden. Aber was ich jetzt erlebe, findet in Paris statt. Als führe ich auf solch ein Millionärsgelände in der Nähe von Santa Barbara oder Palm Beach, hat der Uniformierte an der Pforte kontrolliert, ob ich angemeldet sei, mir einen Besucherausweis an die Brusttasche der Jacke gehängt und den Weg beschrieben. Wie bei einem großen Pferdegestüt grenzt ein Zaun aus weißen Balken die Wiesen ein. Nachdem ich einige hundert Meter an einem hellgrünen Birkenhain vorbeigefahren bin, öffnet sich dem Blick ein kleiner, langgestreckter See, auf dem drei oder vier Surfsegel in der Sonne geräuschlos dahinziehen. Aus der Vogelperspektive würde man erkennen, daß der Gartenarchitekt die Ufer nach der Form einer Bicorne gegraben hat, eines Zweispitzes, wie ihn die Schüler der Ecole Polytechnique zur Gala-Uniform tragen, wenn sie am 14. Juli die Parade auf den Champs-Elysées eröffnen oder im Winter in die Pariser Oper zu ihrem Jahresball einladen. Am anderen Ufer weht die blau-weiß-rote Flagge vor einem marmornen Gebäudekomplex, der wie der Regierungsbezirk eines jungen afrikanischen Landes wirkt. Es sind die Hauptgebäude der ›X‹.
Der Weg führt mich an Tennisplätzen und Pferdeställen vorbei. In einer großen Halle sind zwei Schwimmbäder und ein Gymnastiksaal untergebracht. Der zukünftigen Elite darf man offensichtlich nichts ersparen. Ein wenig abseits, versteckt hinter einem künstlich aufgeworfenen Hügel, liegen einige Villen – für das bessere Personal. Die Schüler bewohnen Einzelzimmer in vierstöckigen, halbrunden Gebäuden, doch viele von ihnen halten sich ein kleines Appartement in der Stadt. Denn hier auf dem Hügel von Palaiseau, wohin die Schule 1974 aus der engen Innenstadt, gleich neben dem Lycée Louis-le-Grand, zog, eine halbe Autostunde von Paris entfernt, ist nichts los. An Geld fehlt es ihnen nicht, denn den Schülern der ›X‹ wird ein Monatsgehalt von zwei- bis dreitausend Mark ausgezahlt, weil sie mit der Aufnahme in die Schule den Rang eines Leutnants erhalten.
Die Schule untersteht dem Verteidigungs- und nicht dem Erziehungsminister, der übrigens über keine der grandes écoles befiehlt. Außerdem verfügt das Militär über einen vielfach größeren Haushalt als das Bildungsministerium – auch das kann für eine Schule nützlich sein, war jedoch nicht Grund für diese Zuordnung. Gegründet wurde die ›X‹ zu Zeiten der Französischen Revolution, um für den Staat alle Arten von Ingenieuren auszubilden, besonders solche, die bessere Kanonen bauten. Nur die dreihundert Besten von jährlich sechstausend Bewerbern werden aufgenommen.
Manch einer kommt eher wegen des großen Rufes der Schule denn wegen eines genauen Berufsziels, wie mir der Leiter der Schule, General Dominique Chavanat, auseinandersetzte: »Wenn die jungen Leute in die Schule eintreten, wissen sie meist nicht, was sie wollen. Sie kommen selten mit genauen Vorstellungen, sondern einfach, weil sie gut in der Schule waren. Und weil sie als Beste in den Vorbereitungsklassen abschlossen, siegten sie im Wettbewerb um einen der dreihundert Plätze. Es ist dann unsere Aufgabe innerhalb der Schule, sie in eine bestimmte Richtung zu lenken, in der sie sich entfalten und ihr Maximum geben können, nachdem sie hohes Wissen angesammelt haben.«
»Pour la patrie, les sciences et la gloire« – für Vaterland, Wissenschaft und Ruhm – lautet das Motto der Schule. Es steht auf dem Fuß einer kleinen Bronzefigur, die einen den Säbel zum Angriff reckenden Offizier der Grande Armée darstellt. Diese alte Statue vor dem marmornen Protzbau der Schulverwaltung ehrt jene Schüler, die als Offiziere im letzten Jahrhundert gefallen sind. Zahlreiche Forscher wie Ampère, Marschälle wie Joffre und Foch sind aus der Polytechnique hervorgegangen, die Napoleon sein Huhn nannte, das goldene Eier legt. Die Polytechnique ist eine Ingenieursschule besonderer, ja einmaliger Art. Hier werden keine Spezialisten, sondern Generalisten herangezogen, Leute, die von möglichst viel möglichst viel wissen, aber nicht alles wissen können, was ein Spezialist von dem jeweiligen Fach im Detail weiß.
Die Wohngebäude der Schüler liegen neben den Unterrichtsräumen und Forschungslabors. Die Polytechnique verfügt, um die besten Professoren Frankreichs an sich zu ziehen, über eines der wichtigsten Forschungsinstitute des Landes. Wie gesagt, an Geld fehlt es nicht, denn man profitiert vom Militärhaushalt. Aber die militärische Zuordnung ist selbst unter den Offizieren nicht mehr unumstritten.
General Waymel, selbst Absolvent der ›X‹, sollte mit der Leitung dieser Schule beauftragt werden, lehnte das Angebot jedoch ab, weil er diese Institution für veraltet hält. Zu Zeiten Napoleons sei es vielleicht richtig gewesen, die Schüler der Armee unterzuordnen, doch heute richte dies eher Schaden an. »Die Erziehung in der ›X‹ ist eine Erziehung für den Staat«, erklärte er mir. »Die Schüler, die im Alter von neunzehn, zwanzig einrücken, haben sich selbst noch kaum eine Meinung vom Leben, von der Politik, von der Gesellschaft bilden können und lernen nun nicht, nach ihrem eigenen Urteil zu entscheiden, sondern richten sich stets nach der Staatsräson.«
Die Schüler kommen für drei Jahre. Im ersten werden sie zum Reserveoffizier ausgebildet. Den Grad eines Leutnants behalten die Schüler bis zum Ende der Ausbildung und damit auch das Gehalt. So haben sie schon einen schönen Vorgeschmack auf das, was es heißt, zur Elite zu gehören.
Der Student Georges Perrot, den ich an der ›X‹ traf, stammt aus Marseille. Als einer der Schulbesten dort wurde er in Paris im Lycée Louis-le-Grand aufgenommen. Die zwei Jahre lange Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung der Ecole Polytechnique empfand er als ausgesprochen hart. Tag und Nacht habe er nur gelernt. Freizeit, Feste, Familie habe es nicht gegeben – und das nach dem Abitur im Alter von siebzehn. Diesen Leistungsdruck ertragen in manchen Ländern nicht einmal Erwachsene. Offensichtlich brauchte Georges Perrot nach dieser Strapaze ein Ventil. Nach der Aufnahme in die ›X‹ schwänzte er dort so viel, daß er zu 45 Tagen Stubenarrest verurteilt wurde, was bei Schülern der Ecole Polytechnique nicht ungewöhnlich ist. Eigensinn und Disziplinlosigkeit des ansonsten brillanten Nachwuchses waren es, die Napoleon veranlaßten, die Schüler durch den Militärstatus zu reglementieren. Georges Perrot möchte als Ingenieur in die Luftfahrt. Weil er nicht in den Staatsdienst strebt, gibt er sich gelassener als manche Kameraden, die darum ringen, Jahrgangsbeste zu sein.
Je besser man abschneidet, desto besser das Fortkommen im Staat. Am Ende jedes Jahrgangs zählt eben die Rangliste. Die ersten zehn werden nach zwei weiteren Jahren an einer Technischen Hochschule ins Ingenieur-Corps des Staates aufgenommen, womit die Karriere garantiert ist.
Die Schüler werden mit dem besten Lehrmaterial versehen. Auf drei Studenten kommt ein Computer, und die Arbeit mit modernster Elektronik gehört zum Alltag. Die Ecole Polytechnique verfügt über den größten Computer Frankreichs, einen Cray. Einen ähnlichen gibt es in ganz Europa nur noch in Stuttgart. Solche Möglichkeiten helfen bei einer Karriere, die sich die Ersten jedes Jahrgangs aussuchen können.
»Aus Tradition gehen die Besten in das staatliche Ingenieur-Corps«, meint Georges Perrot. »Aber der wirkliche Hintergrund ist, daß die Leute, die aus dem Ingenieur-Corps kommen, einen großen Teil des Industrieministeriums und auch der französischen Industrie beherrschen. Der Corps-Geist unter ihnen ist sehr ausgeprägt. Es ist der Drang nach öffentlicher Macht. Die meisten, die in die Politik gegangen sind, haben erst einmal etwas anderes nach der Ecole Polytechnique gemacht. Einige haben wie Giscard die Verwaltungshochschule ENA besucht, andere haben sich eine Zeitlang in der Staatsverwaltung umgetan; denn, wissen Sie, die französische Staatsverwaltung muß man sehr gut kennen, wenn man sich in der Politik, aber auch in der Wirtschaft zurechtfinden will.«
War beim Lycée Louis-le-Grand das Motto ›Arbeit vor Muße‹, so könnte es bei der Polytechnique ›Mens sana in corpore sano‹ heißen – ein gesunder Geist in gesundem Körper. Weil man sich nicht zu Unrecht für die Kopfelite hält, möchte man auch zeigen, daß man als Offizier den Körper wagemutig einzusetzen vermag. Einen echten Polytechnicien erkennt man daran, daß sein Hobby Bergsteigen ist.
Die ›X‹ bietet viel, doch der Staat verlangt anschließend von den Absolventen, daß sie zehn Jahre im Staatsdienst bleiben; die Schulzeit wird angerechnet. Wer nach dem Abschluß in die Privatwirtschaft geht, muß 60000 Mark Schulgebühren zurückzahlen. Doch da gibt es – wie überall in Frankreich – Auswege. Wer glaubt, in einem Amtsbüro zu verschimmeln, der kann in einem staatlichen Wirtschaftsunternehmen anheuern. Doch die Besten jedes Jahrgangs streben stets in die Verwaltung. Das schafft Probleme. Zwar verfügt die Ecole Polytechnique über wissenschaftliche Forschungsinstitute von internationalem Rang, doch nur selten interessieren sich diejenigen, die hier zur Elite herangezüchtet werden, für Forschung oder Wissenschaft. Um Wissenschaftler zu werden, muß man von einem anderen Drang beseelt sein als dem, an der Staatsmacht teilzuhaben. Nicht der Wissenschaftler hat in Frankreich Sozialprestige, sondern der hohe Staatsbeamte.
»Bei dieser Versammlung werde ich Ihnen ein wenig moralisch kommen.« Mit diesen Worten verabschiedet...