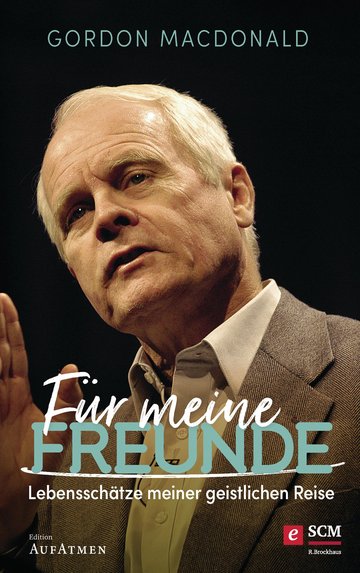[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
1 Europa in meinem Herzen. Über meine Wurzeln
1940
Hintere Reihe von links: Ruth Alger (meine Tante), Esther MacDonald (meine Mutter), Adina MacDonald (meine Großmutter), Thomas MacDonald (mein Großvater), ich Vordere Reihe von links: Fred Davis (mein Urgroßvater), Bessie Davis (meine Urgroßmutter), Crissy MacDonald (meine Stief-Urgroßmutter), William MacDonald (mein Urgroßvater)
Kriegsjahre
Ich erblickte das Licht der Welt in dem Jahr, in dem in Europa der Zweite Weltkrieg ausbrach: 1939. Meine frühe Kindheit war also geprägt von Bildern und Geräuschen, die typisch sind, wenn Nationen miteinander in Konflikt geraten: Soldaten in Uniform an beinahe jeder Straßenecke, Treibstoff- und Lebensmittelrationierung für die gesamte Zivilbevölkerung, nächtliche Luftschutzübungen in allen Groß- und Kleinstädten und stündliche Nachrichten über den Fortgang der Kämpfe.
Hasserfüllt war der Ton, wenn die Menschen der Krieg führenden Länder über ihre Widersacher sprachen. Sie jubelten, wenn sie hörten, dass bei gegnerischen Nationen Städte in Flammen standen. Und sie gingen – ohne groß nachzudenken – davon aus, dass Gott auf ihrer Seite stand, wenn die Armeen gegeneinander kämpften.
Selbst als kleiner Junge stutzte ich, wenn ich ältere Menschen – Christen wohlgemerkt – sagen hörte, dass Gott die Sache unseres Landes unterstütze und unsere Feinde richten werde. Meine Verwirrung wurde auch nicht gerade kleiner, als wir in der Kirche ein einfaches kleines Lied mit etwa diesen Worten sangen:
Jesus liebt die kleinen Kinder,
alle Kinder auf der Welt.
Alle Farben hat er gern,
sie sind wertvoll für den Herrn.
Jesus liebt die kleinen Kinder auf der Welt.
Wenn Jesus alle Kinder auf der Welt liebt, so fragte ich meine Lehrer, warum sollte er dann manche beschützen und andere vernachlässigen? Warum gab es so viel Leid? Warum mussten so viele ihr Leben lassen? Warum diese Zerstörung? Ich merkte jedoch schon sehr früh, dass die Erwachsenen für meine Fragen kein offenes Ohr hatten.
Aus diesen Kriegsjahren sind mir die Sonntagabende noch besonders stark in Erinnerung. Unser Pastor verlas da vor der Gemeinde immer die Liste der letzten Opfer. Ich hörte die Namen von Vätern, Söhnen, Brüdern und Freunden aus unserer Kirche und der Nachbarschaft. Manche auf der Liste waren Kriegsgefangene, manche waren vermisst – vermutlich für immer. Andere waren schwer verwundet und wurden in Militärkrankenhäusern behandelt. Und schließlich standen auf der Liste des Pastors die Namen der Gefallenen. Sie würden nie mehr heimkehren.
Bei jedem Namen rang die ganze Gemeinde nach Atem. Dann folgten Tränen, Zornesrufe und lautes, manchmal gar hysterisches Wehklagen.
Selbst als kleiner Junge im Alter von vier oder fünf erkannte ich, dass in solchen Momenten etwas nicht stimmte. Warum dieser große Schmerz? Warum diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit? Wie kam es, dass gute Menschen – Freunde wie Feinde – überhaupt solche Momente erleben mussten?
Wenn die Gemeinde sich wieder etwas gefasst hatte, betete der Pastor für jede der betroffenen Familien. Und am Schluss dieses traurigen Teils des Abendgottesdienstes sangen wir immer ein Lied, das so begann:
Ob an Land, ob auf dem Meer oder in der Luft …
mein Vater gibt auf mich acht.
Auch dieses Lied warf bei mir Fragen auf. Wenn ich mich im Gottesdienstsaal umsah, wo die Leute mit dem Verlust von geliebten Angehörigen kämpften, fragte ich mich: Ob die Deutschen, die Italiener und die Japaner wohl den gleichen Schmerz empfinden wie wir? Lieben sie ihre Soldaten genauso wie wir unsere? Singen sie auch »mein Vater gibt auf mich acht«?
Eines Sonntagabends erzählte jemand im Gottesdienst eine unvergessliche Geschichte über Soldaten im Ersten Weltkrieg: Am Weihnachtsabend vereinbarten die Streitkräfte auf beiden Seiten der Front einen mehrstündigen Waffenstillstand. In der Stille des Augenblicks, als Gewehre, Panzer und Kanonen schwiegen, stimmte eine Gruppe von deutschen Soldaten »Stille Nacht« an. Als die Soldaten auf der englischen Seite das altvertraute Weihnachtslied hörten, antworteten sie mit der englischen Version »Silent Night«. Bald war die Luft erfüllt mit weiteren Weihnachtsweisen.
Als dann nach ein paar Stunden die Waffenruhe endete, nahmen beide Seiten ihre tödliche Mission wieder auf: schossen aufeinander und bombardierten sich gegenseitig.
Ob es wirklich so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber eines war mir als kleines Kind schon klar: Krieg ist etwas Abscheuliches, etwas abgrundtief Böses.
In meiner begrenzten Welt, die ich als kleiner Junge erlebte, gab es für mich einen sicheren Ort fernab von der Gewalt des Krieges. Es war das Haus meiner Großeltern väterlicherseits: Adina und Thomas MacDonald lebten ganz in unserer Nähe, in Brooklyn, New York. Bei meinen zahlreichen Besuchen empfingen sie mich immer mit offenen Armen und schenkten mir ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
Die Ausbreitung des Krieges war meinen Großeltern verhasst und die harte Wirklichkeit menschlichen Leidens beschäftigte sie sehr. Sie wollten wissen, ob die Leute in den Kriegsgebieten sich satt essen konnten, ob sie ein Dach über dem Kopf hatten und medizinisch versorgt wurden. Ob ihnen die Liebe Christi und die Nächstenliebe, die überall dort praktiziert wird, wo Christen miteinander verbunden sind, wohl in irgendeiner Weise begegnete? Dies waren die Fragen, die meinen Großeltern auf der Seele brannten.
Vor meiner Geburt war mein Großvater zwanzig Jahre lang stellvertretender Direktor eines kleinen Missionswerks gewesen, das Gemeindegründer anwarb, ausbildete und an verschiedene Orte in ganz Europa sandte. Meine Großmutter arbeitete in der Verwaltung mit. Wenn sie nicht gerade »geschäftlich« gefordert war, zog sie sich an einen stillen Ort zurück, las die Bibel und betete für Hunderte europäischer Missionare, die das Werk unterstützte. Darüber hinaus wurde sie nie müde, für die Millionen Europäer zu beten, die unschuldig zu Kriegsopfern geworden waren.
Die Gebete meiner Großmutter waren weder still noch kurz noch kleinmütig. Bei ihrer Fürbitte für Europa holte sie erst tief und laut hörbar Luft, stöhnte verzweifelt (»O Gott! O Gott! O Gott!«) und gestikulierte dann mit den Armen, als wolle sie Gottes Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Für Adina war das Gebet eine geistliche und zugleich körperliche Angelegenheit. Sie meinte es ernst und Gott sollte ihr zuhören.
Wann immer ich meine Großeltern besuchte, ergriff meine Großmutter jede Gelegenheit, ihre Liebe für die vielen Millionen Europäer in mein kleines Herz zu pflanzen. Sie las mir Briefe von Missionaren vor, die sich während des Krieges verstecken mussten. Sie erzählte mir aufregende Geschichten darüber, wie diese in schwierigen Situationen bewahrt worden waren oder der Gefahr entrinnen hatten können, wie sie (auf scheinbar wundersame Weise) Nahrung und Zufluchtsorte gefunden und wie sie unermüdlich und selbst unter lebensbedrohlichen Umständen die Botschaft von Jesus weitergegeben hatten.
Keiner meiner Freunde aus der Kinderzeit hörte jemals solche abenteuerlichen Berichte über Gottes Treue wie ich, wenn Großmutter mir von den Missionaren in Ländern wie Russland, Polen, Deutschland, Frankreich und Italien erzählte. Und oft nahm ich diese erstaunlichen Geschichten mit nach Hause zu meinen Freunden in unserem Viertel. Wenn sie mitbekamen, dass ich bei meinen Großeltern zu Besuch war, warteten sie immer ganz gespannt auf meine Rückkehr. Sie wussten, dass ich ihnen sicherlich wieder etwas Ungewöhnliches zu erzählen hatte.
Als ich fünf Jahre alt wurde – ein Jahr bevor die meisten Kinder in Amerika eingeschult werden –, beschloss meine Großmutter, dass ich nun alt genug sei, um Lesen zu lernen. Und es ist keine Überraschung, welche Lektüre sie vor allem für mich auswählte: die Bibel.
Sie las mir zwar oft Geschichten aus dem Alten Testament vor, von den Propheten und Königen (und brachte mir damit das Lesen bei), es ging ihr aber vielmehr darum, dass ich das Neue Testament kennenlernte, ganz besonders das Leben und das missionarische Werk von Paulus. Großmutter verehrte den Apostel richtiggehend: seine Mission, seinen evangelistischen Eifer und seine tiefen Einsichten in das Evangelium von Jesus Christus. In ihren Augen war Paulus ohne Fehl und Tadel und sie war entschlossen, diese Ansicht auch mir zu vermitteln.
Seit vielen Jahren ist meine Großmutter nun schon in der Ewigkeit und manchmal stelle ich mir vor, wie sie den alten Apostel verfolgt und ihn mit Fragen über seine komplizierten Briefe an die neutestamentlichen Gemeinden löchert. Wie war das gemeint?, kann ich sie fragen hören, und sehe sie vor mir, wie sie ihre Bibel an einer rätselhaften Stelle aufschlägt. Warum hat er ausgerechnet dieses Wort gewählt? Warum beschloss er, dies oder das zu tun? Angesichts Großmutters unbeirrter, ja schon beinahe penetranter Verehrung für Paulus frage ich mich (natürlich im Scherz), ob er nicht manchmal versucht, sich davonzustehlen, wenn er sie mit ihrer Bibel in der Hand und ihren Fragen auf dem Herzen schon von Weitem auf sich zusteuern sieht. Ich liebte meine Großmutter innig, aber es gab Momente, da wünschte ich, sie wäre nicht ganz so überschwänglich gewesen.
Als ich noch ein Kind war, dachte Großmutter gern über die Zeit in Paulus’ Leben als Missionar nach, als er glaubte, er sei dazu berufen,...