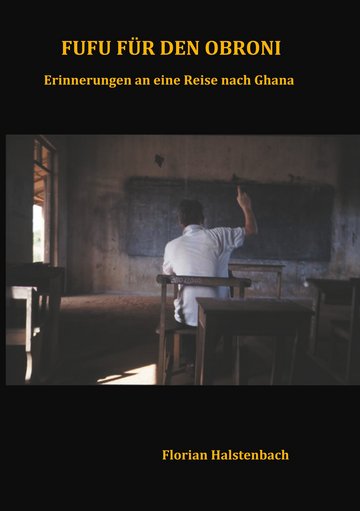Accra
So wie vielleicht das Ankommen in Ghana subjektiv der absolute Höhepunkt dieser ganzen Reise war, so folgte der psychologische Tiefpunkt unmittelbar auf dem Fuße. Natürlich wurden wir aufs freundlichste begrüßt, ich sah mich etwas in der Gegend um, abends saßen wir zusammen mit Atos Mutter, einer etwas verhärmten aber ausgesprochen drahtigen und energiegeladenen Frau, die täglich auf dem Großmarkt von Accra Schuhe, beziehungsweise die bei den einfachen Ghanaern im Alltag beinahe ausschließlich verwendeten, Flip Flops genannten Plastiklatschen chinesischer Herkunft verkaufte. Deswegen, aber sicher auch aufgrund der Zuwendungen ihres Sohnes, lebte sie in einem den Umständen nach entsprechend soliden, aber aus unserer europäischen Sicht extrem einfachen Häuschen. Das Viertel Dansoman besteht wie die meisten Viertel Accras überwiegend aus solchen einstöckigen, aus großen Leichtbetonsteinen schnell hochgezogenen, unverputzten Baracken mit Wellblechdach, meist stehen mehrere solche Häuser auf einem „Compound“, dem Grundstück, das meist mit einer kleinen Mauer umgeben ist. Im Hof treffen sich die Nachbarn und es wird auf offenem Feuer gekocht, Wäsche gewaschen und wenn man sich versteht, getratscht und gelacht. Kinder gehören überall dazu, vielleicht laufen ein paar Hühner umher, eine Ziege steht angepflockt herum, und die Alten dösen im Schatten. Nur die Hauptstraßen, zwar meist in schlechtem Zustand, sind geteert, alle Sträßchen und Gassen unversiegelt und verwandeln sich während der Regenzeit in einen schwer passierbaren Schlammparcours. In der Regel sind die Häuser elektrifiziert, aber es gibt kein fließendes Wasser, die Toilette teilt man sich und sie befindet sich meist in einem einfachen Bretterverschlag in einer Ecke des Hofes. In einem ebensolchen Verschlag befindet sich das Bad, gewaschen wird sich mit einem Eimer und Seife, es gibt natürlich keine Fliesen, aber einige größere Steinbrocken sind so aneinander gelegt, dass man nicht im Schlamm stehen oder hocken muss. Die Einrichtung der Wohnungen ist an Einfachheit nicht zu überbieten, Fensterscheiben gibt es nirgends, sie werden durch Fliegengitter beziehungsweise Moskitonetze ersetzt. Der meist einzige Luxus ist ein Ventilator, der die auch nachts drückende Hitze einigermaßen erträglich gestaltet. Zum Abend essen wir Reis mit etwas Seetang, dazu gibt es Wasser.
Ich kann mich nicht erinnern, ob es gleich die erste Nacht oder dann die zweite war, in der mir das ganze riesige Ausmaß und die Brutalität der alles beherrschenden Armut in dieser Stadt und in diesem Land aufs deutlichste bewusst wurde. Die ersten Berechnungen die ich anstellte, um Kosten wie Taxi, Essen, Getränke, Mieten und dergleichen in ein Verhältnis mit den Umständen in Deutschland zu setzen, machten mir unmissverständlich klar, dass ich mit meinen 1000 DM als Reisekasse für hiesige Verhältnisse ein überaus reicher und wohlhabender Mann war, der noch dazu in seiner Heimat ein außerordentlich bequemes Leben in einer wohl organisierten und berechenbaren Umwelt führte. Man kann nicht umhin, dieses Viertel und darüber hinaus die ganze Stadt nach hiesigem Verständnis als riesigen Slum zu bezeichnen. Ich fühlte mich für den Moment wie ausgesetzt in einem Meer der Armut und der Not, und zudem dem Goodwill meiner Gastgeber und Mitmenschen, angesichts einer für mich in keiner Weise identifizierbaren staatlichen oder gar touristischen Infrastruktur, völlig ausgeliefert. Verstärkend kam hinzu, dass sich das Reisen in den neunziger Jahren, das heißt vor der Erfindung beziehungsweise der allgemeinen Verbreitung des Mobiltelefons, der Kreditkarten, des Internets, von sozialen Netzwerken wie Facebook und dergleichen ganz zu schweigen, auch dadurch von den heutigen Bedingungen unterschied, dass man wirklich weg war, keinen ständigen Kontakt mit der Heimat unterhalten konnte, vielleicht mal eine Postkarte schrieb und sich ansonsten in doch ganz anderer Weise auf die Gegebenheiten vor Ort einzustellen hatte, als dies heutzutage der Fall wäre. Hier in Ghana hatte ich mich deswegen mehr noch als anderswo auf mich selbst und vor allem auf mein unmittelbares Umfeld zu verlassen.
Natürlich hatte ich, was die äußeren Umstände anging, sicher ähnliches erwartet, hatte ja schon in Zentral-Anatolien in etwa vergleichbare Bedingungen vorgefunden und bin ohnehin nicht sonderlich zart besaitet. Aber gerade die Selbstverständlichkeit und Zivilisiertheit, mit der ich willkommen geheißen und mit der ich als Gast in den täglichen Ablauf integriert wurde, die überraschende Normalität und Vertrautheit des Umgangs mit den Bewohnern dieser Welt, die Wahrnehmung, dass unter anderem dieses Haus in Accra - Dansoman zu Teilen in den nächsten Monaten mein Zuhause, meine Basisstation sein würde, all dies hat mir angesichts der harten Lebensumstände, des Mangels an praktisch allem, auch der einfachsten materiellen Gegenstände, die schreiende Unausgewogenheit, wenn nicht Ungerechtigkeit meiner Situation hier als erlebnishungriger Tourist, in besonders krasser Weise vor Augen geführt. So pittoresk, so vielfarbig die ersten Eindrücke der Tropen, die Schönheit und Eleganz der afrikanischen Menschen auf mich wirkten, so massiv überrumpelte mich jetzt der Eindruck der alltäglichen und sehr harten Lebensrealität in diesen Breiten. Und wenn ich auch klar sagen kann, dass ich während meines Aufenthaltes in diesem Lande nie die aus anderen Teilen Afrikas in unseren Medien immer wieder gezeigten Bilder des Hungerns und Sterbens vorgefunden habe und nach meinem Eindruck die meisten, die ich traf, zumindest einigermaßen über die Runden kamen, so übermannte mich jetzt doch der unmittelbare Kontrast zu unserer mit Überfluss und materiellem Reichtum gesegneten, scheinbar übersatten Welt.
Kurz gesagt: Ich verfiel ganz kurzfristig in eine tiefe Depression und stellte meine Entscheidung hierher zu kommen ganz unmittelbar in Frage. Was wollte ich eigentlich hier? Ein bisschen Katastrophentourismus? Die Augen verschließen und ein wenig Drittwelt–Exotik konsumieren? Ich schämte mich vor mir und den Leuten, deren Gast ich war. Diese Gedanken zu teilen schien mir ausgeschlossen, auch Ato konnte und wollte ich diese Wendung nicht erklären, denn er wollte mir sein Land zeigen, das sein Zuhause und seine Heimat war und auf das er zu Recht stolz war. So fühlte ich mich nicht nur erbärmlich, sondern auch allein. Mir schien, dass es das Beste wäre, so schnell als möglich zurückzufliegen und mein verbleibendes Reisekapital einfach hier zu lassen. Mir war klar, dass ich mit dem von mir mitgeführten Betrag den Leuten hier eine massive, wenn auch nur temporäre Erleichterung ihrer Sorgen und Nöte, vergleichbar einem Lottogewinn, selbst wenn ich unter vielen teilen müsste, verschaffen könnte. Ich müsste nur auf meinen kurzfristigen Lustgewinn dieser tollen Reise, auf die erwartete und im Grunde egoistische Selbsterfahrung während dieser Tour verzichten und ich hätte das für jeden klar denkenden Menschen erkennbar moralisch Richtige getan.
Ich weiß bis heute nicht, ob das nicht die richtige Entscheidung gewesen wäre, aus dieser Krise habe ich keinen eindeutigen Weg gefunden. Trotzdem versuche ich zu erklären, warum es anders gekommen ist, obwohl sich die gesamte Reise von da an vor dem Hintergrund dieser Fragestellung abgespielt hat, sich diese Grundthematik immer wieder gestellt hat und ich im Verlauf oft lavieren musste und hier und da auch zweifellos die Augen vor manchen Unausgewogenheiten und Abgründen geschlossen habe. Ganz ohne Frage jedoch bleibt, dass das Erleben der bittersten Armut, die sich im weiteren Verlauf anderswo noch himmelschreiender als in Accra präsentierte, ebenso wie der Umgang damit sicher nicht das einzige, aber doch ein ganz prägendes und vielleicht das wichtigste Erlebnis dieser Reise gewesen ist.
So war es für mich absolut notwendig, gleich zu Beginn eine Strategie und eine Einstellung zu entwickeln, um meinen doch sehr gewünschten Aufenthalt hier zu ermöglichen und darüber hinaus mir gegenüber rechtfertigen zu können. Vielleicht könnte man sagen, dass mich die Armut fast vertrieben hätte, aber die Menschen haben mich zum Bleiben bewogen.
Wie gesagt wurden meinetwegen keine besonderen Umstände gemacht. Natürlich fiel man als Weißer in diesem Stadtteil Accras sehr auf, denn es verirrte sich nach meiner Kenntnis selten oder besser gesagt nie ein Europäer, zumindest nicht als Dauergast, in dieses Viertel. Dies war aber kein Grund von Seiten der Einwohner ein besonderes Aufheben zu machen, denn es wurde zwar als erfreulich und bemerkenswert angesehen, dass mal einer kam, aber im Grunde war es doch selbstverständlich und richtig, dass die Menschen sich gegenseitig besuchen, ganz gleich welche Farbe ihre Haut hat, oder auf welchem Kontinent sie geboren sind. So nutzte man die Gelegenheit und nahm Kontakt auf, bemühte sich einen Eindruck von einem solchen Fremden zu gewinnen und freute sich darüber, dass einem mal etwas nicht Alltägliches begegnete.
Umgekehrt entstand gleich zu Beginn bei mir der Eindruck, dass mir Mentalität und Geisteshaltung der Menschen nicht nur sehr zusagten, sondern auch...