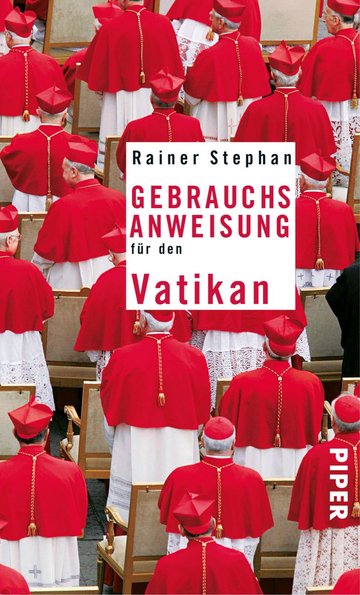Der Hügel am anderen Tiberufer
Als Touristenziel hat der Vatikan Rom den Rang abgelaufen. Die Römer selbst sehen das mit eher gemischten Gefühlen
Alle Wege führen nach Rom? Das war einmal, damals, als die Hauptstadt des römischen Imperiums nicht nur das Zentrum der Alten Welt war, sondern der Knotenpunkt all jener großen Heerstraßen, die noch die entlegensten Teile des Reichs und seiner Vasallenstaaten mit Rom verbanden. Gewiss, auch heute zählt Italiens Hauptstadt zu den beliebtesten Reisezielen, nicht zuletzt ihrer vielen antiken Baudenkmäler wegen. Und selbst wenn einige von ihnen, wie das Kolosseum oder das Pantheon, eindrucksvoll erhalten sind, bewegt man sich beim Besuch dieser Sehenswürdigkeiten doch meist über Ruinenfelder. Nicht einmal deren berühmtestes, das Forum Romanum, erzählt nur von Glanz und Größe der antiken Metropole, sondern ebenso von deren Niedergang. Die Wege nach Rom, die Wege aus Rom in die Welt, die römische Macht selbst – sie sind längst verfallen.
Nicht Rom, sondern der vom römischen Stadtgebiet umgebene Stadtstaat Vatikan gilt heute als das Zentrum der Welt, zumindest für mehr als 1,1 Milliarden Mitglieder der römisch-katholischen Kirche – und weltweit wächst deren Anzahl trotz einiger Rückgänge in Europa stetig weiter. Die Bezeichnung römisch-katholisch ist dabei durchaus Programm. Anders als die übrigen Weltreligionen ist die katholische Kirche streng zentralistisch organisiert: Nicht nur dass im Vatikan ihr geistliches Oberhaupt, der Papst, residiert, hier laufen außerdem sämtliche Verwaltungsstränge der Weltkirche zusammen.
Doch nicht nur alle katholischen Dienstwege führen deshalb »nach Rom«, genauer gesagt: in den Vatikan. Der kleine Staat des Papstes hat auch als touristisches Ziel der italienischen Hauptstadt längst den Rang abgelaufen. Deswegen ließe sich heute eher sagen: Alle Wege führen in den Vatikan.
Die Römer selbst bestreiten das natürlich vehement. Es gebe Touristen, so erzählen sie gern, die tagelang den Schönheiten Roms nachspürten, ohne dem jenseits des Tiber gelegenen Vatikan auch nur einen einzigen Besuch abzustatten. Umgekehrt lasse kein noch so katholischer Vatikanbesucher sich die Gelegenheit zum Sightseeing Roms entgehen.
Vielleicht stimmt das sogar. Aber es besagt nichts. Denn abgesehen davon, dass viele der römischen Tourismusschaustücke in Wahrheit dem Vatikan gehören (und oft sogar zu dessen exterritorialen Hoheitsgebieten zählen), lässt sich die hohe Attraktivität des Vatikans spätestens seit dem Heiligen Jahr 2000 mit einer höchst eindrucksvollen Zahl belegen: Während normalerweise um die 15 Millionen Reisende pro Jahr Rom besuchen, stieg ihre Zahl in 2000 auf fast 50 Millionen.
Wirtschaftlich sind es jedoch mehr die Fremdenverkehrsindustrie und die Finanzsäckel der italienischen Hauptstadt, die vom Ansturm der Reisenden auf den Vatikan profitieren; denn hinter dessen Mauern finden sich, jedenfalls für Touristen, weder Unterkünfte noch Verpflegungsmöglichkeiten. Dennoch sollte man sich im Gespräch vor allem mit alteingesessenen Römern davor hüten, allzu begeistert vom Vatikan zu schwärmen. Und ganz falsch wäre es, den Vatikan als einen der vielen sehenswerten Stadtteile Roms zu bezeichnen.
Tatsächlich zählt der jenseits des Tiber liegende Mons Vaticanus, der Vatikanische Hügel – hartnäckigen Reiseführerberichten zum Trotz –, keineswegs zu den berühmten sieben Hügeln Roms. Noch im Mittelalter hörte der römische Herrschaftsbereich am Tiberufer auf. Und auch wenn mittlerweile halb Rom auf der anderen Tiberseite liegt und der Kirchenstaat deshalb komplett von römischem Stadtgebiet umschlossen ist: Die meisten Römer sind weder stolz auf die Nachbarschaft zum Vatikan noch wirklich dankbar darüber. Stattdessen betrachten sie den kleinen Staat des Papstes und dessen wachsende Beliebtheit mit, gelinde gesagt, gemischten Gefühlen.
Die spinnen, die Römer? Keine Rede davon – finden jedenfalls die Römer selbst. In ihren Augen sind es schon immer die Christen, die spinnen. Dabei geht es weniger um Touristenströme und den schnöden Mammon, den sie in die Kassen spülen, als um große Prinzipien. Und das schon von alters her: Wie ihre antiken Vorfahren finden die heutigen Römer es merkwürdig, ja verdächtig, wenn jemand behauptet, er nehme seine religiöse Überzeugung ernster als die schönen (oder auch traurigen) Dinge dieser Welt.
Dass sich dem zum Trotz viele dieser schönen Dinge im Vatikan zu einem weltweit einmaligen Gesamtkunstwerk vereinen, dass ausgerechnet der Glaube an eine überirdische Macht den Kirchenstaat zu einem eindrucksvollen Ensemble irdischer Machtattribute werden ließ; dieses Paradox macht den Römern – und nicht nur ihnen – besonders schwer zu schaffen.
Dabei ist es ja nicht so, dass Italiener, und zumal die Bewohner von Italiens Hauptstadt, keinerlei Sinn fürs Übernatürliche hätten, im Gegenteil: Die römische Alltagssprache und Alltagskultur quellen geradezu über von Bannflüchen oder Segenswünschen, vom Glauben an Wunder und Vorbedeutungen, vom bösen Blick oder anderen magischen Kräften; die Zahl der allein in Rom niedergelassenen Wahrsagerinnen, Astrologen und Kartenleser geht in die Zehntausende.
Zugleich aber gibt es kaum einen Ort auf der Welt, in dem das pragmatische Denken auf eine derart gefestigte Tradition zurückblicken kann wie in Rom. Egal, ob es sich um große Verwaltungsprobleme oder um kleine Sorgen des täglichen Lebens handelt: Die Römer interessieren sich kaum je dafür, wie und warum ein Problem entstanden ist, sondern fragen vor allem, wie es sich möglichst unkompliziert abstellen lässt – oder wie man sich über die Misere hinwegmogeln könnte.
Wie das zusammengeht – nüchterner Pragmatismus hier und Geisterglauben dort? Einfache Antwort: Es geht eben nicht zusammen. Die Römer betreiben schlicht beides nebeneinander, stürzen sich mit Hingabe in die Rituale des Aberglaubens und die Lektüre ihrer Horoskope – und kümmern sich zugleich, mit einer davon völlig unberührten Nonchalance, um die Bewältigung ihres Alltags.
Das hat, wie gesagt, Tradition: Schon im alten Rom wurde beispielsweise kein Feldzug unternommen und kein wichtiges Gesetz erlassen, ohne dass die Auguren, die staatlichen Wahrsager, vorher unter großem zeremoniellen Aufwand die Erfolgschancen des Unternehmens aus den Formationen fliegender Vögel oder aus den Eingeweiden von Opfertieren herausgelesen hätten. Nur, sobald es dann zur Sache ging, dachte kein Feldherr und kein Politiker auch nur im Traum daran, sich an die mit Hilfe solch magischer Praktiken gewonnenen Erkenntnisse zu halten.
Und überhaupt, werfen wir nicht alle, selbst wenn wir uns für nüchterne Verstandesmenschen halten, ab und an einen Blick in unser Horoskop, notieren wir nicht wenigstens im Unterbewusstsein, dass uns gerade eine schwarze Katze von links über den Weg lief oder der Freitag auf einen 13. fällt? Die Römer jedenfalls halten das für ganz normal. Als wirklich beunruhigend empfinden sie erst das Gegenteil: dass es Leute wie die Christen (cristiani bedeutet in Rom vor allem Katholiken) gibt, die ihr irdisches Leben allen Ernstes an einem überirdischen Prinzip auszurichten versuchen.
Ja aber – die allermeisten Römer sind doch selbst katholisch? Sind sie; doch ihr Katholizismus manifestiert sich, wenn überhaupt, in ihrem Aberglauben, vor allem in der oft inbrünstigen Verehrung von mysteriösen Reliquien, Heiligenbildern oder frommen Wunderheilern wie Padre Pio, der es in Rom wie in ganz Italien an Popularität locker mit dem Papst aufnehmen kann.
Mit anderen Worten: Römer, die etwas auf sich halten, sind im Grunde ihres Herzens bis heute Heiden geblieben. Und merkwürdigerweise war genau dieses römische Heidentum der Grund dafür, dass die ersten Päpste hier ihre Residenz errichteten.
Was uns mittlerweile als selbstverständlich erscheint, ist ja eigentlich sehr sonderbar. Kann man sich Berlin als Zentrum des Buddhismus vorstellen oder Buenos Aires als Zentrum des Islam? In aller Regel haben Religionen, auch Weltreligionen, ihren geistlichen und irdischen Mittelpunkt doch dort, wo sie entstanden sind und wo ihr Gründer gewirkt hat.
So ähnlich hatte kurz nach dem Tod des Jesus von Nazareth ausgerechnet der später als erster römischer Papst verehrte Apostel Petrus argumentiert. Damals war noch Jerusalem das Zentrum der gerade entstehenden neuen Religion. Und nicht nur Außenstehende, sondern auch die meisten ihrer Anhänger betrachteten die kleine christliche Glaubensgemeinschaft lediglich als Variante des Judentums, als jüdische Sekte. Nach Ansicht der Jerusalemer Urgemeinde und ihres Vorstehers Petrus konnten daher nur Juden Christen werden; die Voraussetzung der christlichen Taufe war die jüdische Beschneidung.
Gegen diese Sichtweise argumentierte am vehementesten der erst nach Jesus’ Tod zum Christentum bekehrte Paulus von Tarsus. Auch Paulus war Jude, zugleich aber als Einwohner der (in der heutigen Südtürkei gelegenen) römischen Provinz Kilikien römischer Staatsbürger. Er und seine Mitarbeiter wollten die christliche Missionsarbeit ganz gezielt auf alle »Heiden«, also auf Nichtjuden, ausdehnen.
Die Gegensätze zwischen den Anhängern des Petrus und denen des Paulus wurden während der 40er-Jahre des ersten Jahrhunderts in einer Art Generalversammlung ausgetragen, dem sogenannten Apostelkonzil von Jerusalem. Dieses erste Konzil war zugleich schon das letzte, das in der ursprünglichen Heimat des Christentums abgehalten wurde; denn im Lauf der Beratungen setzte sich die...