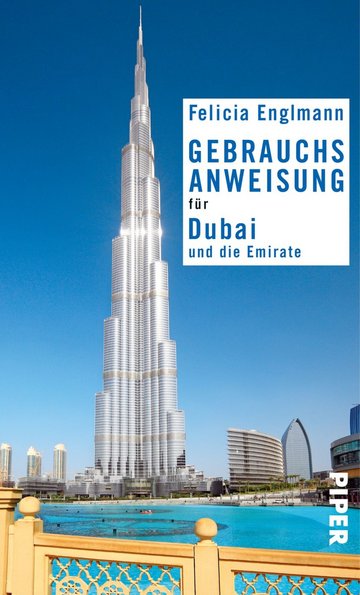Wüste, Meer und Metropolen – Die Vereinigten Arabischen Emirate
Arabeske: Mit der Abra in die Zukunft
Nur ganz leicht schaukelt der kleine Kahn bei seiner Fahrt über den Creek, jenen Meeresarm, der Dubai in zwei Teile zerschneidet. Dunkelbraun und wenig lockend ist das Wasser hier zwischen den Vierteln Deira und Bur Dubai. Alle Passagiere bleiben daher gerne auf der sicheren Pritsche sitzen, wenn die Abra, der kleine Fährkahn, über die finsteren Fluten schippert. Die meisten Fahrgäste sind Männer, haben die Ellbogen auf die Knie gestützt, die dunklen Gesichter gesenkt, den Blick auf das Sonnenfunkeln über dem Wasser gerichtet oder ein paar Zentimeter unter die Oberfläche, in die Tiefen, wo die zerborstenen Träume mancher Einwanderer dem Meer entgegentreiben. Die Männer kommen von der Arbeit oder sind auf dem Weg dorthin und nutzen die paar Minuten der Überfahrt für einen Moment Ruhe.
Die Touristen an Bord heben den Blick, drehen sich hierhin und dorthin, fotografieren eifrig und schaffen es doch nie, das 360-Grad-Panorama um die Abra herum richtig einzufangen. Es sind gleißende Hochhäuser, das historische Kaufmannsviertel Bastakiya, der Regierungssitz des Scheichs, der Souq mit seinen schmuddeligen Außenwänden, die kleine Uferpromenade von Shindagha, die Kormorane auf den modrigen Holzpfählen, betoncharmante Hotels aus den Siebzigerjahren, der Gewürzmarkt, das Parkhaus im Stil eines Perlenhändlerpalasts, die hölzernen Dhows (altbewährte Fährschiffe), bereit für die Überfahrt in den Iran, hoch aufgeladen mit Kühlschränken, Autoreifen, Saftpaletten und Mikrowellen. Es sind der Stau an der Uferstraße und wieder die Hochhäuser, in deren glänzenden Fassaden sich die ganze Szenerie noch einmal spiegelt. Ein lebendiges Diorama der Stadt zwischen übermäßig Konserviertem, Überlebtem und Übermorgenland, voller Visionen eines besseren Morgen, durch das sich leicht schaukelnd die Abra bewegt und mit Dieselqualm und Tuckern darauf aufmerksam macht, dass dies eine ganz profane Überfahrt ist und kein Sightseeingtour.
Die Abras sind die Verbindung zwischen den beiden ältesten Vierteln Dubais, und mögen sie auch mit keuchenden Motoren ausgestattet sein, so sind sie doch archaisch geblieben. Aus Holz gezimmert, dunkel verwittert, mit niedriger Bordwand, zielstrebig gerecktem Vorsteven und einem kleinen Sonnendach über der Sitzfläche. Nur Schwimmen wäre altertümlicher. Und doch sind die Abras keine Folklore, sondern mittendrin in der summenden Millionenmetropole, eine geliebte Tradition, die es erst möglich macht, in wenigen Minuten von Vorgestern nach Übermorgen zu fahren, und dies ganz wörtlich.
Die Abra-Station in Bur Dubai liegt direkt am Souq, dem alten Markt, ein paar Gehminuten von dem aus Lehm gebauten ersten Scheichsitz entfernt. Hier wird zwar beim Einsteigen nicht gedrängelt, aber hektisch kann es schon werden. Pro Kahn gibt es nur 20 Sitzplätze, und auf den nächsten mag man nicht warten, sodass die Männer sehr zielstrebig auf die wackeligen Planken steigen und sich niederlassen, während die Besucher fragen, ob das auch die richtige Abra sei – und überhaupt, weshalb ihnen meist die schlechten Plätze an den Ecken und Stirnseiten bleiben. Wer trödelt oder innehält, um Fotos zu machen, wird vom Bootsführer zurechtgewiesen, denn die Abra-Überfahrt ist keine Spaßreise, sondern der schnellste Weg, um von einem Ufer zum anderen zu gelangen. Es gibt natürlich den ewig verstopften Autotunnel in Shindagha und die neuen Brücken im Landesinneren, zu denen man erst durch enge Straßen hinstauen muss, aber den Umweg über diese Wunder der Infrastrukturentwicklung macht niemand, der nur von hier nach dort möchte. Einen Dirham kostet die Fahrt, und wer die runde Münze nicht von selbst bereitlegt oder gar nur einen Schein dabeihat, wird schon wieder zurechtgewiesen, in Hindi oder Urdu oder gebrochenem Englisch, welche Sprache der Bootsführer eben gerade sprechen mag. Die zufällig auf der Abra versammelten Fahrgäste sind ein Querschnitt der Stadt: überwiegend Einwanderer aus Asien, ein paar weiße Gesichter, ganz selten ein einheimischer Emirati, der sich aus Lust an der Tradition an Bord begibt oder aus Bequemlichkeit lieber zwischen den Einwanderern sitzt und die Zeit der Überfahrt nutzt, um mit dem Handy zu telefonieren oder auch nur darauf herumzutippen. Es ist üblicherweise das neueste Smartphone-Modell, das aus der Hemdtasche gezogen wird.
Die Einheimischen erwecken den Anschein, als wäre das Schiffchen eine Wartebank am Flughafen und als wäre dieses Panorama eine weiße Wand. Doch gerade sie können sich daran erinnern, wie es hier gestern noch ausgesehen hat – vor dem Bau der Hochhäuser, des Parkhauses, der Siebzigerjahrebetonbauten, als der Creek die Lebensader einer Stadt war, die kaum Zukunft hatte, damals, vor dem Öl. Sie leben im Heute, wo der Creek seine Bedeutung als Achse der Stadt verloren hat und die Megaviertel mit ihren Megabauten nicht einmal in Sichtweite sind. Und sie fahren auf der Abra, weil sie ein Morgen planen für die Viertel am Creek – besonders weiter oben im Landesinneren –, trotz der Krise von 2008, die einige der Entwicklungspläne in den Creek gewaschen hat. Eine Zukunft mit noch mehr glitzernden Megabauten und einer neuen Brücke, die im Volksmund »Dubai Smile« heißt. Auch sie wird die Abras nicht ersetzen. Noch nicht. Auch unter ihren lächelnden Bögen werden einige weitere Träume und Visionen Richtung Meer treiben. Gestern, heute, morgen – im Creek fließt alles ineinander, und die Abra fährt darüber hinweg, neuen Ufern entgegen.
Der Sand der Zeit
Dubais Wurzeln reichen so tief in den Wüstensand, dass niemand mehr weiß, was der Name der Stadt eigentlich bedeutet. Die erste Siedlung entstand schon während der Bronzezeit am heute so emsig befahrenen Creek, aber ob sie seitdem ständig bewohnt war, ist fraglich. Wie überhaupt so vieles in der Geschichte der heutigen Emirate, die weit zurückreicht und doch so sehr vom Sand der Zeit verweht wurde, dass wenig von ihr erhalten geblieben ist.
In dieser Region ist das auch wenig überraschend, denn Sand und Salz machen den größten Teil der Landschaft aus. Im Süden, wo sich heute das größte Emirat Abu Dhabi erstreckt, besteht die Küste aus weitläufigen Salzmarschen, Mangrovenwäldern, Lagunen und vorgelagerten Inseln im flachen Wasser; im Hinterland wellen sich Sanddünen, die bis zu 300 Meter hoch werden – das »Leere Viertel«, wie es bis heute heißt, da es außer Sand und Hitze dort nichts gibt. Mit Ausnahme der großen und fruchtbaren Oasen Liwa und Al-Ain, die der Trockenheit trotzen. In den nördlichen Emiraten zieht sich ein Ausläufer des Hajar-Gebirges quer durchs Land, mit kleinen Quellen und Wasserläufen, wovon die nordöstlichen Küstenebenen profitieren, in denen Plantagenwirtschaft möglich ist. Dennoch sind über 80 Prozent der emiratischen Landfläche Wüste.
Sieben Emirate mit jeweils gleichnamiger Hauptstadt verteilen sich auf diesem Gebiet, das etwa so groß ist wie Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland zusammen. In den drei größeren und reicheren Emiraten Abu Dhabi, Dubai und Sharjah leben etwa 85 Prozent der emiratischen Bevölkerung. Die kleineren Emirate Fujairah, Ras Al-Khaimah, Umm Al-Quwain und Ajman stehen sowohl bei Fläche als auch bei der Bevölkerungszahl, dem Pro-Kopf-Einkommen und der Entwicklung hinten an. Ajman, das kleinste Emirat, ist nur ein bisschen größer als das Stadtgebiet von Frankfurt am Main, dafür leben im Vergleich dazu nur halb so viele Bürger in Ajman.
Keine frühen Hochkulturen, keine legendären Herrscher, keine mittelalterlichen Großtaten sind in der emiratischen Geschichtsschreibung belegt. Die archäologischen Funde sprechen von nomadischen Hirten, die seit 8000 vor Christus gelegentlich vorbeizogen. Auf den Inseln vor Abu Dhabi haben sie ihre Spuren hinterlassen, ebenso am Jebel Al-Buhais, einem Berg in Sharjah. Eine etwas stetigere Besiedelung der Region verraten die Zeugnisse von der Bronzezeit an, etwa ab 3000 vor Christus. »Hafit-Kultur« nennen Forscher diese Siedler, nach dem Jebel Hafeet, einem Berg im Landesinneren. Bienenstockförmige Gräber aus Stein haben die Siedler dort hinterlassen, ein paar Scherben und Werkzeuge, die davon zeugen, dass es keine reichen Menschen waren, die sich in die Wüste wagten, keine wohlorganisierten wie in den benachbarten Reichen: dem der Sumerer im heutigen Irak, der Perser, der Ägypter und dem Reich Magan im heutigen Oman. Nicht einmal vergleichbar mit dem lebhaften Handelsplatz Dilmun im heutigen Bahrain, etwas den Golf hinauf. Einfachheit prägte das Leben der frühen Siedler, Wassermangel, Hitze, Armut. Daran würde sich auch in den kommenden Jahrtausenden wenig ändern.
Den Hafeet-Leuten folgten die Umm-An-Nar-Leute, benannt nach der Insel Umm An-Nar vor der Küste Abu Dhabis, wo eine britische Expedition in den Sechzigerjahren erstmals runde steinerne Grabmonumente aus jener Zeit fand. Auch in der Nähe des Jebel Hafeet, im Ortsteil Hili der Oasenstadt Al-Ain, wurden 1959 solche Gräber entdeckt, dazu Lehmhäuser und ein kleines Fort. Eine Oryxantilope und ein Händchen haltendes Paar sind als Relief über einem der Grabeingänge eingemeißelt, auf der Rückseite des Baus ist ein koitierendes Paar verewigt. Das kleine Steinbild ist leicht zu übersehen, denn gemessen an dem, was die Schauplätze antiker Hochkulturen an archäologischen Wunderwerken zu bieten haben, ist der Archäopark von Hili so bescheiden wie die Menschen, die einst die dort zu bestaunenden Gebäude errichteten. Für die modernen Emiratis ist das Steinbild aber eine Ikone geworden, zeigt es doch, dass ihre Kultur genau wie alle anderen der...