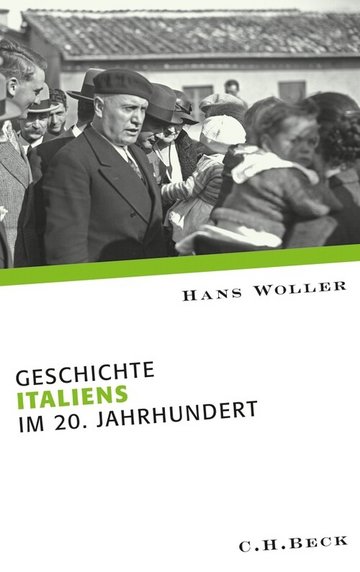Einleitung
«Unsere gesamte politische Geschichte weist einen Hang zum Parodistischen auf. Mussolini war eine Parodie des wahren totalitären Faschismus. Die Nachkriegsdemokratie mit ihrer Parteienherrschaft war eine Parodie der Demokratie, und jetzt erleben wir die Parodie einer Revolution. Die Opera buffa ist unsere Lieblingsgattung.»1 So wie der Starjournalist Indro Montanelli im April 1994 in einer Art Lebensresümee äußern sich viele Italiener über die neueste Geschichte ihres Landes, das in der Gunst des eigenen Volkes immer tiefer zu sinken scheint. Selbst zahlreiche Soziologen, Philosophen und Politologen, die von Berufs wegen eigentlich zur Nüchternheit verpflichtet wären, stoßen in dasselbe Horn und verlängern die Litanei der bissig-überzogenen Selbstkritik, die freilich nie ganz ernst genommen werden darf. Ihr haftet nämlich fast immer etwas Artifizielles, beinahe Spielerisches an, weshalb sie auch leicht ins Gegenteil umschlagen kann, wenn Unbefugte − zumal von außen – Kritikwürdiges an Italien entdecken.
Natürlich hat diese mitunter neurotische Selbstdarstellung auch in der italienischen Geschichtswissenschaft Anhänger gefunden. Viele Historiker neigen ebenfalls zu abfälligen Pauschalurteilen über die eigene, längst nicht hinreichend erforschte Geschichte, wobei diese Unsitte noch dadurch verschärft wird, dass bei der Urteilsbildung nicht selten parteipolitische Präferenzen den Ausschlag geben – selbst heute noch, wo der Rechts-Links-Gegensatz doch viel von seiner alten Virulenz verloren hat. Sie verfehlen damit die Realität ebenso krass wie manche ihrer ausländischen Kollegen, die Italien zu einem unschuldigen Arkadien verklären oder aber wie ein exotisches Schattenreich behandeln, das mit seinen Agenten, Geheimlogen und Mafiabossen nur den Ausnahmezustand kennt.
In diesem Buch hingegen wird der Versuch unternommen, die Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert sine ira et studio zu betrachten und ihr damit auch jene Komplexität und Ambivalenz zurückzugeben, die schon die Zeitgenossen in Atem hielt. Der Blick von außen mag dabei nicht unproblematisch sein. Italienische Gelehrte kennen im Umgang mit ihrer Sprache natürlich keine Rätsel und sie sind auch mit den Besonderheiten ihres Landes besser vertraut als Forscher anderer Nationalität, die freilich auch einen Standortvorteil haben, der nicht zu unterschätzen ist: Sie sind vor parteipolitischen Einseitigkeiten gefeit, können die gerade in Italien verbindlichen ungeschriebenen Gesetze akademischer Rücksichtnahmen ignorieren und sind – angesichts ihrer eigenen Erfahrungen – vielleicht auch eher in der Lage, eine europäische Vergleichsperspektive zu eröffnen, die es erlaubt, Anhaltspunkte für Normal- und Sonderwege Italiens im 20. Jahrhundert zu gewinnen und das ewige Lamento über italienische Anomalien und Devianzen zu beenden.
Der Anspruch ist also hoch gesteckt und nur dann wenigstens annähernd einzulösen, wenn es gelingt, ein Deutungsangebot zu unterbreiten, das den Leser in die Lage versetzt, die wesentlichen Triebkräfte historischer Prozesse zu erkennen und die roten Fäden zu identifizieren, die Italiens neuere Geschichte durchziehen. Der Autor kann hier auf Anregungen zurückgreifen, die Ulrich Herbert2 als Orientierungshilfe für die von ihm inspirierte Reihe «Europäische Geschichte im 20. Jahrhundert» angeboten hat. Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die Entfaltung der Industriegesellschaft, die nach 1890 überall in Europa zu beobachten war, überall tief greifende Umwälzungsprozesse auslöste und überall zu einer fast panischen Suche nach den richtigen Antworten auf den Modernisierungsstress in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft führte – mit häufig fatalen Ergebnissen, weil mit dem Nationalsozialismus und dem Bolschewismus zwei Regime die Bühne betraten, die als die radikalsten «Alternativen zum liberalkapitalistischen Weg in die Moderne» gelten können und nichts als Leid und Tod hinterließen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann sich in West-, Nord- und Südeuropa die zuvor fast generell verworfene «liberale Option» zu behaupten, während sie jenseits des Eisernen Vorhangs ihre große Stunde 1989/90 erlebte. Die drängendsten Probleme der Jahrhundertwende schienen damit gemeistert, West und Ost hatten eine gemeinsame Antwort auf die Herausforderungen der Industriegesellschaft gefunden, die freilich zu diesem Zeitpunkt schon so viel von ihrer ursprünglichen Veränderungsdynamik verloren hatte, dass Herbert vom «Ende der Hochmoderne» und dem Beginn einer neuen Epoche spricht, die schon in statu nascendi eine Art soziologische Nottaufe als «Postmoderne» oder «Zweite Moderne» erhalten habe.
Italien folgte diesem beschwerlichen Weg in die Moderne und aus ihr heraus, musste dabei aber einige Hindernisse überwinden, die anderswo nicht bestanden, und wich deshalb mitunter so weit von der Hauptroute ab, dass man von einem Sonderfall oder «Modell Italien»3 sprechen kann: Italien war um 1900 noch ganz agrarisch geprägt, unternahm aber bereits damals vielerlei Anstrengungen, um den Makel der Rückständigkeit abzustreifen, der dem Land seit langem anhaftete. Den Schlüssel zum Erfolg erblickte man – hier wie anderswo – in einer vom Staat forcierten Industrialisierung, die auch rasch an Fahrt gewann, zugleich aber ein solches Maß an zentrifugalen Kräften entfesselte, dass der junge, noch ganz ungefestigte Staat schon vor dem Ersten Weltkrieg am Rande eines Bürgerkriegs zu stehen schien. Heftige innere Konflikte waren der Preis für eine im Kern erfolgreiche Industrie- und Infrastrukturpolitik, die im Krieg und in den ersten Nachkriegsjahren fortgesetzt wurde und die bestehenden Spannungen immer mehr verschärfte. In den bitteren Auseinandersetzungen der Jahre 1919 bis 1922 setzte sich schließlich der von konservativ-reaktionären Kräften unterstützte Faschismus durch, der zu totalitärer Radikalisierung tendierte und auch vor kriegerischer Expansion nicht zurückschreckte. Das Regime Mussolinis stürzte das Land in eine militärische und moralische Katastrophe, hinterließ ihm aber auch ein Wirtschaftsmodell, das sich in seinen Grundzügen bereits nach der Jahrhundertwende herausgebildet hatte und dann im Zuge der faschistischen Aufrüstung durch die Kontrolle und partielle Übernahme ganzer Branchen durch den Staat komplettiert worden war.
Italiens Entwicklungspfad stand bis dahin ganz im Zeichen von Protektion, Lenkung und so massiver staatlicher Beteiligung an der Wirtschaft, dass später nicht wenige Beobachter Ähnlichkeiten mit dem Ostblock entdeckten. Italien, meinte der Economist noch Anfang der neunziger Jahre, sei «in der Gegend vom Ural bis zum Atlantik das einzig übrig gebliebene ‹sozialistische› Land»,4 während andere Presseorgane von der «größten realexistierenden Staatswirtschaft der westlichen Welt» sprachen.5 Italiens eigentliche Sonderentwicklung begann allerdings erst nach 1945, als das Land zur Demokratie zurückkehrte, gleichzeitig aber an den Hauptmerkmalen seines Wirtschaftsmodells festhielt, nachdem erste Versuche, die großen, im Faschismus entstandenen Staatsholdings zu privatisieren und die Unternehmen in die raue Welt des freien Marktes auszuwildern, fehlgeschlagen waren. Oberste Priorität hatte auch jetzt wieder die Förderung der modernen Schlüsselindustrien, wobei der Staat erneut für die nötigen Ressourcen sorgte, die Löhne niedrig hielt und seine expandierenden Konzerne einspannte, um in strategisch wichtigen Branchen zum Erfolg zu kommen. Der Staat war in der Wirtschaft omnipräsent und mit seinem «Modell» schließlich so erfolgreich, dass Italien in den siebziger Jahren tatsächlich das schier Unmögliche – den Aufstieg in den Kreis der führenden Industrienationen – schaffte.
Höhepunkt, Krise und Verfall lagen freilich nahe beieinander. Der Niedergang des «Modells Italien» begann Anfang der siebziger Jahre. Die kommunistischen Gewerkschaften verspürten damals angesichts einer fast erreichten Vollbeschäftigung Aufwind und nutzten diese komfortable Situation, um sich und den Partito Comunista Italiano in der Konkurrenz mit dem bürgerlichen Lager besser zu positionieren und zweistellige Lohnerhöhungen durchzusetzen, die von der Wirtschaft nicht zu verkraften waren. Die Zeche zahlte einmal mehr der Staat, der auch jetzt wieder einspringen musste, wenn die eigenen oder größere private Unternehmen vor der Pleite standen. Die Folge war eine Eskalation der Verschuldung, was wiederum dazu führte, dass der Staat kaum noch Mittel hatte, um in Forschung und Entwicklung zu investieren, wie das andere Länder massiv taten. Der neuen Verhandlungsmacht der Gewerkschaften war es auch zu verdanken, dass der Staat die sozialen Sicherungssysteme ausbaute und sich zunehmend intensiver um die Verlierer von Modernisierung und Industrialisierung kümmerte, die zuvor ganz ignoriert oder mit Macht ruhig gestellt worden waren. Die Verlierer und vor allem die sozialen Notstandsgebiete des Südens durften deshalb jetzt mit beträchtlichen Transferleistungen rechnen, die allerdings den Haushalt ruinierten und die finanziellen...