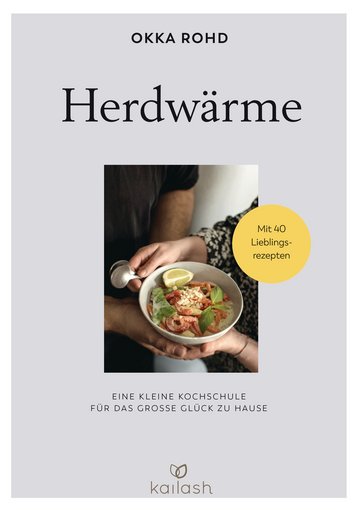Wie macht ein Österreicher Schnitzel?
Ernst Schleich
Angestellter der österreichischen Botschaft in Berlin
Ein Stück Kalbfleisch panieren und goldbraun backen: Das klingt nicht schwer. Aber wie das so ist mit den einfachen Dingen – man kann vieles falsch machen bei ihnen. Ernst Schleich macht alles richtig. Und er weiß auch, dass es ein Reserveschnitzel geben muss
Mein Mann ist Österreicher. Ich habe viel von ihm gelernt. Zum Beispiel, dass man gleichzeitig nett und muffig sein kann, dass sich ziemlich jede Zumutung mit einem »Geh, bitte!« anraunzen lässt, dass Aprikosen keine Marillen sind und man ohne die Redewendung, »das geht sich (nicht) aus« nicht wirklich gut durchs Leben kommt. Nur eines hat er mir nie beigebracht: wie man Wiener Schnitzel macht. »Geh, bitte«, sagt er, »warum solltest du Wiener Schnitzel machen, wenn du mich hast, außerdem wirst du eh nie verstehen, was ein Wiener Schnitzel zu einem Wiener Schnitzel macht.« Dann legt er seine Stirn in dramatische Falten und zählt mein Sündenregister auf: dass ich nichts dabei finde, mein Schnitzel mit Ketchup in Kontakt zu bringen (was wahr ist und wirklich gruselig) und ich meinen Kartoffelsalat gerne mit Joghurt und gehackten Essiggurken esse (was wahr ist und wirklich großartig schmeckt). Oder dass wir Deutschen es nicht hinbekommen, ordentliche Semmelbrösel anzubieten. Dafür kann ich persönlich zwar nichts, in meiner Eigenschaft als Deutsche aber sehr wohl.
Ich fragte also nicht ihn, sondern Ernst Schleich nach seinem Schnitzelrezept. Über das Schnitzel von Herrn Schleich wurde mir ausführlich vorgeschwärmt. Und er ist bei der österreichischen Botschaft in Berlin beschäftigt und kümmert sich dort ums Veranstaltungsmanagement. Er hat also erstens einen Ruf als Schnitzelkoch (den mein Mann nicht hat), und seine Schnitzel sind gleichsam diplomatisch, ein Gruß aus der österreichischen Staatsküche, besser ging es einfach nicht. Ich musste ihn einfach nur dazu überreden, mir das Panieren und die Geheimnisse des wirklichen Kartoffelsalates beizubringen. Damit würde ich den Herrn Gemahl beschämen (und hoffentlich erfreuen). Dann stellte sich heraus, dass ich Herrn Schleich gar nicht überreden musste. »Gern«, sagte er, »gar kein Problem, das bringe ich Ihnen bei.« Eines schönen Frühsommerfreitagnachmittags stand er dann in unserer Küche. Herr Schleich, den zu duzen mir nie in den Sinn gekommen wäre, hatte sogar Semmelbrösel mitgebracht.
Wahrscheinlich sind die Semmelbrösel das Wichtigste am Wiener Schnitzel. Aus ihnen wird die das Fleisch umhüllende goldene Panade, wie der Piefke, also ich, sagt. Der Österreicher sagt Panier, und der Österreicher, den ich liebe, hatte so lange über das Paniermehl gejammert, das man hier bekommt, bis ich ihm irgendwann Panko vorgeschlagen hatte – die Brotkrümel also, in denen die Asiaten Gemüse panieren, und die es bei uns um die Ecke gibt. Das klappte ganz gut. Möglicherweise waren sie ein wenig zu groß, aber immerhin nicht so klein und sandig, dass alles zu matschen begann. Seitdem gab es öfter Schnitzel. Wenn auch nicht die echten mit Semmelbröseln.
Dafür war jetzt Herr Schleich da. Er kannte eine Bäckerei in Berlin, die anständige Semmelbrösel machte – aus altem, geriebenem Weißbrot. Wir würden also echte Wiener Schnitzel machen. Staatsschnitzel, die so schmecken würden wie 1902 in der Hofburg oder sonntags bei Sigmund Freud, ein Gericht, für dessen Geschmack und Zubereitung eherne Regeln gelten, die man zu respektieren hat. Ein Mahl, das so bedeutsam für die österreichische Seele ist, dass man, wie Herr Schleich es an diesem Nachmittag sagte, den Adler im Staatswappen auch durch ein Schnitzel ersetzen könnte.
Das Fleisch: Kalbsschnitzel, dünn geschnitten. Ich hielt ihm schon den Fleischklopfer hin, den mein Mann einmal angeschafft hatte, aber Herr Schleich schüttelte energisch den Kopf. »Nein, tschuldigens, der Fleischklopfer geht gar nicht.« Der Fleischklopfer hatte nämlich Spitzen, die die Fasern des Schnitzels zerstören würden, und wer bitte möchte ein fasertief zerstörtes Schnitzel essen? (Es war der Moment, in dem ich innerlich ein klitzekleines bisschen zu triumphieren begann: Ich wusste jetzt schon mehr über das Schnitzel als der Österreicher, mit dem ich lebe, der nämlich immer ganz ungerührt mit dem Fleischklopfer ins Fleisch gehämmert hatte.) »Und jetzt?«, wollte ich wissen. Er ließ sich unsere kleine Stielkasserolle geben. Dann klopfte er das Fleisch mit deren Boden platt. In seiner Küche hätte er das mit einem Fleischplattierer gemacht, aber der Topf ging auch, Hauptsache, das Fleisch bekam es mit einer glatten Oberfläche statt mit faservernichtenden Riffelungen zu tun. Das Schnitzelklopfen, hatte mein Mann mir übrigens oft erzählt, war jenes Geräusch, das ihn immer an Wien erinnerte. »Jeden Sonntag, wenn du durch ein Mietshaus gehst, hörst du, wie die Menschen in ihren Küchen Schnitzel klopfen.« Und so, wie er das erzählte, klang es sehr poetisch. Dabei hat das Schnitzelklopfen einen ganz sachlichen Grund: Die Schnitzel müssen dünn sein. Man muss es schaffen, das Fleisch in derselben Zeit durchzubacken wie die Panier braucht, den vorgeschriebenen Goldton anzunehmen. Es dürfen ja weder das Schnitzelfleisch halbroh bleiben noch sein goldener Mantel verbrennen. »Wie dünn genau?«, fragte ich also. »Sieben Millimeter«, sagte Herr Schleich. Es gibt auch Köche, die behaupten, es dürften höchstens 3 Millimeter sein, andere sprechen von 4 Millimetern, wieder andere schwören, das perfekte Wiener Schnitzel habe eine Dicke (oder vielleicht eher: Dünne) von 5 Millimetern.
Als die Schnitzel 7 Millimeter dünn waren, setzte eine lange perfektionierte Choreographie ein. Herr Schleich nahm ein Stück Fleisch, zog es liebevoll durch einen tiefen Teller mit Mehl, wendete es, zog es noch einmal durchs Mehl, schüttelte das überflüssige Mehl ab, sehr sachte; er zog das Fleisch durch einen zweiten, tiefen Teller, in dem er 3 Eier sorgsam mit einer Gabel verschlagen und gesalzen hatte; dann wälzte er es in einer Auflaufform voller Semmelbrösel, ganz zart nur. Er klopfte die Brösel nicht fest, weil das ein unverzeihlicher Fehler gewesen wäre, die Panier sollte sich ja wellen – »soufflieren« nannte Herr Schleich das. Sie sollte das Schnitzel nicht einsperren wie eine zu enge Wurstpelle, sondern das Fleisch so locker umhüllen wie ein perfekt sitzender Trenchcoat. Dann kam das Schnitzel auch gleich schon in die Pfanne, in der er zuvor eine ganze Flasche Pflanzenöl erhitzt hatte. Richtig, eine ganze Flasche. »Das Schnitzel«, sagte Herr Schleich und machte eine kurze Pause, »muss schwimmen.« Und damit es gut schwimmen kann, muss genügend Öl in der Pfanne sein, zwei bis drei Zentimeter hoch muss es stehen, und es muss heiß genug sein, sonst wird alles matschig – aber nicht so heiß, dass das Schnitzel verbrennt. Herr Schleich maß die korrekte Temperatur mit einem einfachen Trick: Er formte einen der Brösel, die sich beim Panieren an seinen Fingern gesammelt hatten, zu einer kleinen Kugel und warf sie ins Öl. »Wenn sie zischend hochgeht, ist das Öl zu heiß, dann muss man es ein wenig herunterkühlen lassen. Taucht sie einfach unter, ist das Öl noch zu kalt.« Man kann, soweit ich das nachgelesen habe, auch einen befeuchteten Holzspieß in das erhitzte Öl tauchen – steigen dann schnell Bläschen auf, ist die Temperatur korrekt.
Gleich nachdem das Schnitzel in die Pfanne gelegt worden war, begann Herr Schleich an derselben zu ruckeln, nicht ruppig, eher aus dem Handgelenk heraus. »Das dient dem Soufflieren«, sagte er. Das Öl sollte ein wenig verteilt werden und das Schnitzel sich nicht faul niederlassen. Nach anderthalb Minuten wurde es gewendet, er erkannte den richtigen Zeitpunkt nicht nur an der goldbraunen Farbe, sondern auch daran, dass das Schnitzel jetzt anders klang. »Das Schnitzelbraten hat viel mit Gehör zu tun«, sagte er. »Hören Sie … Jetzt«. Und ich bilde mir ein, dass das Pfannenbrutzeln tatsächlich anders klang als am Anfang des Schnitzelbratens, es wird nämlich immer höher. Er drehte das Schnitzel um. Rüttelte wieder ein wenig. Nahm es schon nach einer Minute aus der Pfanne, weil es goldbraun und ganz genau richtig war, und bettete es auf einen Teller mit Küchenkrepp, um das überschüssige Öl aufzufangen. Das Schnitzel sollte ja nicht fettig, sondern knusprig sein.
»Was für ein Prachtstück«, dachte ich und sagte es auch schon. Die Hülle hatte sich ein wenig gewölbt und Blasen geworfen, und sie leuchtete golden wie ein neuer Sommertag. »Wollens kosten?«, fragte Herr Schleich. Ich nickte. Herr Schleich schnitt es auf, unser erstes gemeinsames Schnitzel, das er Probierschnitzel nannte. »Es ist wichtig«, sagte er, »dass es immer ein Probierschnitzel gibt.« Er schnitt einen Bissen ab und gab ihn mir. »Gut«, fragte er. »Ein Gedicht«, sagte ich. Er lächelte.
Nun ging es weiter. Ein Schnitzel nach dem anderen wanderte in die Pfanne, aber nie mehr als zwei gleichzeitig. Sie wurden gerüttelt, gewendet, erneut gerüttelt, auf Küchenkrepp getrocknet und dann im Backofen bei 50 °C auf einem mit Küchenkrepp ausgelegten Rost warm gehalten, bis unser Schnitzelberg fertig war. »Wer soll das alles essen?«, fragte ich. »Sie werden schon sehen«, antwortete Herr Schleich. Und dass es auch wichtig sei, immer ein paar Reserveschnitzel zu machen, für die sich beim Schnitzelessen unweigerlich einstellende Schnitzelgier.
»Essen ist fertig!«, rief ich, und mein Mann und meine große Tochter, die schon lange gelitten hatten, weil der Duft aus der...