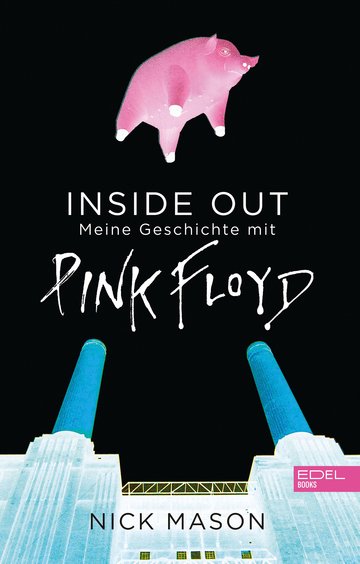ALS SICH ROGER WATERS zum ersten Mal herabließ, das Wort an mich zu richten, studierten wir am College schon fast ein halbes Jahr lang Architektur zusammen. Eines Nachmittags, während ich versuchte, das Gemurmel von vierzig Kommilitonen auszublenden und mich auf die technische Zeichnung zu konzentrieren, die vor mir lag, fiel sein langer, unverwechselbarer Schatten auf meinen Zeichentisch. Bis dahin hatte mich Roger geflissentlich ignoriert, doch nun war der Augenblick gekommen, da er in mir eine musikalisch wesensverwandte Seele erkannte, gefangen im Körper eines angehenden Architekten. Die Sternbilder von Jungfrau und Wassermann hatten unser Schicksal bestimmt und Roger veranlasst, nach einem Weg zu suchen, um unsere Geister zu einem großen schöpferischen Abenteuer zu vereinen.
Nein, nein, nein. Ich werde mich bemühen, das Märchenerzählen auf ein Minimum zu beschränken. Der einzige Grund, warum Roger damals an mich herantrat, war der, dass ich ihm mein Auto leihen sollte.
Das betreffende Gefährt war ein Austin Seven, Baujahr 1930, ein »Chummy«, den ich für zwanzig Piepen erstanden hatte. Nicht gerade die erste Wahl für Teenager meiner Generation – ein Morris 1000 Traveller oder Ähnliches wären sicherlich weit praktischer gewesen. Aufgetrieben hat das Exemplar mein Vater, dem ich die Liebe zu alten Autos verdanke – und meine Grundausbildung zum Kfz-Mechaniker, um den »Chummy« am Laufen zu halten. Roger muss ziemlich in der Klemme gesteckt haben, dass er mich überhaupt danach fragte. Bei dem Schneckentempo, das der Austin vorlegte, war ich einmal aus purer Verlegenheit gezwungen gewesen, einen Tramper mitzunehmen, weil ich so langsam fuhr, dass er dachte, ich wolle anhalten und ihn an Bord nehmen. Ich sagte Roger, der Wagen sei aus dem Verkehr gezogen, was nicht so ganz stimmte. Einerseits lieh ich ihn einfach ungern aus, andererseits fand ich Roger wohl auch ziemlich nervig. Kurz darauf sichtete er mich am Steuer des Austin, was ihm einen ersten Vorgeschmack auf meinen Hang gab, in der Grauzone zwischen Doppeldeutigkeit und Diplomatie zu lavieren. Zuvor hatte er einmal Rick Wright, der auch zu unserem Jahrgang gehörte, um eine Zigarette angehauen und war glatt abgeschmettert worden – ein frühes Zeugnis von Ricks legendärer Großzügigkeit. Jene ersten belanglosen Kontaktaufnahmen im Frühjahr 1963 waren der Beginn der wunderbaren Freundschaft, die uns in den kommenden Jahren verbinden sollte.
Pink Floyd entstand aus zwei überlappenden Cliquen: der einen aus Cambridge, woher Roger, Syd Barrett, David Gilmour und viele weitere aus dem künftigen Umfeld der Gruppe stammten, und der anderen aus London, zu der Roger, Rick und ich im ersten Studienjahr an der Fakultät für Architektur im Polytechnikum zusammenfanden. Dort setzen meine Erinnerungen an unsere gemeinsame Geschichte ein.
Meine Laufbahn als Schlagzeuger schien eigentlich schon beendet, als ich mich im Poly einschrieb (das später hochtrabend zur »University of Westminster« umgetauft wurde). Das College lag damals an der Little Titchfield Street, im Herzen des West End nahe der Oxford Street. Im Rückblick scheint das Poly einer lange vergangenen Ära anzugehören, mit seinen altmodischen Holzvertäfelungen, die an eine riesige, zweckdienlich gestaltete Privatschule denken ließen. Soweit ich mich erinnere, verfügte es – abgesehen von einer Art Teeküche – über keinerlei zusätzliche Einrichtungen. Da es aber mitten in dem Viertel mit den angesagten Klamottenläden rund um Great Titchfield und Great Portland Street lag, gab es überall Cafés, wo man bis mittags Spiegeleier, Würstchen und Pommes Frites bekam und dann zum Tagesmenü aus Rindernierenpastete und Marmeladenstrudel übergehen konnte.
Die Fakultät für Architektur teilte sich den Bau mit einer Reihe weiterer verwandter Fachrichtungen und hatte einen guten Namen. Die Lehrmethoden waren allerdings noch reichlich konservativ: Eine typische Vorlesung in Baugeschichte sah so aus, dass der Dozent einen minutiösen Grundriss beispielsweise des Luxor-Tempels von Karnak an die Tafel zeichnete, den wir dann kopieren mussten – wie alle Erstsemester seit dreißig Jahren. Immerhin hatte die Fachhochschule vor nicht allzu langer Zeit auch Gastvorlesungen in den Lehrplan aufgenommen und dazu bereits etliche wirklich innovative Architekten wie Eldred Evans, Norman Foster und Richard Rodgers gewonnen. Für Form hatte man an der Fakultät ohne Zweifel einen guten Blick.
In das Studium war ich ohne große Ambitionen mehr oder weniger hineingeschlittert. Ich fand das Fach durchaus interessant, wollte aber nun nicht unbedingt damit Karriere machen. Ich dachte wohl, ich könnte mir ebenso gut mit Architektur meinen Lebensunterhalt verdienen wie mit irgendetwas anderem. Allerdings war es auch nicht so, dass ich während meiner Zeit am College ständig davon träumte, Musiker zu werden. Damit hatte ich mich schon als Teenager versucht, letztlich war es dann aber doch wichtiger gewesen, endlich den Führerschein zu machen.
Auch wenn es mir also an brennendem Ehrgeiz mangelte, bot der Studiengang doch eine Vielzahl von Kursen im künstlerischen, grafischen und technischen Bereich, also eine umfassende Ausbildung, die wohl auch Rogers, Ricks und mein Interesse daran weckte, was an visuellen und anderen Effekten technisch machbar war. Damit beschäftigten wir uns in den Folgejahren immer intensiver, von der Konstruktion turmhoher Lichtanlagen über die kunstvolle Gestaltung von Plattencovern bis hin zum Studio- und Bühnendesign. Dank unseres Architekturstudiums konnten wir relativ kompetente Kommentare abgeben, wann immer wir echte Experten zu Rate zogen.
Ursprünglich verdanke ich mein Interesse an der Vermischung von Technischem und Visuellem vermutlich meinem Vater Bill, einem Dokumentarfilmer. Als ich zwei Jahre alt war, nahm er einen Job bei der Filmproduktionsfirma Shell an, und wir zogen von meinem Geburtsort Edgbaston, einer Vorstadt von Birmingham, nach North London, wo ich meine prägenden Jahre verlebte.
Mein Vater war zwar nicht ausgesprochen musikalisch, doch sehr an Musik interessiert, vor allem, wenn sie unmittelbar mit einem seiner Filme zu tun hatte. Dann konnte er sich total dafür begeistern, egal ob es sich um jamaikanische Steelbands, Streicherformationen, Jazz oder die wilderen E-Sounds von Ron Geesin handelte. Außerdem war er von Aufnahmegeräten, Stereo-Testplatten, Klangeffekten und Rennwagen fasziniert, in den verschiedensten Kombinationen – alles Interessen, die ich von ihm geerbt habe.
Den einen oder anderen Hinweis auf musikalisches Talent gab es in unserer Familie allerdings doch: mein Großvater mütterlicherseits, Walter Kershaw, und seine vier Brüder waren Mitglieder einer Banjo-Band, die ein Stück namens ›The Grand State March‹ herausbrachte. Meine Mutter Sally, eine begabte Pianistin, hatte Stücke wie ›Golliwog’s Cakewalk‹ von Debussy im Repertoire. Unser heimisches Sortiment von Schellackplatten, ein wildes Sammelsurium, erstreckte sich von Klassik über kommunistische Arbeiterlieder, vorgetragen vom Chor der Roten Armee, bis hin zu ›The Teddy Bear’s Picnic‹ und ›The Laughing Policeman‹. Zweifellos kann man all das irgendwo aus unserer Musik heraushören – mögen es andere ausfindig machen, wenn sie die Energie dazu aufbringen. Eine Zeitlang hatte ich Klavier- und Geigenunterricht, doch der förderte kein musikalisches Wunderkind zutage und wurde darum wieder eingestellt.
Ich bekenne mich auch zu der rätselhaften Anziehungskraft, die Fess Parkers 1956 in England veröffentlichte Single ›The Ballad of Davy Crockett‹ auf mich ausübte. Schon damals gab es ganz eindeutig die unheilige Allianz zwischen Musik und Kommerz – war ich doch alsbald stolzer Besitzer einer todschicken Mütze aus künstlichem Waschbärfell, an der vor allem ein lang herunterhängender Schwanz ins Auge stach.
Mit ungefähr zwölf Jahren begann ich, Rockmusik bewusst wahrzunehmen. Ich erinnere mich noch, wie ich mich bemühte, so lange wach zu bleiben, bis Horace Batchelor mit seinen todsicheren Toto-Tipps auf Radio Luxemburg fertig war und Rocking To Dreamland kam. Ich erstand ›See You Later Alligator‹ von Bill Haley als 78er Platte im örtlichen Elektroladen und verhalf dem Song damit im März 1956 zum Aufstieg in die britischen Top Ten, und im selben Jahr noch musste mein Taschengeld für ›Don’t Be Cruel‹ von Elvis Presley dran glauben. Beides wurde auf dem neuen, hochmodernen Familiengrammofon abgespielt, das Stromanschluss hatte und insgesamt wie eine Kreuzung aus einer Vitrine von Ludwig XIV. und dem Armaturenbrett eines Rolls Royce aussah. Mit dreizehn hatte ich meine erste Langspielplatte – Rock ’n’ Roll von Elvis. Für mindestens zwei weitere Mitglieder von Pink Floyd und nahezu unsere gesamte Generation von Rockmusikern war dieses bahnbrechende Album ebenfalls die erste LP. Es bot nicht nur fantastische neue Musik, sondern für rebellierende Teenager den zusätzlichen Reiz, dass Eltern es mit ähnlicher Begeisterung aufnahmen wie sonst nur eine Spinne als Haustier.
Etwa um diese Zeit machte ich mich mit meinem Schulranzen, in kurzen Flanellhosen und Schulblazer nach East London auf, wo Tommy Steele in einer Varietéshow auftrat. Von meinen Freunden schien sich keiner dafür begeistern zu können, also fuhr ich allein. Tommy war die Attraktion des Abends, den Rest konnte man vergessen. Komiker, Jongleure und andere aus englischen Konzerthallen Vertriebene mühten sich um die Wette, den Saal zu leeren, bevor Tommy dran war. Aber ich hielt tapfer aus. Und muss sagen, er war eine Wucht. Er sang ›Singing The Blues‹ und ›Rock With The Caveman‹ und sah genauso aus wie in The Six-Five Special, der ersten Popmusikshow...