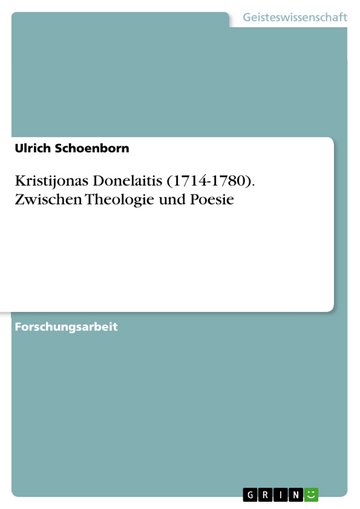Christian Donalitius resp. Kristijonas Donelaitis, der 37 Jahre, von 1743 bis 1780, in Tolmingkehmen, einem Dorf am Rand der Rominter Heide als protestantischer Pfarrer gewirkt hat, gilt als „Klassiker der litauischen Literatur“ und wird in Litauen neben Martynas Mažvydas (1510-1563)[1], Verfasser des ersten Buches in litauischer Sprache (1547), gestellt. Seit 1971 gibt es in Kirche und Pfarrhaus von Tolmingkehmen oder „Tschistye Prudy“, wie der Ort heute auf Russisch heißt, ein Museum, das die Erinnerung an den Pfarrerdichter pflegt.
Abb. 2: Donelaitis-Museum in der Kirche von Tolmingkehmen/ Tschistyje Prudy
Donelaitis führte eine „sprachliche Doppelexistenz“, d.h., er bewegte sich sowohl im deutschen wie im litauischen Sprachmilieu. Diese „Doppelheit“ hat keine diffuse „Doppeldeutigkeit“ in seinem Schreiben und Handeln angelegt. Seine Liebe galt zweifelsfrei den einfachen Bauern litauischer Herkunft, als deren Seelsorger, Anwalt und Lehrer er sich berufen fühlte. Er selbst hat nichts unternommen, um sein dichterisches Werk in der literarischen Welt bekannt zu machen. Wiewohl Zeitgenossen die Bedeutung des Dichters Donelaitis erkannten, erschien erst 1818 das Hauptwerk, das ihn berühmt machen sollte: „Das Jahr in vier Gesängen, ein ländliches Epos aus dem Litthauischen des Christian Donaleitis, genannt Donalitius, in gleichem Versmaß ins Deutsche übertragen“[2].
Ludwig Rhesa (1776 - 1840), Theologieprofessor und Lituanist in Königsberg, gebührt der Verdienst, die erste Übersetzung ins Deutsche vorgelegt zu haben. Angeregt durch Wilhelm von Humboldt hatte Rhesa die Initiative ergriffen und Donelaitis’ Werk einem größeren Leserkreis bekannt gemacht. Seinem „Vorbericht“ schickte er einen Hexameter voraus, nicht nur um dem großen Gelehrten Dank abzustatten. Er ordnete Doneleitis in die Literaturgeschichte ein und wollte, zumal in den letzten zwei Zeilen, die Intention des Dichters erfassen. Hier liegt also die „erste Interpretation“ des Jahreszeiten-Gedichts vor. Rhesa verstand sich selbst in der Nachfolge des Donelaitis als Förderer des Litauischen als Volkssprache:
„An der Rominta Gestad’ umkränzet von grünenden Rauten,
Sang der Sänger, entsprossen uralter Leitonen Geschlechte,
Patriarchalischer Sitten, Unschuld und häusliche Tugend,
Schlicht auf ländlicher Flöte die seligen Wonnen des Jahres;
Frühling, Nachtigalsang, Aufspross der Blumen und Saaten;
Arbeitseligen Sommer der bastsohlentragenden Männer,
Gabenspendenden Herbst, Brautkranz, Festjubel und Gastmahl;
Winterflammen am Heerd unter schneebestürmetem Halmdach,
Wenn geschäftig sich regt sammt spinnenden Mägden, die Hausfrau.
Also die blühenden Zeiten des sternendurchwandelnden Jahres
Lehrt’ er die dörfliche Schaar haushalten in fleissiger Stille,
Gott auch fürchten von Herzen und lieben die Heimath der Väter“.
Die Wirkungsgeschichte der Jahreszeiten-Dichtung indes zeigt einen komplexen Verlauf. Im 19. Jahrhundert sind noch drei weitere Übersetzungen ins Deutsche erschienen[3], die von philologischen und sprachwissenschaftlichen Diskussionen begleitet waren. Aufmerksame Lektüre läßt die in jener Zeit in Deutschland herrschenden romantischen bzw. historistischen Maßstäbe erkennen. Danach hat das Interesse an Donelaitis in der deutschen Literaturwissenschaft nachgelassen. Im litauischen Sprachraum begann eine intensivere Beschäftigung mit Donelaitis relativ spät. Verantwortlich dafür waren die besonderen politischen Umstände im 20. Jahrhundert, die eine Vielfalt widersprüchlichster Interpretationen und Aneignungen[4] haben entstehen lassen.
Abb. 3: Die Donelaitis-Skulptur wurde zum 250. Geburtstag 1964 in der Universität Vilnius aufgestellt.
Die Wiederkehr des 250. Geburtstages 1964 und die Errichtung der Gedenkstätte in Tolmingkehmen haben der Forschung neue Impulse gegeben. Zudem wurde Donelaitis durch Übersetzung seiner Jahreszeiten-Dichtung über die Grenzen Litauens bekannt und weckte großes Interesse. In der Gegenwart sieht sich die Beschäftigung mit dem Werk von Donelaitis nicht nur mit einer verwickelten Wirkungsgeschichte in Deutschland wie in Litauen konfrontiert, sondern stößt auch bald auf ein hermeneutisches Dilemma.
Eine Beobachtung, die während jener im Vorwort genannten Konferenz 2013 gemacht werden konnte, mag das konkretisieren. Sowohl in den Vorträgen als auch in der Diskussion wanderte der Focus immer wieder zurück zum „historischen Donelaitis“, d.h., es wurden Fragen zu Leben und Werk (wo? wann? warum? wie? womit? zu wem? mit wem? gegen wen? o.ä.) aufgeworfen. Oder man verfolgte Spuren des „philologischen Donelaitis“, d.h., suchte sich dem Profil des Pfarrerdichters durch Analyse von Phraseologie, Metrik, Folklore, Textsortenproblemen o.ä. zu nähern. In beiden Fällen musste sich das Fragen meist mit Vermutungen zufrieden geben, weil die Quellen das historische Interesse nicht „bedienten“ bzw. die Analyse nicht zu letzter Klarheit führte. Daneben kam ein dritter Aspekt immer wieder zur Sprache, der „rezipierte und interpretierte Donelaitis“, d.h., der Pfarrerdichter in einem Frage- und Deutungshorizont, den er selber nicht ausgesucht hatte. Vielmehr wurde dieser von außen (Leser, Forscher, Interpreten) gesetzt. Und Letztere ‚verstanden den Autor oft besser’, als dieser selbst es intendiert hatte oder hätte zum Ausdruck bringen können. Ob die Ausleger in ihrem Vorgehen je die Überlegungen Friedrich Schleiermachers zur Sache bedacht haben, sei dahingestellt.
Jede der drei Fragerichtungen hat ein begrenztes Recht und trägt wichtige Elemente zum Verständnis des behandelten Werkes bei. Allein, es wäre falsch, den „historischen Donelaitis“ gegen den „interpretierten Donelaitis“ bzw. den „philologischen“ auszuspielen (und umgekehrt). Auch sagt eine bloße Wiederholung von historischen Fakten nicht unbedingt etwas über deren Bedeutsamkeit aus. Andererseits läuft jede Rezeption Gefahr, einseitig oder subjektiv einzelne Aspekte eines Werkes zu verabsolutieren und als Schlüssel zum Ganzen auszugeben. Das hermeneutische Dilemma erweist sich aber als eine produktive Herausforderung in dem Maße, wie „Lektüre“ sich der Komplexität im Prozess von Lesen und Verstehen bewusst ist.
Es ist keine Frage, dass in dieser Studie die drei Forschungsakzente vorausgesetzt werden. Sie sollen aber, ohne fachspezifische Diskussionen, durch literaturwissenschaftliche Impulse, die unter dem Titel „Intertextualität“ durch Julia Kristeva, Gerard Genette u.a. bekannt gemacht worden sind, ergänzt werden. „Kein Text setzt am Punkt Null an“ (Karlheinz Stierle, Werk und Intertextualität, in: Das Gespräch, hrsg. von Karlheinz Stierle und Rainer Warnig, München 1984, 139-150; 139). Beabsichtigt oder unbeabsichtigt ruft jedes literarische Werk andere Werke ins Gedächtnis. Genette (Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris 1982; dt. Frankfurt/ Main 1993, 14f; 18ff) nennt den zu interpretierenden Text Hypertext, der sich stets auf einen oder mehrere Hypotext(e) bezieht. In expliziten oder impliziten Referenzen sind kulturelle Phänomene, Ereignisse, Autoren der Vergangenheit ebenso präsent wie ihre zeitgenössischen Analogien. Darum kann man das vorliegende Werk als Kreuzungspunkt unterschiedlicher Texte betrachten, bzw. als Hinweis auf eine „sich beständig wandelnde Konfiguration“ (Stierle, ibd.). Der Autor kommt dort ins Spiel, wo er bewusst oder unbewußt die Referenzen herstellt und eine Intention realisiert. In diesem referentiellen Verfahren wird sein Ziel epiphan, das sich keineswegs auf Applikation oder Fortführung einer Idee beschränkt, sondern meist Überbietung, Transformation im Blick hat, weil es um literarische Weltgestaltung in der sich wandelnden Geschichte geht. Der neue Text kann die Folge von Verbesserungen, Erweiterungen oder Umstellungen sein. „Die Konfiguration der Texte, der sich der Text verdankt, ist aber nicht identisch mit der Konfiguration, in die der Text für seinen Leser tritt“ (Stierle, ibd.). Daher ist nicht nur die produktionsästhetische Text-Autor-Dimension zu berücksichtigen. Nicht minder relevant ist die Rolle des Lesers/ Interpreten in diesem Vorgang (rezeptionsästhetische Dimension), insofern auf einer Meta-Ebene die Textur unter neuen Konditionen betrachtet wird. Lesen und Verstehen gehen hier die Beziehung einer dialektischen Interaktion ein. Der Leser/ Interpret nimmt im Geflecht der Textur z.B. semiotische, phänomenologische, pragmatische Spuren auf, klärt sie auf, macht sie transparent, verfolgt ihre Tragweite. Zugleich geschieht aber auch, „Reduktion“, „Ausgrenzung“, „Verortung“ oder, positiv ausgedrückt, „Steigerung der Aufmerksamkeit“ (Stierle, 145). Letztlich geht es aber doch um den „Kanon“, vor den das historische wie das interpretierte Werk seine jeweiligen Leser stellen will. Weil mit diesem Schritt erst recht die Denk-Arbeit beginnt, bleibt der „Prozess der Interpretation“ grundsätzlich offen. Selbst wenn, wie in dieser Studie, eine...