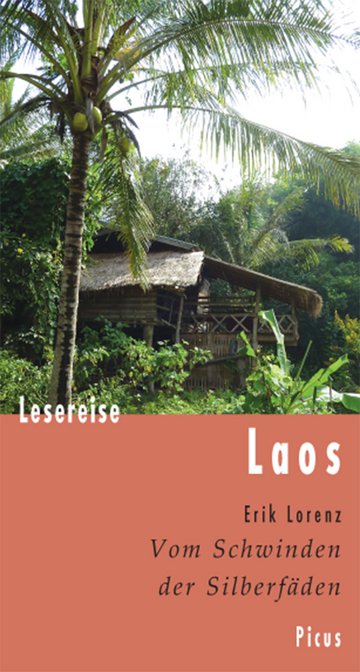Eine neue Perspektive
Anysay Keola möchte, dass Laoten laotische Filme lieben
Für gewöhnlich sind die Nächte in der Gegend um den Tempel Wat That Foun ruhig, trotz der Nähe zur Avenue Lane Xang, der Hauptverkehrsader Vientianes. Aber diese Nacht ist anders.
Das Motorengeheul kündigt sie an: einen schwarzen Ford Mustang und einen weißen Nissan. Sie rasen um Kurven und über rote Ampeln. Aluminiumfelgen funkeln in der Dunkelheit, quietschende Reifen drehen durch und wirbeln den Straßenstaub auf. Eine Polizeistreife macht dem nächtlichen Schrecken ein Ende. Die beiden Fahrer steigen aus den Sportwagen.
»Was soll der Lärm?«, schnauzt der Beamte und lässt seinen Blick von den Nike-Sneakers über die Jeans zu den Silberkettchen wandern. »Was treibt ihr hier mitten in der Nacht? Seid ihr wahnsinnig? Ich will …«
»Entschuldigen Sie«, unterbricht ihn ein weiterer junger Mann, der plötzlich aus dem Schatten an den Bordstein tritt. »Sehen Sie sich das an.«
Der Polizist ist überrumpelt. »Wo kommen Sie denn her?«, fragt er, greift dann aber ohne eine Antwort abzuwarten nach den hingehaltenen Papieren. Er runzelt die Brauen. Die Papiere bestätigen: Diese Kerle dürfen hier nach Mitternacht herumrasen. Sie drehen einen Film. Den ersten laotischen Thriller überhaupt. So wird der Film später beworben werden.
»Die Formulierung ›Erster laotischer Thriller‹ war eine Idee unseres Marketingteams«, lacht Anysay Keola, der mir von dem Ereignis erzählt. Er war es, der dem Polizisten die Drehgenehmigung unter die Nase hielt – und er ist der Regisseur des Filmes, an dem sie in jener Nacht arbeiteten: »At the Horizon«. Er ist nicht besonders stolz darauf, dass es der erste laotische Thriller ist. Hätten sie eine Komödie gemacht, wäre es die erste laotische Komödie gewesen. Hätten sie einen Horrorfilm gedreht, wäre es der erste laotische Horrorfilm gewesen. Mit allem wären sie die Ersten gewesen. Er zuckt mit den Schultern und streckt mir die leeren Handflächen entgegen. »Es gibt keine laotische Filmindustrie.«
Jedenfalls nicht mehr. Bis 1975, als die kommunistischen Pathet Lao die Demokratische Volksrepublik Laos ausriefen, gab es etliche Kinos im Land, die sowohl einheimische Kriegs- und Propagandafilme als auch internationale Streifen zeigten. Nach 1975 folgte eine neue Art der Propaganda, vor allem Wochenschauaufnahmen und Dokumentarfilme, produziert von der Regierung. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion trocknete die Filmförderung aus; es wurden auch keine Filme mehr importiert – das Kino in Laos starb. Heute werden in Laos jedes Jahr ein paar Melodramen und Seifenopern gedreht, finanziert von Nichtregierungsorganisationen und anderen Interessensgruppen, die ihre Botschaften vermitteln wollen. Auch die Regierung gibt regelmäßig einige seichte Schnulzen in Auftrag, die an ihrem geringen Budget und – das größere Handicap – einem Mangel an kreativer Leidenschaft kranken. Anysay drückt es diplomatisch aus: »Sie versuchen ihr Bestes. Wenn die Filme im Fernsehen laufen, schauen Leute zu. Aber sie wecken niemandes Aufmerksamkeit. Sie sind nicht spannend, berühren nicht emotional und animieren Laoten nicht dazu, gezielt und gern laotische Filme zu sehen.«
Anysay nennt all das die »alte Welle des laotischen Kinos« und stellt fest: »Das ist nicht die Art von Filmen, die ich gern sehe.«
Die Idee, einen laotischen Film zu drehen, der ihm selbst gefallen würde, entstand, während er zwei Jahre in Bangkok arbeitete. Er kündigte den Job und begann mit dem Masterstudium Film. Und er beschloss, dass es Zeit war für eine »neue Welle des laotischen Kinos« – in einem Land ohne Filmindustrie, ohne auch nur einen einzigen Schauspieler oder Drehbuchautor oder Regisseur, der eine professionelle Ausbildung genossen hätte, mit gerade mal zwei kleinen Kinos und strenger staatlicher Zensur. »Lao New Wave Cinema« – das ist heute der Name der von ihm mitbegründeten Filmproduktionsfirma.
Über das Thema musste er nicht lange nachdenken. Dies war sein erster Spielfilm, und er wollte sein eigenes Drehbuch verfassen. Um über etwas so ausführlich zu schreiben, muss man gut darüber Bescheid wissen. »Viele, die in die Filmbranche wollen, werden vom Glamour angezogen«, erzählt Anysay. »Sie sehen Stars auf roten Teppichen und Action und Spezialeffekte. Aber wenn man sich an seinen Schreibtisch setzt, dann muss man etwas zu sagen und eine Geschichte zu erzählen haben.«
Er hatte etwas zu sagen. Der Film würde in Vientiane spielen, wo er aufgewachsen war. Sozialer Status und die Unterschiede zwischen Arm und Reich würden sein Thema sein. Seine eigene Familie ist weder reich noch arm: Die Mutter arbeitet für die Regierung, der Vater für ein Bauunternehmen. Aber einige seiner Jugendfreunde entstammten bessergestellten Familien, andere schlechtergestellten. Er war von beiden Extremen umgeben, wobei das untere Extrem – »arm« – in Vientiane schon damals relativ war. Mit wirklicher Armut wurde er erst vor den Toren der Stadt konfrontiert. Auf den Straßen vor seinem Haus sah er teure Autos und gut gekleidete Menschen. Fuhren sie dann zehn Minuten aus der Stadt hinaus, fühlte er sich in eine andere Provinz versetzt. Alles war ländlich und sehr einfach. Da klaffte eine große Lücke. Deshalb zeigt er diese Unterschiede im Film.
Die Idee für die konkrete Handlung schlummerte seit Jahren in seinem Kopf. Immer wieder wälzte er in seinen Gedanken ein Ereignis hin und her, das sich um die Jahrtausendwende begeben hatte, als er etwa fünfzehn war. Er ging mit einigen Freunden in einen Nachtklub in Vientiane. »Das war für gewöhnlich nicht so eine ausgelassene Angelegenheit wie in anderen Teilen der Welt«, erinnert er sich. »Es ging weniger um Spaß als darum, dass reiche Leute und Möchtegern-Gangster angaben und Streit provozierten.« An besagtem Abend tönte ein junger Kerl, ein ebensolcher Möchtegern-Gangster: »Hey, kennt ihr mich nicht? Ich habe schon neun Leute umgelegt!«
Leere Worte eines Halbstarken? Nein – er sprach die Wahrheit. Er, Sprössling einer reichen Familie, hatte einige Zeit zuvor einen Autounfall verursacht, der neun Menschen das Leben gekostet hatte. Bestraft wurde er nicht. Die Opfer stammten aus der Unterschicht. Ihre Familien waren arm und ungebildet und kannten weder ihre Rechte, noch verfügten sie über die Mittel, diese gegen professionelle Anwälte durchzusetzen, wie die Familie des Schuldigen sie angestellt hätte. Als dessen Eltern eine stattliche Entschädigung boten, war es für die Hinterbliebenen die vernünftigste Entscheidung, das Geld zu nehmen und zu schweigen. Damit war die Sache erledigt.
»Der Junge kam nicht nur davon«, sagt Anysay, »er prahlte mit seiner Tat. Das fanden meine Freunde unerträglich. Sie haben ihn verprügelt. Aber seine Provokationen – Bam!« – er schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch – »die blieben in meinem Kopf hängen.«
Dieses Erlebnis bildet die Grundlage für eine Schlüsselszene in »At the Horizon«: Bei einem Discobesuch wird Sin, verzogener Sohn reicher Eltern, angerempelt. Eine Entschuldigung ist Sin nicht gut genug. Er spielt sich auf, fragt: »Weißt du nicht, wer ich bin?« Vor der Disco zückt er eine Pistole, ein Schuss geht los, ein Mann wird verletzt. Sin muss fliehen, die Verfolgungsjagd durchs nächtliche Vientiane beginnt. An einer Kreuzung kommt es zur Katastrophe: Sin überfährt eine Mutter und ihre Tochter.
Dem verzweifelten Vater, einem armen Mechaniker, bieten Sins Eltern eine ansehnliche Summe, aber dass der reiche Bengel ungeschoren davonkommt, erträgt der Vater nicht. Er entführt Sin, hält ihn in einer Kammer gefangen und will ihn umbringen. Dazu kommt es nicht: Sin übersteht die Tortur, wenn auch geläutert.
Der staatlichen Zensur ging dies nicht weit genug. Ein Ende musste her, das zeigt, dass das laotische Rechtssystem funktioniert. Sin sollte im Gefängnis landen. Anysay fügte sich, drehte die Szene aber nicht in gleicher Qualität nach, sondern ließ dem Finale einen kurzen Text und ein Foto von Sin im Gefängnis folgen. Indem es wie ein Fremdkörper wirkt, sollte das neue Ende jedem Zuschauer klarmachen, dass es nicht das wahre Ende sei.
»Die Klassenunterschiede sind da, und sie sind relevant«, sagt Anysay. »Auch im Rechtssystem. Deshalb ist das ursprüngliche Ende das wahrhaftige.« Dass der Vater die Entschädigung nicht will, sondern nach dem trachtet, was er für Gerechtigkeit hält, ohne sie zu bekommen, ist ein Anstoß für das Publikum, zu hinterfragen, wie arme Leute behandelt werden. »Viele Laoten sind noch immer lieber still, als ihre Stimme zu erheben. Was verständlich ist. Wir können uns hier nicht frei äußern.«
Anysay ist Realist: Für kritische Szenen drehte er von vornherein zwei...