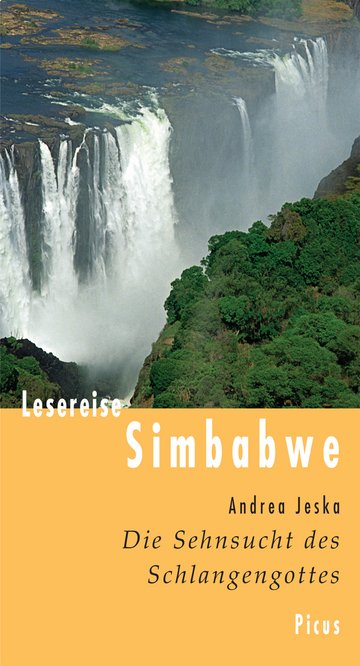Spendier dem Dickhäuter doch ’nen Drink
Unterwegs zu den Elefanten im Hwange Park
we laugh into our armpits
so we are not heard,
walking like the winds –
breathing like stones
to stay unseen.
NOVIOLET BULAWAYO
Hinter den Baumstämmen ist gut sitzen. Wenige Meter davor rupft ein Büffel Gras. Nach jeder dritten Kaubewegung hebt er den Kopf und sein Blick ist nicht freundlich. Ohne den Baumstamm wäre man verloren. Doch auch mit dem Stamm entsteht kein Wohlgefühl. Gerne würde man wissen, warum das Tier sich von einem Stück Holz davon abbringen lässt, zu attackieren. Gary könnte es wissen. Doch Gary ist ein brummiger Schweiger und legt gleich beim ersten Flüsterton seine Finger auf die Lippen. »Shhh, verdammt.« Dann nickt er Richtung Wasserloch. Gerade verschwindet am Horizont das letzte Stück Sonne und lässt am Himmel einen rötlichen Rand zurück wie den letzten Anstandshappen auf dem Teller. Aus der Tiefe des Universums kommt die afrikanische Dunkelheit gekrochen. Garys Nicken ist gegen eine Kameldornakazie gerichtet. Es knackt. Es kracht. Die dicken Akazienäste knicken wie Streichhölzer. Dann kommt ein gewaltiger Elefantenbulle hervor, tritt ans Wasserloch, äugt kurz zu den Menschen rüber, schlabbert mit seinem Rüssel, spritzt sich Wasser über die Haut, schlabbert weiter. Nach und nach treten andere Tiere an das Wasserloch: eine Elefantenfamilie, Büffel, Impalas. »Prost Kumpels«, flüstert Gary. »Diese Drinks hat euch heute ein Amerikaner spendiert.«
Gary ist einer der »Freunde von Hwange«, kurz FOH. So heißt eine Organisation, die sich im Hwange Nationalpark, kurz HNP, um den Trinkbedarf der Tiere kümmert. Denn der HNP, mit vierzehneinhalbtausend Quadratkilometern etwa so groß wie die Schweiz, ist der größte Nationalpark Simbabwes und sehr trocken. Nur wenige Wasseradern verlaufen unter der Oberfläche und nicht ein einziger Fluss fließt hindurch, der das ganze Jahr Wasser trägt. Also trocknen die Wasserlöcher aus, die Tiere dürsten. Hundertfünfzig Liter am Tag trinkt der durchschnittliche Afrikanische Elefant, dafür ist er bereit, lange Strecken zu wandern. »Kein Problem für die Bullen, die gesunden Kühe«, sagt Gary. »Aber für die Jungen.« Die nämlich werden mit jedem Tag schwächer und bleiben irgendwann einfach liegen. Eine Weile versuchen die Kühe dann noch, sie wieder auf die Beine zu schubsen, doch irgendwann, wenn die Herde schon zu weit entfernt ist, kommt für so eine Elefantenmutter der Moment der Entscheidung. Aufholen und das Junge zurücklassen. Oder auch zurückbleiben, auch sterben. Davon, wie herzzerreißend es ist, diesen Moment der Entscheidung zu erleben, kann Gary einige Geschichten erzählen. Das Wort »herzzerreißend« würde er allerdings nicht in den Mund nehmen.
Gary Cantle ist der Pumpenmann, der Wasserbringer, der Elefantenflüsterer. Typ Steppenwolf, so wie es ihn nur noch in den Weiten Alaskas oder im tiefen Busch gibt. Männer wie er reden drei Sätze am Tag. Für Hwanges Elefanten ist Gary ein Glücksfall. Wenn er kommt, dann heißt das: Wasser fließt. Jeden Morgen, kaum erhebt sich die Sonne, startet er mit seinem klapprigen Toyota Pick-up seine wöchentliche Pumpen-Checktour. In der Morgendämmerung stehen Elefanten mitten auf den Wegen, Giraffen staksen durch die Savanne, scheue Impalas drängen sich unter Blätterdächern zusammen. Auf dem Dach und im Kofferraum des Pick-ups stapeln sich Benzinkanister, Werkzeugkisten und eine Tasche mit Colaflaschen. »Mein Wasserloch«, sagt Gary, schnipst mit dem Feuerzeug den Deckel von der ersten Flasche des Tages und schiebt dem Colaschluck eine Madison hinterher.
Gary kennt den Hwange Park wie die sprichwörtliche Westentasche. »Ich bin hier geboren. Mein Vater war einer der ersten Wildhüter am Main Camp. Der ganze Park war mein Spielplatz.« Gary sieht Wege, wo keine sind, nur jahrhundertealte Elefanten-Migrationspfade zwischen Simbabwe und Botswana. Schmal sind diese, gesäumt von Dornakazien. Durch diese zwängt er seinen Pick-up durch, peitscht den Motor, weicht ausgerissenen Stämmen aus. Der weiche Kalahari-Sand lässt die Reifen durchdrehen, die Benzinfässer hinten auf der Ladefläche schaukeln gefährlich im Takt der Unebenheiten. Der Pick-up sieht aus, als hätte er bereits viele Begegnungen mit Elefanten und Bäumen gehabt. »Wenn ich mich an die Wege hielte«, knurrt Gary, »würden die Tiere hier alle verdursten.«
Dass Hwanges Elefanten nicht schon vor Jahrzehnten verdurstet sind, verdanken sie Ted Davison. Der war der erste Aufseher des Wildreservats und ein leidenschaftlicher Wanderer. Als er erkannte, dass nach langen Jahren der Wilderei und auch der legalen Lizenz zum Töten nur noch ungefähr tausend Tiere im Park lebten, hatte er die Idee, die Population zu vergrößern, indem er Wasser zur Verfügung stellte. Er ließ bohren und sechzig künstliche Wasserlöcher anlegen. Das war in den dreißiger Jahren, und das Lob, das so einer Idee gezollt werden sollte, fällt eher kleinlaut aus, wenn man die sozialen Verhältnisse betrachtet, unter denen die Einheimischen damals im kolonialen Rhodesien lebten. Wasser für die Elefanten klingt eben nicht gut, wenn es kein Essen für die Kinder gibt.
Der Hwange Park wurde 1928 von der damaligen britischen Kolonialregierung zum Tierschutzgebiet erklärt. In dem Gebiet zwischen den Ausläufern der Kalahari an der Grenze zu Botswana und der Savanne im Nordosten lebten fast keine Tiere mehr. Rund tausend Elefanten waren noch übrig, das weiße und das schwarze Nashorn galten als ausgerottet. Ausnahmsweise war das nicht die alleinige Schuld der bleichen Briten und ihrer Großwildjägermanier. Schon Mzilikazi, König von Matabele, der das Regieren und das Töten unter dem berüchtigten Zulukönig Shaka gelernt hatte, nutzte das Gebiet des heutigen Parks als privates Jagdrevier. Mzilikazi dürfte nicht gerade zimperlich bei der Jagd gewesen sein. Als er sich mit Shaka entzweite, floh und sich 1840 im Matabeleland, heute eine Provinz von Simbabwe, niederließ, tötete er die dort lebenden männlichen Bewohner und verschleppte ihre Frauen und ihr Vieh – das scheint damals ein und dasselbe gewesen zu sein. Seinen Namen hat der Park deshalb lieber von einem friedlicheren Menschen. Chief Wange war Häuptling der Nhanzera, in Europa eher als San oder Buschmänner bekannt. Lange vor Mzilikazi und den Weißen waren die Nhanzera aus der Kalahari gekommen und in die Savannengebiete des heutigen Simbabwe gezogen.
Der Fall des Matabele-Königreichs Ende des 19. Jahrhunderts war lange nicht die Rettung für die Tiere. Noch mehr als ein Jahrzehnt lang wurden sie ohne Beschränkungen gejagt, von skrupellosen Großwildjägern, die es auf Elfenbein und Rhinozeroshorn abgesehen hatten ebenso wie von britischen Hobbyjägern, die gegen die Errichtung einer lächerlich geringen Gebühr die Lizenz zum Töten erhielten. Erst als die Regierung das Land unter weißen Farmern aufteilte, kehrte Ruhe ein.
Die Wasserloch-Bohrerei von Davison hatte gravierende Nachteile: Die Tiere gewöhnten sich an die neuen Wasserlöcher und änderten dafür ihr Migrationsverhalten. Jahrhundertelang waren sie im Ländereck von Namibia, Botswana, Sambia und Simbabwe umhergewandert, hatten drohende Dürren erspürt und sich auf den Weg gemacht zu feuchteren Gefilden, zu nasseren Wasserlöchern. Nun wurden sie sesshafter. Die Migrationspfade wuchsen zu. Die Elefanten warteten auf den Wasserservice. Auf Gary.
Dramatisch wurde diese Abhängigkeit in den Neunzigern, als Korruption ein Gentlemandelikt für Politiker wurde und die für den Schutz des Wildbestands gedachten Gelder auf unbekannten Konten landeten. Schließlich wurden die Wildhüter nicht mehr bezahlt und hatten auch kein Geld mehr für Benzin. Kontrollfahrten unterblieben. Aus Hunger begannen die Leute in den Parks das Wild zu jagen, und auch die professionelle Wilderei nahm wieder zu. »Diese Bastarde«, sagt Gary. »Ist ja das Eine, wenn einer nichts im Bauch hat. Aber die Typen, die haben einfach alles abgeknallt.«
Ohne Geld konnten die Pumpen nicht mehr betrieben werden. »Keine Gäste, kein Diesel, kein Wasser«, sagt Gary. »So wurden selbst die Elefanten nicht von der Politik verschont.« Als in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Regen fast vollständig ausblieb, kam es zur Katastrophe. Über tausend Elefanten und viele Tausend andere Tiere starben. »Elendig verdurstet. Ganz Hwange war übersät mit Kadavern.«
Als Garys Wagen an diesem Tag gegen Mittag durch das Buschland auf eine freie Ebene bricht, herrscht dort der Ausnahmezustand. Am Bohrloch Manga I haben sich rund hundert Elefanten versammelt und warten in mehreren Gruppen darauf, einen Platz an der Wasserstelle zu ergattern. Gegenüber, auf einem Hügel, stehen im Schatten einiger Mopane-Bäume weitere Elefantengruppen. Zebras sind da, ein paar Dutzend Impalas, einige Springböcke. Die Stimmung ist gereizt. Elefantenbullen rempeln sich gegenseitig an, Elefantenkühe gehen auf Impalas los, die sich zu nahe heranwagen. Nur zwei Giraffen stehen scheinbar unbeteiligt in der Menge und starren auf einen jenseitigen Punkt. Beim Näherkommen erklärt sich die aggressive Laune der Elefanten: Aus dem Pool ist jeder Wassertropfen gesogen, nur Schlamm ist übrig. »Heilige Scheiße. Was ist denn mit der Pumpe los?«
Die Pumpe schweigt. Gary knurrt und flucht. Er füllt Diesel nach, überprüft alle Schläuche und Schrauben. Doch das Ding will nicht wieder anspringen. Ein paar Bullen sind inzwischen näher gekommen und schlackern mit den Ohren. Eine Drohgeste. »Was wollt ihr, Jungs«, sagt Gary. »Gebt doch nicht so an.« Beim Klang seiner Stimme beruhigen sich die Elefanten und trotten...