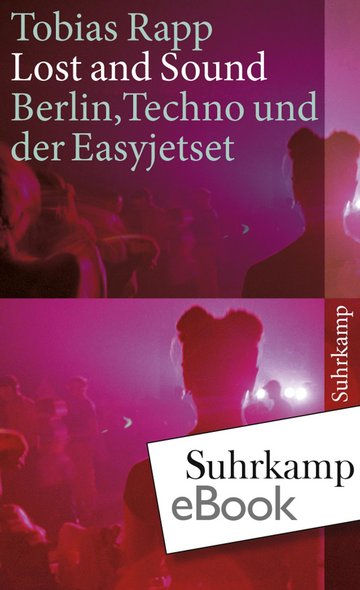Vorwort: Berlin, Techno
Ein neues Berlin entsteht, und keiner kriegt es mit. Fast keiner natürlich, irgendjemand muss es ja bauen.
Doch angesichts der Größe des Phänomens und des Rufes wie Donnerhall, der sich überall auf der Welt verbreitet hat, war es doch einigermaßen verwunderlich, wie oft ich bei der Arbeit an diesem Buch von Leuten, die nicht direkt mit elektronischer Musik zu tun haben, erstaunt angeblickt wurde, wenn ich umriss, worum es gehen soll: Techno? Wirklich? Das gibt es noch?
Zur Erinnerung: Berlin war die Stadt, die diese Musik mit prägte. Ob es Westbam war, der schon Mitte der Achtziger anfing, Vorformen von dem aufzulegen, was bald Techno werden sollte. Ob es, nach dem Fall der Mauer, all die illegalen Läden waren oder der legendäre Tresor, in dem Tanith Platten spielte und die Detroiter Techno-Erfinder ihre europäische Anlaufstelle hatten. Die Sache wurde rasch größer, das E-Werk hatte schon einen populistischeren Sound, die Love Parade verwandelte sich innerhalb weniger Jahre vom Insiderscherz zur Millionenveranstaltung und wurde live im Fernsehen übertragen. Währenddessen machten sich Feuilletonisten und Kulturwissenschaftler euphorische Gedanken um neue Geschlechtermodelle und die Ablösung des Rockstars durch den DJ. Als der Schriftsteller Rainald Goetz die Love Parade bejubelte, sorgte das noch für Streit, als Gotthilf Fischer dort auftrat, hatten die Zeitdiagnostiker das Interesse schon lange verloren. Techno, so konnte es einem vorkommen, hatte sich von einer Subkultur in eine Selbstparodie verwandelt. Und im avancierten Pop erlebte der rüpelhafte und charismatische Rockstar sein Comeback. Die Gitarren wurden wieder ausgepackt. Techno war eine Jugendkultur der Neunziger, historisiert und offiziell tot.
Was diese groben Linien der Geschichtsschreibung verbergen: House, Techno, Electro, Minimal - wie auch immer man es nennen möchte - gibt es immer noch, und in Berlin ist diese Musik und die dazugehörige Szene größer, vielfältiger und interessanter als je zuvor. Noch nie hatten die Clubs der Stadt eine solche Anziehungskraft wie das Berghain, das Watergate, das Weekend, die Bar 25 und andere gerade jetzt. Tausende sind es, die Wochenende für Wochenende aus ganz Europa und von weiter her zum Feiern kommen. In ihrer Selbstwahrnehmung tut sich die Stadt allerdings schwer mit dem Phänomen. Und manchmal, wenn man etwa in einer Schlange vor einem Club steht und das babylonische Sprachgewirr der Umstehenden in den Ohren hat, denkt man ohnehin, dass diese Goldene Zeit nicht das Ergebnis lokaler, sondern internationaler Dynamiken ist, die zwar in Berlin kulminieren, aber wesentlich befeuert werden von Menschen, die aus dem Rest der Welt, vor allem den USA, aber auch aus Nord- und Südeuropa hierhergekommen sind. Sei es für ein paar Monate, sei es für länger. Oder eben nur für ein Wochenende. Nirgendwo außerhalb des Diplomatischen Corps dürfte Berlin so international sein wie in der Techno- und Clubszene. Im Grunde ist das natürlich Arbeitsmigration und nicht anders als das, was die Finanzindustrie für New York oder London ist, Hollywood für Los Angeles und Mode für Paris oder Mailand.
So gesehen fällt es dann auch gar nicht so sehr ins Gewicht, dass die Berliner Radiosender diese größte und wichtigste musikalische Kultur, die Berlin in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren hervorgebracht hat, fast völlig ignorieren und ihr nur ein paar kleine Nischensendungen zugestehen. Es gibt ja genügend Sender im Internet. Im Herbst 2008 kam Berlin Calling von Hannes Stöhr in die Kinos - nach fast zwanzig Jahren der erste ernstzunehmende Spielfilm über Berlin und Techno.
Diese Wahrnehmungslücke steht in scharfem Kontrast zu den Illusionen, die viele Zugezogene haben. Wie oft ist schon behauptet worden, die Atmosphäre im Berlin der nuller Jahre erinnere an die frühen Achtziger in Manhattan! Das ist zwar nicht völlig aus der Luft gegriffen - damals wie heute war es der künstlerische Nährboden einer wirtschaftlich und finanziell maladen Stadt, dessen Anziehungskraft in die Welt hinausstrahlte und jede Menge Kunstschaffender anlockte, denen der Sinn nicht primär nach Weltkarriere stand, sondern danach, in geschützter Umgebung zu experimentieren und sich auszuleben. Damit enden die Parallelen aber auch schon, denn das Entscheidende im damaligen New York war der Kontakt afroamerikanischer Jugendlicher aus der Bronx und Harlem mit weißen Downtown-Künstlern. HipHop setzte von dort aus zum großen Sprung an und wurde zur weltweit erfolgreichsten Popkultur des vergangenen Vierteljahrhunderts. Und auch der größte Popstar dieser Zeit ging aus der Downtown-Szene hervor: Madonna.
In Berlin ist eine neue Madonna nicht in Sicht, der einzige weltweite Star, den die Berliner Szene hervorgebracht hat, ist die Kanadierin Peaches, und die ist ursprünglich ein Phänomen der Neunziger, von Berlin-Mitte 1.0, wenn man so will, einer Zeit, als andere Konstellationen wirkten als heute.
Nein, dieses Berlin der nuller Jahre unterscheidet sich in vielen Punkten vom New York der Achtziger. Und der größte Unterschied besteht vermutlich darin, dass die Stars dieser Stadt keine Einzelpersonen sind, sondern kollektive Subjekte: die Berliner Clubs und ihr Publikum. Weltberühmt sind sie, einzigartig, Projektionsoberflächen, voller Bedeutung. Von weither reist man an, man steht Schlange, um sie zu sehen, um sie zu feiern und damit sich selbst.
Was ja auch wieder seine Tradition hat: Berlin ist seit den Sechzigern eine Stadt, in der vor allem das soziale Experiment funktioniert. Das wird oft übersehen, abgestritten oder als eine Schwäche gedeutet, die es auszugleichen gelte, um auch in Berlin die Normalität anderer Städte einzuführen. Was auch immer man sich darunter vorzustellen hat. Dabei ist die relative Anonymität und Gesichtslosigkeit der Berliner Technoszene - denn tatsächlich sind ja selbst die Lästereien darüber, dass diesem oder jenem der Ruhm zu Kopf gestiegen sei, im Grunde ein Beleg dafür, dass die Bodenständigkeit sich behauptet - eine große Errungenschaft, die man gar nicht genug betonen kann. In Zeiten, wo ein Großteil der Geschichten, die eine Kultur von sich erzählt, von prominenten Personen handelt, wo ein heiß drehender Celebrity-Kult die gesamte Gesellschaft beherrscht, ist es gut zu wissen, dass zumindest ein kulturelles Segment übrig geblieben ist, in dem man das Promi-Sein für das hält, was es ist: Zeitverschwendung.
Keine Stars also. Und auch keine Werbepartner. Jeder, der in den Neunzigern ausgegangen ist, wird sich erinnern, wie omnipräsent Zigarettenfirmen und Mobiltelefonanbieter damals in den Clubs waren. Auch das ist vorbei. Bis auf den Getränkekonzern Red Bull haben sich die sichtbaren Sponsoren aus der Technoszene zurückgezogen.
Mit ein wenig Willen zur Idealisierung könnte man sagen: Die House- und Technoszene von Berlin hat die guten Seiten einer Independent-Kultur - ökonomische Unabhängigkeit, künstlerische Integrität, Kompromisslosigkeit - bewahrt und die schlechten, also verkürzte Kapitalismuskritik, Idealisierung der Selbstausbeutung und Unprofessionalität einfach weggelassen. Unabhängig sein, ohne Indie zu sein. Der popkulturelle Idealzustand und das genaue Gegenteil jener Rock- und Popmusik, die heute Indie genannt wird und sich zwar meist so anhört, aber nur selten unabhängig ist.
Tatsächlich ist eine andere Parallele zu den amerikanischen Städten der Achtzigerjahre im Fall der Berliner Technoszene durchaus sinnvoll. Nach dem großen Plattenindustrie-Crash von 1979 zog sich Disco dort in den Underground der Clubs zurück, und bildete neue Formen aus. Der Rhythmus wurde maschinisiert, neue Stile und Sounds wurden integriert - eine Entwicklung, die ein paar Jahre später zu House führte, einer Musik, die deutlich in der Tradition von Disco steht und doch etwas ganz Neues war. So ähnlich ist das mit Techno und Berlin in den nuller Jahren. In den Neunzigern gab es Rave mit allem was dazugehört: großer Aufregung, tollen Platten, Weltherrschaftsfantasien, Chartsplatzierungen - bis das Ganze nach großen Erfolgen und Exzessen zum Ende des Jahrzehnts zusammenkrachte. Um die Jahrtausendwende zog sich die Musik in den Underground zurück, um sich zu erneuern.
Was danach kam, davon handelt dieses Buch. Es wird um besondere Berliner Konstellationen gehen, die vieles ermöglichen, was woanders undenkbar wäre, um Brachflächen, Leerstand und immer noch billige Mieten, um liberale Behörden, unermüdliche Aktivisten und Institutionen, die einfach immer weitermachen, um Stadtpolitik und die Liberalisierung des europäischen Flugmarkts, die all dies innerhalb kurzer Zeit zu ungeahnter Größe anwachsen lässt. Es wird um Musiktechnologie und die prekäre Ökonomie eines Plattenlabels gehen. Und darum, wie die Protagonisten - DJs, Produzenten, Clubbetreiber, Tänzer - ihre Szene erleben, ob in einer euphorischen Samstagnacht oder während einer Afterhour am Montagabend.
Lost and Sound erzählt dabei auch eine zweite, eher persönliche Geschichte. Ich bin im Sommer 1990 nach Berlin gezogen und seitdem immer viel ausgegangen. Es gab Pausen. Ein paar Jahre lang interessierte mich das Nachtleben nur ganz am Rande. Trotzdem könnte ich einen großen Teil meines Lebens entlang der Läden erzählen, in denen ich meine Nächte verbracht habe. Viele Freundschaften sind mit diesen Nächten verbunden, einige haben es auch ans Tageslicht geschafft.
So wird es vielen Leuten gehen, die seit den frühen Neunzigern in Berlin ausgegangen sind. Jeder und jede hat den Ort, der für ihn oder sie am stärksten mit Wirklichkeit aufgeladen ist. Der Ort, der...