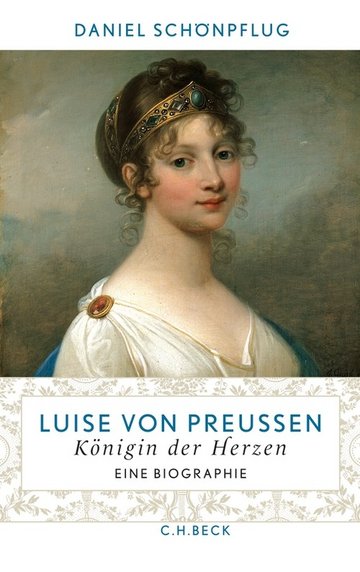I.
Zu schön, um wahr zu sein?
Der Sommer des Jahres 1810 hatte seinen Höhepunkt erreicht. Trockene Hitze brütete über reifen Feldern. Die Kolonne aus Reitern und Kutschen, die sich unter der Julisonne langsam auf der Allee vom mecklenburgischen Hohenzieritz in Richtung Berlin fortbewegte, war von einer Staubwolke eingehüllt. Feiner Sand legte sich auf die Uniformen, klebte auf den Flanken der verschwitzten Pferde und machte das Atmen schwer.
An der Spitze des Zuges ritten der Königliche Oberstallmeister von Jagow und der Schlosshauptmann von Buch, gefolgt von einer Abteilung Kavallerie sowie dem Hofstaat und den Ministern des Herzogtums Mecklenburg-Strelitz. Die Hauptperson des Zuges reiste in einer gepolsterten und gefederten Kutsche. Von den Anstrengungen der Reise spürte sie nichts mehr. Königin Luise von Preußen war wenige Tage zuvor im mecklenburgischen Hohenzieritz verstorben. Vor der von zwei Stallmeistern flankierten und von acht schwarz geschmückten Pferden gezogenen Trauerkutsche mit dem Sarg ritt Luises Halbbruder Karl. Direkt dahinter fuhr Luises Oberhofmeisterin, Gräfin Sophie von Voß, welche die Königin ihr gesamtes Erwachsenenleben begleitet hatte. Der Zug wurde von Luises Kammerfrauen und einer weiteren Kavallerieeinheit beschlossen.
Glocken läuteten in den Städten und Dörfern entlang der Route. Vor ihren Häusern und Hütten erwarteten Bauern den Zug. Männer, Frauen und Kinder in einfacher Trauerkleidung begleiteten, geführt von ihren Pfarrern oder Dorfschulzen, die schwarze Kolonne bis zur Gemeindegrenze des nächsten Ortes. Zu Mittag wurde bei Dannenwalde die brandenburgische Grenze erreicht. Dort erwartete eine 120 Mann starke Abteilung der königlich-preußischen Leibgarde die verblichene Königin und löste das mecklenburgische Geleit ab. In Gransee, wo die Nacht verbracht wurde, war auf dem Marktplatz ein Pavillon für den Sarg errichtet worden. Die Bürgerschaft hatte, mit den bescheidenen Mitteln einer Kleinstadt, in aller Eile eine Einholungszeremonie auf die Beine gestellt: Die Honoratioren – Magistrat und Geistlichkeit – gingen der Leiche bis zur Stadtgrenze entgegen. Dort sang ein Chor für die verstorbene Königin. Die Straßen waren zum Schmuck mit weißem Sand, Blütenblättern und frischem Laub bestreut. Junge Männer bildeten, mit Stäben bewaffnet, eine Ehrenwache am Trauerpavillon; ältere Bürger standen Spalier für die einrollenden Wagen. Sogar eine provisorische Feuerwehr wurde gebildet, weil angesichts der Hitze mit Bränden zu rechnen war. Bis heute erinnert ein von Karl Friedrich Schinkel entworfenes und im Oktober 1811 eingeweihtes Denkmal auf dem Granseer Marktplatz an diesen großen Tag in der Geschichte des Örtchens.
In Oranienburg, nördlich vor den Toren Berlins gelegen, nächtigten die Reisenden ein zweites Mal. Vor der erneuten Abreise wurden der Staub von den Kutschen geputzt, frische Uniformen angelegt und die Pferde gestriegelt. Im Flecken Reinickendorf hoben vierundzwanzig Kammerdiener in einer eigens dafür errichteten Laube den Sarg von der Reisekutsche auf einen Parade-Leichenwagen um.
Die Festlichkeiten des Trauermarsches gipfelten schließlich im monumentalen Einzug in Berlin. Der Zug bewegte sich in gemessenem Schritt durch das Brandenburger Tor. Auf dessen Dach, wo zuvor die von Napoleon nach Paris entführte Quadriga stand, wehte jetzt eine schwarze Fahne. Ein beim Tor platzierter Chor stimmte das Lied «Wie fleucht dahin der Menschen Zeit» an. Langsam bewegte sich der Zug bei Glockenklang und gedämpfter Marschmusik die Allee Unter den Linden hinab. Dicht gedrängt standen die Menschen am Straßenrand, und die Fenster der Häuser entlang der Einzugsroute waren dicht besetzt. Die Bewohner dieser sonst so lauten Stadt waren sprachlos: «Der Zulauf der Menschen war unglaublich», schrieb Wilhelm von Humboldt an seine Frau Caroline, «aber eine Stille, die man sich kaum vorstellt, man hörte nicht einmal das sonst bei großen Haufen fast unvermeidliche dumpfe Gemurmel.»[1]
Denkmal von Karl Friedrich Schinkel zum Andenken an den Tod der Königin Luise, errichtet 1811 im brandenburgischen Gransee.
Bei der Einfahrt ins Berliner Schloss erklang das Lied «Jesus, meine Zuversicht». 24 Kammerherren hoben den Sarg von der Kutsche und trugen ihn durch die Pforte. Der königliche Witwer, Friedrich Wilhelm III., und die sieben Prinzen und Prinzessinnen kamen ihnen auf der Schlosstreppe entgegen. Die Familie geleitete die verblichene Mutter ins Thronzimmer.[2] Dort wurde der Sarg abgestellt, direkt «unter dem Bild eines ernsten, bärtigen, geflügelten Alten, der mit der linken Hand eine goldene Sense» schwang.[3] Für die Nacht wurde eine Ehrenwache aus Kammerfrauen und -herren sowie zwei Majoren und zwölf Unteroffizieren gebildet.
Am nächsten Morgen begann die dreitägige Ausstellung des Sarges, die Tausende von Berlinern besuchten. Kavallerie, Polizei und Bürgergarde hatten Mühe, die anströmenden Untertanen im Zaum zu halten. Es kam zu wütenden Beschwerden und Rangeleien. Mit dem Gottesdienst am 30. Juli 1810 im Berliner Dom und der Beisetzung in der Hohenzollerngruft waren die Feierlichkeiten noch längst nicht abgeschlossen. Festakte im ganzen Königreich Preußen, in Schlössern, in Kirchen und Synagogen, Zunftstuben, Gutshäusern, Universitäten, Vereinen und Verwaltungen folgten.
Königin Luise beendete ihr Leben, wie sie es gelebt hatte: mit einem fulminanten öffentlichen Auftritt. Noch nach ihrem Tod war sie Hauptdarstellerin in einem mehrtägigen, minutiös geplanten und mit Hilfe des Hofes und tausender Statisten in Szene gesetzten Festakt, der die Macht und die Pracht des Königshauses, den Rang des engsten Kreises seiner Würdenträger, aber auch seine Beziehungen zu den Untertanen zum Ausdruck brachte. Schon zu Lebzeiten, als Kronprinzessin und Königin, hatte sie eine Hauptrolle in jenem gleichzeitig jahrhundertealten und täglich neu inszenierten Stück namens Monarchie gespielt. Vom Morgen bis tief in die Nacht, vom Frühjahr bis in den Winter vollzog sich dieses Theater der Macht, das seine Darsteller oft bis zur Erschöpfung beanspruchte. Luises Jahre verstrichen im Rhythmus jenes gewaltigen Uhrwerks, dessen tieferer Sinn es war, den Status der ersten Familie des Reiches unentwegt sichtbar und erfahrbar zu machen.
Das Geheimnis von Luises Erfolg war die Energie, Hingabe und Brillanz, mit der sie ihre Rolle spielte. Denn wie alle großen Darsteller begnügte sie sich nicht damit, ihren Text getreulich wiederzugeben und die Gesten zu vollziehen, welche die über Jahrhunderte gewachsenen Regieanweisungen ihr nahe legten. Vielmehr interpretierte sie die Königinnenrolle, erfand sogar neue Szenen, Dialoge und Bilder. Wie einer begabten Künstlerin gelang es ihr, den Nerv ihrer Zeit, den Geschmack des Publikums zu treffen. Die Trauer der Preußen um ihre «Königin der Herzen»,[4] wie sie der Dichter August Wilhelm Schlegel genannt hatte, war wie der Applaus eines tief bewegten Publikums nach dem letzten Vorhang.
Luises Tod löste vor allem in Berlin und den preußischen Provinzen, aber auch andernorts in Deutschland ein vielstimmiges Echo aus. Bei ihrem Ableben ließen die Untertanen nochmals die Stationen von Königin Luises Leben Revue passieren. In zahlreichen Festakten, Ansprachen, Predigten und Drucksachen – und gewiss auch in Gesprächen zwischen Einzelnen – rief man die zur Erinnerung geronnenen Momente ihres Lebens zurück. Jene Bilder beschäftigten erneut das kollektive Bewusstsein, die schon zu Lebzeiten untrennbar mit Luises Namen verbunden waren und sich gleichsam zu einem Bilderbogen zusammenfügten. Sie erzählten, gebündelt im Brennspiegel einer Person, eine Geschichte über Preußen. In dieser Geschichte war das Land kein absolutistischer Militärstaat, geschaffen durch Drill und Gehorsam, Exerzieren und Paraden, sondern eine lebendige Gemeinschaft von Individuen, die durch ein inniges Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden waren. Während Friedrich II., die wirkungsmächtigste Personifikation Preußens, für Sieg und Größe, aber auch für kalte Vernunft und Härte stand, verkörperte Luise Wärme und Gefühl. Nicht nur ein Mars, sondern auch eine Venus mit dem Antlitz einer anmutigen jungen Frau konnte Preußens Schutzgottheit sein.
Im Reigen der Luisenbilder standen zuerst die Reminiszenzen an eine goldige und freche kindliche Prinzessin, die in der deutschen Provinz fern der großen Höfe aufwuchs. Es folgten die Erinnerungen an das Jahr 1793, als Luise – halb Backfisch, halb erblühende junge Frau – in Berlin ihren Einzug hielt. Danach blieb die junge Kronprinzessin im Gedächtnis haften, die mit ihren blauen Augen und den wehenden blonden Locken ausgelassen durch die Berliner Ballnächte tanzte. Mit ihrer Frische schien sie den Anfang einer neuen Zeit vorwegzunehmen. In einer Ära fundamentaler Umbrüche, jenem Zeitalter der Revolutionen, dem sich Preußen so lange Zeit zu entziehen suchte, doch in dessen Strudel das Land schließlich doch geriet, schien Luise für frischen Wind, für einen Kompromiss zwischen Altem und Neuem, für eine behutsame Veränderung der...