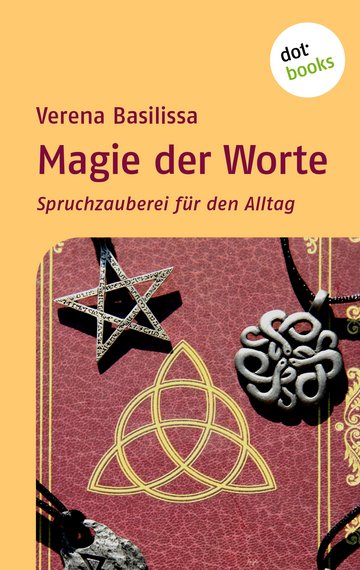Kapitel 1: Was magische Zauberworte bewirken
Magie gab es zu allen Zeiten und bei allen Völkern, sie war und ist wichtiger Bestandteil in vielen Naturreligionen. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte gehört sie zu den geheimnisvollsten Mysterien. Mit dem Begriff Magie bezeichnet man heute noch unerforschte und deshalb manchmal als unheimlich empfundene Naturkräfte – und natürlich die Kunst, diese Kräfte zu beherrschen. Eng damit verbunden sind Rituale, und mit diesen wiederum Zaubersprüche und Zauberformeln. Vor allem Letzteres hat die Menschen wohl von jeher fasziniert. Sie gehören schon immer zu dem, was wir als „Magie“ bezeichnen – der Fähigkeit also, mit Hilfe verschiedener Energien bestimmte Situationen zu beeinflussen.
Selbst wenn uns Harry Potter etwas anderes zeigt (und sowohl die Bücher wie die Filme an- und aufregend sind!): Magie und Zauberei sind nicht das, was uns dort und in vielen anderen Werken der Literatur und der Filmleinwand vorgegaukelt wird: Keine Hexe kann allein durch die Kraft ihrer Gedanken auf dem Besen durch die Lüfte reiten oder eine andere Person dazu bewegen, genau so zu handeln, wie sie das gerade möchte. Da nützen selbst die besten Zaubersprüche nichts. Dennoch sollten wir eines erkennen und akzeptieren: nämlich, dass jeder von uns in der Kindheit viele so genannte magische Fähigkeiten hat, die nach und nach durch die Erziehung verloren gehen.
Alle Kinder sind zunächst einmal fantasiebegabt und schaffen damit spielerisch und sich vergnügend eine eigene Realität: Haben Sie nicht als „Prinzessin“ oder „Indianer und Cowboy“ agiert, sind Sie nicht den Held in Ihrem ganz eigenen „Film“ gewesen?! Sicher waren Ihnen damals die eigenen Fantasien und Wunschträume so vertraut und erschienen Ihnen so real, dass Sie gar nicht verstehen konnten, aus welchem Grunde die Erwachsenen Ihre Geschichten belächelten. Wenn es Ihnen gelungen ist, sich diese Gedankenkraft zu erhalten, sind Sie auf dem richtigen Weg, um als Hexe zu wirken, zu arbeiten und zu leben. Selbstverständlich hat Magie ihre Grenzen: Sie kann nicht das Unmögliche vollbringen. Aber: Magie ist die Arbeit mit Energien. Und mit Energien können Sie eine ganze Menge erreichen.
Was Magie eigentlich ist
Magie ist weder schlecht noch gut, sondern neutral. Deshalb kann man nicht zwischen schwarzen und weißen Hexen im Sinne von „heilig/gut“ oder „böse/schlecht“ unterscheiden. Jede Hexe, die ihre magischen Kräfte missbraucht, um anderen Personen Schaden zuzufügen, bringt ihre ureigene Beziehung mit dem Universum aus dem Gleichgewicht und trägt die Konsequenzen ihrer Handlungen. Nur Uneingeweihte unterscheiden zwischen schwarzer und weißer Magie. Denn diese eher grobe Unterteilung trifft nicht den Kern der Sache. Magie ist eher die Kunst, bestimmte Ereignisse mit dem Willen von Hexe oder Magier in Einklang zu bringen. Man definiert Magie deshalb besser als die Energie, die dem Kosmos das Leben gibt. Wahre Magie ist also das harmonische Zusammenleben mit den Kräften im Universum. Als Hexe nutzen Sie diese Energie für Ihre eigenen Zwecke, müssen aber verantwortungsvoll mit ihr umgehen.
Warum Worte so mächtig sind
In vielen Kulturen sind Zaubersprüche bekannt. Selbst bei uns kennt man die Worte Hokuspokus oder Abrakadabra, mit denen Zauberer auf der Bühne ihre Tricks vorführen. Das hat mit „echten“ Zaubersprüchen natürlich nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wissenschaftler, die sich vor allem mit Alchemie, Metaphysik, Theologie und Religionswissenschaft beschäftigt haben, vermuten, dass Zaubersprüche sich zunächst an übernatürliche Wesen richteten und deshalb eigentlich kaum von Gebeten zu trennen waren. Erst später wurden daraus Beschwörungen, mit denen man etwa Dämonen dazu bringen wollte, bei magischen Handlungen und Arbeiten hilfreich zu sein. Meist wurde das gesprochene Wort durch weitere magische Handlungen unterstützt. So sind manchmal besondere Reinheitsvorschriften notwendig, damit die beschworenen Dämonen dem Beschwörenden nicht gefährlich werden. Solche Vorsichtsmaßnahmen sind beispielsweise der sorgfältig ausgeführte magische Kreis, Waschungen, Keuschheit und Gebete. Außerdem sollten Beschwörungen stets zu einem bestimmten, als günstig erachteten Zeitpunkt stattfinden. Bevorzugt wurde etwa die so genannte „Geisterstunde“, die wir heute noch kennen – nämlich die Stunde nach Mitternacht. Hatte eine Beschwörung das erwünschte Ergebnis erbracht, so musste der gerufene Geist sorgsam zurückgebannt werden. Das geschah, indem man das Ritual in umgekehrter Richtung wiederholte und dabei auch den Name des Geistes rückwärts aussprach.
Dem Namen von Geistern, Gottheit oder Dämonen kommt also große Bedeutung zu. Der Grund liegt auf der Hand: Viele Vorstellungen von der Funktionsweise der Magie basieren auf der Annahme, dass man all jenes beherrschen und/oder verzaubern könne, dessen „wahren“ Namen man kenne. In vielen Völkern wird deshalb der Name eines Menschen geheim gehalten, und in manchen Religionen (wie dem Islam) oder Geheimwissenschaften (wie der Kabbala) spielen die Namen Gottes eine große Rolle.
Sprache als magisches Instrument
Die Macht liegt dabei also im Wort selbst. Ihm wurde schon immer eine besondere, manchmal sogar göttliche Wirkung zugesprochen. Denken Sie nur an den Beginn des Johannesevangeliums. Dort heißt es „Am Anfang war das Wort...“ Viele Philosophen sprachen Wörtern magische oder sogar göttliche Kräfte zu. Nur zwei Beispiele: Der Neuplatoniker Jamblichos (um 300 unserer Zeitrechnung) vertrat die Meinung, dass Worte umso stärker wirkten, je fremdartiger sie lauteten. Und der Theologe und Philosoph Pierre Poiret (1646-1719) vermutete, dass der Mensch ursprünglich alle Kreaturen durch seine Stimme beherrschen konnte. „...Denn der Mensch hat die Sprache nicht empfangen, um seines Gleichen seine Gedanken mitzuteilen, sondern um sich die Natur dadurch untertänig zu machen.“ Sprache galt also in erster Linie als magisches Instrument!
Zaubersprüche sind schon aus dem Altertum belegt, etwa aus der Zeit ägyptischer Alchemisten. Allerdings sind solche Formeln kaum in Wortlaut und Wirkung bekannt. Anders ist es bei den Zauberworten und -sprüchen der Germanen, die diese in Runen (siehe auch Kapitel 8) einritzten. Man leitet deshalb das Wort Zauber vom althochdeutschen zoubar ab, einer Bezeichnung der roten Farbe, mit der die eingeritzten Runen bestrichen wurden. Und das englische Wort für Zauberspruch, spell, kommt vom angelsächsischen speld (= Span oder Splitter), das auch das Runentäfelchen bezeichnete.
Ein Fund aus uralter Zeit: die Merseburger Zaubersprüche
Es ist gut 170 Jahre her, da machte der Historiker Dr. Georg Waitz (1813-1886) in der Bibliothek des Merseburger Domkapitels einen sagenhaften Fund: In einer theologischen Sammelschrift des 9./10. Jahrhunderts entdeckte er zwei uralte germanische Zauberformeln. Er ahnte wohl die Bedeutung seiner Entdeckung, konnte aber noch nicht wissen, dass er auf jene Schriftstücke gestoßen war, die bis heute weltweit die einzigen schriftlichen Zeugen heidnischen Inhalts in althochdeutscher Sprache sind.
Zur Begutachtung legte Waitz das Dokument einem der Mitbegründer der Germanistik vor: Jakob Grimm, den wir heute meist nur noch als einen der bekannten deutschen Märchendichter-Brüder kennen. Dieser bewertete und würdigte das Dokument mit den Zaubersprüchen im Jahre 1842 vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin mit den Worten: „...ist die reichhaltige Bibliothek des Domkapitels zu Merseburg von Gelehrten oft besucht und genutzt worden. Alle sind an einem Codex vorbeigegangen, der ihnen ... nur bekannte kirchliche Stücke zu gewähren schien, jetzt aber, nach seinem ganzen Inhalt gewürdigt, ein Kleinod bilden wird, welchem die berühmtesten Bibliotheken nichts an die Seite zu setzen haben...“
Damit wurden die Zauberformeln, die „Gedichte aus der Zeit des deutschen Heidentums“, schlagartig unter den Wissenschaftlern in aller Welt bekannt – als „Merseburger Zaubersprüche“.
Was in den germanischen Zauberformeln steht
Im ersten der beiden Merseburger Sprüche wird die Befreiung von Gefangenen beschworen, im zweiten die Heilung eines Pferdes durch germanische Götter. Der Wortlaut ist für uns heute natürlich nicht mehr zu verstehen – selbst in der Übersetzung in unser gebräuchliches Hochdeutsch nicht:
Eiris sâzun idisi, sâzun hêra duoder.
Suma hapt heptidum, suma heri lezidun,
suma clûbôdun umbi cuoniouuidi:
insprinc haptbandum, inuar uîgandun !
Die Übersetzung lautet:
Einst setzten sich Idisen, setzten sich hierher...
Manche hefteten Haft, manche hemmten das Heer.
Einige zerrten an den Fesseln.
Entspring den Haftbanden, entfahr den Feinden!
Damit können Sie nichts anfangen? Kein Wunder – sowohl Sprache wie Ausdruck sind uns fremd. Schließlich ist die Formel mehr als 2.500 Jahre alt. Dennoch war es möglich, den Inhalt zu deuten: Es ist von den Idisen die Rede. Diese Kriegsgöttinnen oder Walküren ließen sich auf dem Schlachtfeld nieder und griffen auf besondere Weise ins Kampfgeschehen ein: Manche knüpften Fesseln (halfen also, Feinde gefangen zu nehmen), andere hinderten das feindliche Heer am siegreichen Vordringen und eine dritte Gruppe half gefangenen Kriegern, sich aus...