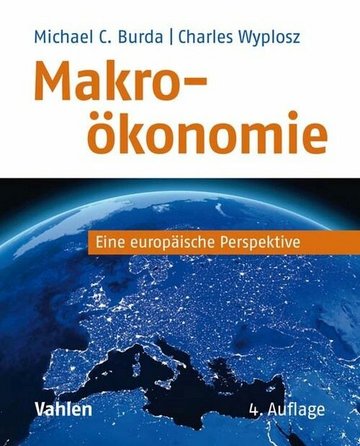| Cover | 1 |
| Zum Inhalt/Zu den Autoren | 2 |
| Titel | 3 |
| Vorwort | 4 |
| Inhaltsübersicht | 7 |
| Inhaltsverzeichnis | 8 |
| Verzeichnis der Abbildungen | 15 |
| Verzeichnis der Tabellen | 20 |
| Verzeichnis der Boxes | 22 |
| Verzeichnis der wichtigsten Symbole und Abkürzungen | 24 |
| Verzeichnis der Währungen | 25 |
| Teil I: Einführung in die Makroökonomik | 26 |
| 1 Die Bedeutung der Makroökonomik | 27 |
| 1.1 Überblick über die Makroökonomik | 27 |
| 1.2 Makroökonomische Konzepte | 28 |
| 1.2.1 Einkommen und Produktion | 28 |
| 1.2.2 Arbeitslosigkeit | 30 |
| 1.2.3 Produktionsfaktoren und Einkommensverteilung | 31 |
| 1.2.4 Inflation | 31 |
| 1.2.5 Finanzmärkte und Gütermärkte | 32 |
| 1.2.6 Außenwirtschaftliche Abhängigkeit | 33 |
| 1.3 Makroökonomik in langfristiger Perspektive: Wirtschaftswachstum | 34 |
| 1.4 Makroökonomik in kurzfristiger Perspektive: Konjunkturzyklen | 35 |
| 1.5 Makroökonomik als Wissenschaft | 39 |
| 1.5.1 Zur Entstehungsgeschichte der Makroökonomik | 39 |
| 1.5.2 Makroökonomik und Mikroökonomik | 41 |
| 1.5.3 Angebot und Nachfrage | 41 |
| 1.6 Die wissenschaftliche Methode der Makroökonomik | 42 |
| 1.6.1 Exogene und endogene Variable | 42 |
| 1.6.2 Theorie und Wirklichkeit | 43 |
| 1.6.3 Positive und normative Wirtschaftswissenschaft | 43 |
| 1.6.4 Das Überprüfen von Theorien: die Rolle der empirischen Analyse | 43 |
| 1.6.5 Makroökonomische Modelle und Vorhersagen | 44 |
| 1.7 Vorschau auf das Buch | 45 |
| 1.7.1 Aufbau | 45 |
| 1.7.2 Kontroversen und Konsens | 45 |
| 1.7.3 Logik versus Intuition | 46 |
| 1.7.4 Daten und Institutionen | 46 |
| 1.7.5 Europa | 47 |
| 2 Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | 49 |
| 2.1 Überblick | 49 |
| 2.2 Das Bruttoinlandsprodukt | 49 |
| 2.2.1 Drei Definitionen des Bruttoinlandsprodukts | 49 |
| 2.2.2 Reale versus nominale Größen, Deflatoren versus Preisindizes | 51 |
| 2.2.3 Messung und Interpretation des BIP | 55 |
| 2.3 Einkommen und Ausgaben | 57 |
| 2.3.1 Das Kreislaufdiagramm | 57 |
| 2.3.2 Der Wirtschaftskreislauf in Gleichungsform | 58 |
| 2.3.3 Weitere Einzelheiten | 60 |
| 2.3.4 Eine wichtige Definitionsgleichung | 62 |
| 2.3.5 Definitionsgleichungen versus ökonomische Theorie | 63 |
| 2.4 Die Zahlungsbilanz | 63 |
| 2.4.1 Die Leistungsbilanz und ihre Teilbilanzen | 64 |
| 2.4.2 Die Vermögensübertragungsbilanz | 64 |
| 2.4.3 Nettokreditaufnahme und Nettokreditvergabe | 66 |
| 2.4.4 Die Kapitalbilanz und ihre Komponenten | 66 |
| 2.4.5 Der Restposten | 68 |
| 2.4.6 Die Bedeutung der Teilbilanzen | 68 |
| 2.5 Zusammenfassung | 69 |
| Teil II: Die Gesamtwirtschaft langfristig betrachtet | 73 |
| 3 Ursachen des Wirtschaftswachstums | 74 |
| 3.1 Überblick | 74 |
| 3.2 Nachdenken über das Wirtschaftswachstum: Fakten und stilisierte Fakten | 75 |
| 3.2.1 Das Phänomen Wirtschaftswachstum | 75 |
| 3.2.2 Die aggregierte Produktionsfunktion und die Quellen des Wirtschaftswachstums | 76 |
| 3.2.3 Die fünf stilisierten Fakten des Wirtschaftswachstums nach Kaldor | 79 |
| 3.2.4 Der gleichgewichtige Wachstumspfad | 81 |
| 3.3 Kapitalakkumulation und Wirtschaftswachstum | 81 |
| 3.3.1 Ersparnis, Investition und Kapitalakkumulation | 81 |
| 3.3.2 Kapitalakkumulation und Abschreibung | 81 |
| 3.3.3 Die Beschreibung des gleichgewichtigen Wachstums | 83 |
| 3.3.4 Die Rolle der Ersparnis im Wachstumsprozess | 84 |
| 3.3.5 Die Goldene Regel | 86 |
| 3.4 Bevölkerungswachstum und Wirtschaftswachstum | 88 |
| 3.5 Technischer Fortschritt und Wirtschaftswachstum | 91 |
| 3.6 Wachstum in Zahlen | 93 |
| 3.6.1 Die Solow-Zerlegung | 93 |
| 3.6.2 Kapitalakkumulation | 95 |
| 3.6.3 Beschäftigungszunahme | 95 |
| 3.6.4 Technischer Fortschritt | 96 |
| 3.7 Warum sind einige Länder reich und einige arm | 97 |
| 3.7.1 Die Konvergenzhypothese | 97 |
| 3.7.2 Bedingte Konvergenz und bisher nicht berücksichtigte Produktionsfaktoren | 99 |
| 3.8 Zusammenfassung | 103 |
| 4 Arbeitsmärkte und Arbeitslosigkeit | 107 |
| 4.1 Überblick | 107 |
| 4.2 Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt | 108 |
| 4.2.1 Arbeitsangebot und Trade-off zwischen Konsum und Freizeit | 108 |
| 4.2.2 Arbeitsnachfrage, Produktivität und Reallöhne | 112 |
| 4.2.3 Gleichgewicht am Arbeitsmarkt | 114 |
| 4.2.4 Die Interpretation der Arbeitslosigkeit | 115 |
| 4.3 Eine statische Interpretation der Arbeitslosigkeit | 117 |
| 4.3.1 Unfreiwillige Arbeitslosigkeit und Reallohnanpassungen | 117 |
| 4.3.2 Tarifverhandlungen und Reallohnrigidität | 118 |
| 4.3.3 Soziale Mindeststandards und Reallohnrigidität | 123 |
| 4.3.4 Effizienzlöhne und Reallohnrigidität | 125 |
| 4.4 Eine dynamische Interpretation der Arbeitslosigkeit | 125 |
| 4.4.1 Arbeitsmarktzustände und Übergänge | 125 |
| 4.4.2 Bestandsgrößen, Stromgrößen und gleichgewichtige Arbeitslosigkeit | 127 |
| 4.4.3 Kündigungsrate und Häufigkeit von Arbeitslosigkeit | 127 |
| 4.4.4 Einstellungsrate und Dauer der Arbeitslosigkeit | 128 |
| 4.5 Die gleichgewichtige Arbeitslosenquote | 130 |
| 4.5.1 Das Konzept | 130 |
| 4.5.2 Die europäische Erfahrung | 131 |
| 4.5.3 Tatsächliche und gleichgewichtige Arbeitslosigkeit | 133 |
| 4.6 Zusammenfassung | 134 |
| 5 Geld, Preise und Wechselkurse in langfristiger Betrachtung | 138 |
| 5.1 Überblick | 138 |
| 5.2 Geld und Neutralität des Geldes | 139 |
| 5.2.1 Geld | 139 |
| 5.2.2 Geld und Preise | 139 |
| 5.2.3 Geld, Preise und Output | 142 |
| 5.2.4 Nominale und reale Zinsen | 145 |
| 5.3 Nominale und reale Wechselkurse | 145 |
| 5.3.1 Nominale Wechselkurse | 146 |
| 5.3.2 Reale Wechselkurse | 146 |
| 5.3.3 Bewegungen der nominalen und realen Wechselkurse | 147 |
| 5.3.4 Die Messung des realen Wechselkurses in der Praxis | 147 |
| 5.4 Die langfristige Entwicklung des Wechselkurses: die Kaufkraftparitätentheorie | 149 |
| 5.5 Zusammenfassung | 150 |
| Teil III: Die Gesamtwirtschaft in der kurzen Frist | 153 |
| 6 Kreditaufnahme und Budgetbeschränkungen | 154 |
| 6.1 Überblick | 154 |
| 6.2 Die Rolle der Zukunft in der Makroökonomik | 154 |
| 6.2.1 Die Zukunft hat einen Preis | 154 |
| 6.2.2 Die Hypothese der rationalen Erwartungen | 155 |
| 6.2.3 Die Parabel von Robinson Crusoe | 156 |
| 6.3 Die intertemporale Budgetbeschränkung des Haushalts | 156 |
| 6.3.1 Konsum und intertemporaler Handel | 156 |
| 6.3.2 Der Realzinssatz | 157 |
| 6.3.3 Das Vermögen und der Gegenwartswert von Konsum und Einkommen | 158 |
| 6.4 Unternehmen und die intertemporale Budgetbeschränkung des privaten Sektors | 159 |
| 6.4.1 Die Investitionsentscheidung der Unternehmen | 159 |
| 6.4.2 Die Produktionsfunktion | 159 |
| 6.4.3 Die Kosten der Investition | 160 |
| 6.4.4 Die intertemporale Budgetbeschränkung des konsolidierten privaten Sektors | 162 |
| 6.5 Budgetbeschränkungen des öffentlichen und des privaten Sektors | 163 |
| 6.5.1 Die Budgetbeschränkung des öffentlichen Sektors | 163 |
| 6.5.2 Die konsolidierte Budgetbeschränkung des öffentlichen und des privaten Sektors | 166 |
| 6.5.3 Das Ricardianische Äquivalenztheorem | 167 |
| 6.5.4 Ursachen für Abweichungen von der Ricardo-Äquivalenz | 168 |
| 6.6 Die Leistungsbilanz und die gesamtwirtschaftliche Budgetbeschränkung | 171 |
| 6.6.1 Die primäre Leistungsbilanz | 171 |
| 6.6.2 Durchsetzung internationaler Kreditverträge und staatliche Auslandsverschuldung | 172 |
| 6.7 Zusammenfassung | 175 |
| 7 Finanzmärkte | 178 |
| 7.1 Überblick | 178 |
| 7.2 Die Funktionsweise von Vermögensmärkten | 179 |
| 7.2.1 Eigenschaften von Finanzmärkten | 179 |
| 7.2.2 Implikationen: Volatilität und Profitabilität | 180 |
| 7.3 Volkswirtschaftliche Funktionen der Finanz- und Vermögensmärkte | 181 |
| 7.3.1 Finanzintermediation | 181 |
| 7.3.2 Der Preis für das Warten | 182 |
| 7.3.3 Risikoallokation | 183 |
| 7.3.4 Der Preis für das Risiko | 184 |
| 7.3.5 Die Abwägung zwischen Ertrag und Risiko | 186 |
| 7.4 Preise und Erträge von Finanzwerten | 187 |
| 7.4.1 Festverzinsliche Wertpapiere | 187 |
| 7.4.2 Aktien | 188 |
| 7.4.3 Kompliziertere Anlageformen | 189 |
| 7.5 Information und Markteffizienz | 190 |
| 7.5.1 Arbitrage | 190 |
| 7.5.2 Die Geld-Brief-Spanne | 192 |
| 7.5.3 Drei verwirrende Folgen der Markteffizienz | 192 |
| 7.5.4 Markteffizienz oder Spekulationsfieber | 194 |
| 7.6 Finanzmärkte und Makroökonomik | 197 |
| 7.7 Zusammenfassung | 199 |
| 8 Die Nachfrage des privaten Sektors: Konsum und Investition | 202 |
| 8.1 Überblick | 202 |
| 8.2 Konsum | 202 |
| 8.2.1 Das optimale Konsumbündel | 203 |
| 8.2.2 Schlussfolgerungen | 205 |
| 8.2.3 Vermögen oder Einkommen | 208 |
| 8.2.4 Konsumfunktion | 211 |
| 8.3 Investitionsnachfrage | 213 |
| 8.3.1 Der optimale Kapitalstock | 213 |
| 8.3.2 Investitionsausgaben und realer Zinssatz | 214 |
| 8.3.3 Das Akzeleratorprinzip | 216 |
| 8.3.4 Investitionsverhalten und Tobinsches q | 216 |
| 8.3.5 Die mikroökonomische Fundierung des Tobinschen q | 219 |
| 8.3.6 Die Investitionsfunktion | 222 |
| 8.4 Zusammenfassung | 223 |
| 9 Geld und Zinsen | 226 |
| 9.1 Überblick | 226 |
| 9.2 Was ist Geld und von wem wird es geschaffen | 226 |
| 9.2.1 Geldmenge und Geldmengenabgrenzungen | 227 |
| 9.2.2 Die Geldschöpfer: Zentralbanken und Geschäftsbanken | 229 |
| 9.2.3 Details zum Geldschöpfungsprozess | 233 |
| 9.2.4 Die Steuerung der Geldmenge durch die Zentralbank | 235 |
| 9.3 Die Geldnachfrage und der Markt für Geld | 237 |
| 9.3.1 Der Geldmarkt und seine Teilnehmer | 237 |
| 9.3.2 Der Zins ist der Preis für Geld | 238 |
| 9.3.3 Geldnachfrage | 238 |
| 9.3.4 Geldmarktgleichgewicht | 240 |
| 9.4 Geld in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft | 241 |
| 9.4.1 Geld: Eine anonyme Annehmlichkeit | 242 |
| 9.4.2 Ein öffentliches Gut bereitgestellt vom Staat | 242 |
| 9.4.3 Ein Nebenprodukt des Bankgeschäfts und der Kreditvergabe – oder nicht | 243 |
| 9.5 Zusammenfassung | 244 |
| 10 Geldpolitik, Banken und Finanzstabilität | 248 |
| 10.1 Überblick | 248 |
| 10.2 Die Grundlagen geldpolitischer Instrumente | 249 |
| 10.2.1 Wiederholung: Der Einfluss der Zentralbank auf das Bankgeschäft und die Geldschöpfung | 249 |
| 10.2.2 Offenmarktgeschäfte | 250 |
| 10.2.3 Direkte Kreditvergabe an Geschäftsbanken | 253 |
| 10.2.4 Mindestreservevorschriften | 253 |
| 10.3 Ziele, Zwischenziele und Instrumente der Geldpolitik | 254 |
| 10.3.1 Ziele | 254 |
| 10.3.2 Instrumente und Zwischenziele | 255 |
| 10.3.3 Die Taylor-Regel | 260 |
| 10.4 Die Transmissionskanäle der Geldpolitik | 262 |
| 10.4.1 Der Zinskanal | 263 |
| 10.4.2 Der Vermögenspreiskanal | 264 |
| 10.4.3 Der Kreditkanal | 264 |
| 10.4.4 Die Nullzinsgrenze | 264 |
| 10.5 Finanzstabilität als eine Voraussetzung für Geldpolitik | 266 |
| 10.5.1 Die inhärente Instabilität des fraktionalen Reservesystems | 266 |
| 10.5.2 Vertrauensbildende Maßnahmen | 267 |
| 10.5.3 Die Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz | 270 |
| 10.5.4 Technologische Innovationen und Finanzstabilität | 272 |
| 10.6 Zusammenfassung | 273 |
| Teil IV: Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht | 276 |
| 11 Das kurzfristige gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht | 277 |
| 11.1 Überblick | 277 |
| 11.2 Gütermarkt und gesamtwirtschaftliche Nachfrage | 278 |
| 11.2.1 Annahme eines Marktgleichgewichts | 278 |
| 11.2.2 Bestimmungsgründe der Nachfrage | 279 |
| 11.2.3 Gleichgewicht auf dem Gütermarkt | 280 |
| 11.2.4 Der Ausgabenmultiplikator nach Keynes | 282 |
| 11.2.5 Exogene versus endogene Variable | 284 |
| 11.3 Der Gütermarkt und die IS-Kurve | 284 |
| 11.3.1 Die IS-Kurve | 284 |
| 11.3.2 Abseits der IS-Kurve | 285 |
| 11.3.3 Bewegungen auf der IS-Kurve versus Verschiebungen der IS-Kurve | 286 |
| 11.4 Der Geldmarkt, Geldpolitik und die TR-Kurve | 287 |
| 11.4.1 Die Taylor-Regel und die TR-Kurve | 287 |
| 11.4.2 Die Steigung der TR-Kurve | 289 |
| 11.4.3 Geldpolitik: Bewegung entlang oder Verschiebung der TR-Kurve | 291 |
| 11.5 Das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht | 293 |
| 11.5.1 Das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht im IS-TR-Modell | 293 |
| 11.5.2 Reale Störungen: Verschiebungen der IS-Kurve | 293 |
| 11.5.3 Geldpolitische Störungen: Verschiebungen der TR-Kurve | 295 |
| 11.5.4 Ein allgemeiner Ansatz | 296 |
| 11.5.5 Geld- und Fiskalpolitik im IS-TR-Modell | 297 |
| 11.6 Zusammenfassung | 299 |
| 12 Internationale Kapitalströme und gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht | 302 |
| 12.1 Überblick | 302 |
| 12.2 Kleine offene Volkswirtschaften | 303 |
| 12.3 Internationale Kapitalströme | 303 |
| 12.3.1 Die Zinsparität | 303 |
| 12.3.2 Die IFM-Gerade | 305 |
| 12.3.3 Kapitalmobilität und Kapitalverkehrskontrollen | 305 |
| 12.3.4 Wechselkursregime | 306 |
| 12.3.5 Die weitere Vorgehensweise | 307 |
| 12.4 Produktion und Zinssätze bei festen Wechselkursen | 307 |
| 12.4.1 Was genau ist ein Regime fester Wechselkurse | 307 |
| 12.4.2 Verlust der geldpolitischen Autonomie – keine TR-Kurve | 308 |
| 12.4.3 Nachfrageschocks – Verschiebungen der IS-Kurve | 310 |
| 12.4.4 Schocks auf den internationalen Finanzmärkten – Verschiebungen der IFM-Gerade | 311 |
| 12.4.5 Paritätsanpassung | 311 |
| 12.5 Produktion und Zinssätze bei flexiblen Wechselkursen | 314 |
| 12.5.1 Geldpolitische Störungen – Verschiebungen der TR-Kurve | 314 |
| 12.5.2 Nachfrageschocks – Verschiebungen der IS-Kurve | 315 |
| 12.5.3 Schocks auf den internationalen Finanzmärkten – Verschiebungen der IFM-Gerade | 316 |
| 12.5.4 Ist eine große Volkswirtschaft eine geschlossene Volkswirtschaft | 317 |
| 12.6 Feste oder flexible Wechselkurse | 318 |
| 12.7 Zusammenfassung | 322 |
| 13 Produktion, Beschäftigung und Inflation | 324 |
| 13.1 Überblick | 324 |
| 13.2 Das allgemeine Gleichgewicht bei flexiblen Preisen: der neoklassische Fall | 325 |
| 13.2.1 Von der keynesianischen kurzfristigen zur neoklassischen langfristigen Betrachtungsweise | 325 |
| 13.2.2 Langfristig wird die Produktionsmenge von der Angebotsseite bestimmt | 327 |
| 13.2.3 Schlussfolgerungen für die lange Frist | 328 |
| 13.3 Die Phillips-Kurve: Hirngespinst oder stilisiertes Faktum | 328 |
| 13.3.1 Die Entdeckung von A. W. Phillips | 328 |
| 13.3.2 Das Gesetz von Okun und die Interpretation der Phillips-Kurve als Angebotskurve | 330 |
| 13.3.3 Einige schwierige Fragen zur Phillips-Kurve | 332 |
| 13.4 Die Komponentenzerlegung der Inflation: Kampf der Aufschläge als Inflationsursache | 335 |
| 13.4.1 Preise und Kosten | 335 |
| 13.4.2 Der Kampf der Aufschläge | 337 |
| 13.4.3 Produktivität und Lohnquote | 338 |
| 13.4.4 Das konjunkturelle Verhalten der Aufschläge | 339 |
| 13.4.5 Mehr über die Grundinflationsrate | 341 |
| 13.4.6 Vervollständigung des Bildes: Angebotsschocks | 341 |
| 13.5 Inflation, Arbeitslosigkeit und Produktion | 343 |
| 13.5.1 Die Rehabilitierung der Phillips-Kurve | 343 |
| 13.5.2 Grundinflation und die lange Frist | 343 |
| 13.5.3 Das gesamtwirtschaftliche Angebot | 345 |
| 13.5.4 Die Lageparameter der Phillips-Kurve und der aggregierten Angebotskurve | 345 |
| 13.5.5 Von der kurzen zur langen Frist | 347 |
| 13.6 Zusammenfassung | 348 |
| 14 Das aggregierte Angebot-Nachfrage-(AS-AD-)Modell | 351 |
| 14.1 Überblick | 351 |
| 14.2 Das AS-AD-Modell bei festen Wechselkursen | 352 |
| 14.2.1 Die langfristige aggregierte Nachfragekurve | 352 |
| 14.2.2 Die kurzfristige aggregierte Nachfragekurve | 354 |
| 14.2.3 Bewegungen auf der Nachfragekurve versus Kurvenverschiebungen | 355 |
| 14.2.4 Das vollständige Modell | 355 |
| 14.2.5 Fiskalpolitik und Nachfragestörungen | 356 |
| 14.2.6 Geldpolitik und Wechselkursanpassungen | 360 |
| 14.3 Das AS-AD-Modell bei flexiblen Wechselkursen | 363 |
| 14.3.1 Nominale versus reale Zinsen: Die Fisher-Gleichung | 363 |
| 14.3.2 Die langfristige aggregierte Nachfragekurve | 365 |
| 14.3.3 Die kurzfristige aggregierte Nachfragekurve | 366 |
| 14.3.4 Bewegungen auf der AD-Kurve versus Kurvenverschiebungen | 367 |
| 14.3.5 Das vollständige Modell | 367 |
| 14.3.6 Geldpolitik | 368 |
| 14.4 Anwendungsbeispiele für das AS-AD-Modell | 369 |
| 14.4.1 Zeitverzögerungen und Zeithorizont | 369 |
| 14.4.2 Angebotsschocks | 370 |
| 14.4.3 Nachfrageschocks | 372 |
| 14.4.4 Disinflation | 373 |
| 14.5 Zusammenfassung | 377 |
| 15 Der Wechselkurs | 381 |
| 15.1 Überblick | 381 |
| 15.2 Devisenmärkte | 381 |
| 15.2.1 Die wichtigsten Eigenschaften von Devisenmärkten | 381 |
| 15.2.2 Devisengeschäfte | 382 |
| 15.2.3 Dreiecksarbitrage | 383 |
| 15.3 Die Zinsparitäten | 384 |
| 15.3.1 Die gedeckte Zinsparität | 384 |
| 15.3.2 Die ungedeckte Zinsparität | 385 |
| 15.3.3 Risikoprämien | 386 |
| 15.3.4 Langfristige Arbitrage mit realen Zinssätzen | 387 |
| 15.4 Kurzfristige Determinanten des Wechselkurses | 387 |
| 15.4.1 Der Wechselkurs als Preis einer Vermögensanlage | 387 |
| 15.4.2 Implikationen der ungedeckten Zinsparität | 389 |
| 15.4.3 Ein scheinbarer Widerspruch und seine Auflösung | 391 |
| 15.4.4 Die fundamentalen Bestimmungsfaktoren des nominalen Wechselkurses | 393 |
| 15.5 Der langfristige Wechselkurs | 393 |
| 15.5.1 Die primäre Leistungsbilanz in langfristiger Betrachtung: ein Rückblick | 393 |
| 15.5.2 Gleichgewichtiger realer Wechselkurs und primäre Leistungsbilanz in langfristiger Betrachtung | 394 |
| 15.5.3 Die fundamentalen Bestimmungsfaktoren des realen Wechselkurses | 395 |
| 15.5.4 Wenn sich der gleichgewichtige reale Wechselkurs ändert | 399 |
| 15.6 Von der langen zur kurzen Frist | 400 |
| 15.6.1 Der gleichgewichtige reale Wechselkurs als Anker | 400 |
| 15.6.2 Der Übergang zur langen Frist: die Paritätsbedingungen | 400 |
| 15.7 Wechselkursschwankungen und Währungskrisen | 402 |
| 15.7.1 Volatilität und Prognostizierbarkeit | 402 |
| 15.7.2 Währungskrisen | 403 |
| 15.8 Zusammenfassung | 404 |
| Teil V: Makroökonomische Politik in einer globalen Wirtschaft | 407 |
| 16 Die Politik der Nachfragesteuerung | 408 |
| 16.1 Überblick | 408 |
| 16.2 Grundprobleme der Nachfragesteuerung | 409 |
| 16.2.1 Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, das ist hier die Frage | 409 |
| 16.2.2 Die Trägheit von Erwartungen und die Grundinflationsrate | 411 |
| 16.2.3 Die Kosten der Inflation | 413 |
| 16.3 Durchführungsprobleme der Nachfragesteuerung | 417 |
| 16.3.1 Frisch, Slutsky und die moderne Sicht von Konjunkturzyklen | 417 |
| 16.3.2 Unsicherheit, Zeitverzögerungen und die Friedman-Kritik an der Nachfragesteuerung | 420 |
| 16.3.3 Politische Grenzen der Nachfragesteuerung | 424 |
| 16.4 Jenseits der Kontroversen: Die Synthese | 425 |
| 16.4.1 Die Evidenz spricht für die Mitte | 426 |
| 16.4.2 Makroökonomischen Politikmaßnahmen sind Grenzen gesetzt | 426 |
| 16.4.3 Die Synthese | 427 |
| 16.5 Die Große Rezession und Nachfragesteuerung: Neue Herausforderungen oder ein altes Dilemma | 428 |
| 16.5.1 Die wirtschaftspolitische Herausforderung | 428 |
| 16.5.2 Die wirtschaftspolitische Antwort | 428 |
| 16.5.3 Diagnose und Lehren für die Zukunft: Fiskalpolitik | 430 |
| 16.5.4 Diagnose und Lehren für die Zukunft: Geldpolitik | 430 |
| 16.6 Zusammenfassung | 432 |
| 17 Finanzpolitik, Staatsverschuldung und Geldschöpfungsgewinn | 435 |
| 17.1 Überblick | 435 |
| 17.2 Finanzpolitik und wirtschaftliche Wohlfahrt | 436 |
| 17.2.1 Die Bereitstellung öffentlicher Güter und Dienstleistungen | 436 |
| 17.2.2 Umverteilungsziele: Gleichheit versus Effizienz | 437 |
| 17.3 Gesamtwirtschaftliche Stabilisierung | 438 |
| 17.3.1 Konsumverhalten und Steuerglättung | 438 |
| 17.3.2 Stabilisierung von Produktion und Beschäftigung | 440 |
| 17.3.3 Automatische Stabilisatoren | 442 |
| 17.3.4 Die Interpretation von Haushaltszahlen | 442 |
| 17.4 Die Finanzierung des Haushaltsdefizits: Staatsverschuldung und Geldschöpfungsgewinn | 445 |
| 17.4.1 Staatsverschuldung in einer stationären Wirtschaft ohne Inflation | 447 |
| 17.4.2 Staatsverschuldung in einer wachsenden Wirtschaft ohne Inflation | 449 |
| 17.4.3 Der allgemeine Fall: Staatsverschuldung in einer wachsenden Wirtschaft mit Inflation | 451 |
| 17.5 Möglichkeiten der Stabilisierung der Staatsschuld | 452 |
| 17.5.1 Verringerung des Haushaltsdefizits | 452 |
| 17.5.2 Geldschöpfungsgewinn und Inflationssteuer | 453 |
| 17.5.3 Zahlungsausfall | 454 |
| 17.5.4 Zinserleichterung | 455 |
| 17.5.5 Langfristiges Wirtschaftswachstum | 457 |
| 17.6 Zusammenfassung | 457 |
| 18 Wirtschaftspolitik in der langen Frist | 461 |
| 18.1 Überblick | 461 |
| 18.2 Markteffizienz und die Theorie der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik | 462 |
| 18.2.1 Das Modell des vollkommenen Wettbewerbs als Richtschnur für Effizienz | 462 |
| 18.2.2 Unvollkommener Wettbewerb und Knappheitsrenten | 463 |
| 18.2.3 Marktversagen und Markteffizienz | 466 |
| 18.3 Gütermarktpolitik | 469 |
| 18.3.1 Externe Effekte | 469 |
| 18.3.2 Monopolistische Märkte | 470 |
| 18.4 Besteuerung als Preis für die Marktkorrektur | 473 |
| 18.4.1 Besteuerung als notwendiges Übel | 473 |
| 18.4.2 Die Effizienzwirkungen der Besteuerung | 474 |
| 18.4.3 Adverse Effekte der Besteuerung auf die Bemessungsgrundlage | 474 |
| 18.5 Arbeitsmarktpolitik | 477 |
| 18.5.1 Heterogenität und unvollkommene Information | 477 |
| 18.5.2 Unvollständige Verträge und Regulierung des Arbeitsmarktes | 481 |
| 18.5.3 Sozialpolitische Anreizprobleme und Besteuerung | 483 |
| 18.6 Angebotspolitik in der Praxis | 486 |
| 18.6.1 Warten auf Godot Die langen und variablen Wirkungsverzögerungen von Angebotspolitik | 486 |
| 18.6.2 Die politische Ökonomie von angebotsseitigen Reformen | 487 |
| 18.6.3 Machbare Angebotsreformen: Nur Kleinkram oder große Erfolge | 488 |
| 18.6 Zusammenfassung | 491 |
| 19 Die Architektur des internationalen Währungssystems | 495 |
| 19.1 Überblick | 495 |
| 19.2 Zur Geschichte der Währungsvereinbarungen | 496 |
| 19.2.1 Der Goldstandard | 496 |
| 19.2.2 Die Zwischenkriegszeit | 500 |
| 19.2.3 Das internationale Währungssystem von Bretton Woods | 501 |
| 19.3 Der Internationale Währungsfonds | 505 |
| 19.3.1 Kurzfristiger Währungsbeistand und Konditionalität | 506 |
| 19.3.2 Sonderziehungsrechte | 507 |
| 19.3.3 Überwachung | 507 |
| 19.4 Währungskrisen | 508 |
| 19.4.1 Die unmögliche Trilogie | 508 |
| 19.4.2 Booms und Zusammenbrüche | 509 |
| 19.4.3 Fundamentalkrisen | 509 |
| 19.4.4 Nicht-fundamentale Krisen | 511 |
| 19.5 Die Wahl des Wechselkursregimes | 514 |
| 19.5.1 Eine alte Debatte: feste versus flexible Wechselkurse | 514 |
| 19.5.2 Die neue Debatte: Liberalisierung der Finanzmärkte | 515 |
| 19.5.3 Currency Boards und Dollarisierung | 519 |
| 19.5.4 Währungsunionen | 519 |
| 19.5.5 Die Europäische Währungsunion | 522 |
| 19.6 Zusammenfassung | 524 |
| 20 Epilog | 527 |
| 20.1 Die keynesianische Revolution | 527 |
| 20.2 Die monetaristische Revolution | 529 |
| 20.3 Die Revolution der rationalen Erwartungen | 532 |
| 20.4 Die Mikrofundierung der Makroökonomik | 533 |
| 20.5 Neu-Keynesianismus: Eine Synthese | 533 |
| 20.6 Institutionsökonomik und politische Ökonomie | 534 |
| 20.7 Arbeitsmärkte | 535 |
| 20.8 Such- und Matchingtheorie | 536 |
| 20.9 Wachstum und Entwicklung | 537 |
| 20.10 Demographie, niedriges Produktivitätswachstum und säkulare Stagnation | 538 |
| 20.11 Schlussfolgerungen | 540 |
| Glossar | 541 |
| Literaturverzeichnis | 561 |
| Sachverzeichnis | 563 |
| Impressum | 571 |