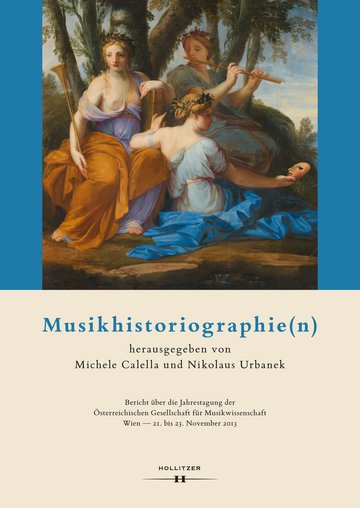GRENZEN DER MENSCHHEIT. MARGINALIEN ZU GLOBALISIERUNG UND TRANSKULTURELLER MUSIKGESCHICHTE
TOBIAS ROBERT KLEIN
Eine Antwort auf die Key-Note Lecture von Britta Sweers rührt an grundsätzliche Fragen der Methodik und Organisation des Faches Musikwissenschaft. Angesichts des hierfür zur Verfügung stehenden Raums bedingt dies nicht nur ihren notwendig rhapsodischen Charakter, sondern verlangt darüber hinaus einen historisch weiten Atem: In wohl keinem Überblick zur Fachgeschichte fehlt der Hinweis auf Guido Adlers nicht nur in Wien kanonische Abhandlung über Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft. In schaurig schönem Kanzleistil weist Adler der „Vergleichenden Musikwissenschaft“ als Aufgabe zu, die „Tonproducte [...] verschiedener Völker, Länder und Territorien behufs ethnographischer Zwecke zu vergleichen“, gliedert aber auch die „Geschichte der Musik“ keineswegs nur „nach Epochen“ sondern orts- und institutionsbezogen nach „Völkern, Territorien, Gauen, Städten und Kunstschulen.“1 Während den meisten Musikologen diese Postulate gut bekannt sind, erinnern sich wohl nur wenige unter ihnen, dass auf Adlers Eröffnungsartikel in der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft ein Beitrag des Händel-Forschers Friedrich Chrysander folgt, der sich nicht etwa mit Oratorien und Opern, sondern der Geschichte „altindischer Opfermusik“ beschäftigt.2 Wie allem Anfang wohnt auch dem heroischen Gründungsjahrzehnt unserer Disziplin ein erst durch den institutionellen Zwang zur Spezialisierung gebannter Zauber inne,3 der unter den veränderten sozialen und ethischen Vorzeichen einer „Netzwerk-“ oder „Weltgesellschaft“4 unversehens an Aktualität gewinnt. Die zuerst durch Film und Fernsehen, dann den Luftverkehr und schließlich Internet und Mobiltelefonie vermittelte Überschreitung ethnischer, topographischer und stilistischer Grenzen legt heute nicht nur die soziale Durchleuchtung ‚westlicher‘ Traditionen, sondern – im Sinne einer Begegnung auf Ohren- und Augenhöhe – zugleich die philologische, historische und ästhetische Analyse afrikanischer, asiatischer und amerikanischer Musikkulturen nahe.
Der Blick in die Fachgeschichte ist für die Periodisierung globaler Kontakte aber auch von unmittelbar epistemologischen Interesse: Britta Sweers Adaptation von David Helds als stufenweise voranschreitender Transformations- und Verdichtungsprozess angelegter Globalisierungstheorie5 erinnert an eine teleologische Entwicklungsgeschichte, wie sie schon Walter Wiora in seinen Vier Weltaltern der Musik skizzierte.6 Der Ansatz erscheint zur Beschreibung kultureller Diffusionsprozesse allerdings nicht nur deshalb problematisch, weil die historische Spezifik von Brüchen, Schüben und Konflikten gegenüber ihrer theoretisch systematisierten Stetigkeit in den Hintergrund gerät. Ebenso wenig vermag eine solche politikwissenschaftliche Vogelperspektive zwischen ideengeschichtlich-konzeptuellen Transfers und der Adaptation theoretisch-materieller Grundlagen wie Tonsystemen und Musikinstrumenten zu differenzieren, zumal sie mit der Religion einen bedeutenden Faktor für ihre Verbreitung vollständig ignoriert. Hierfür lassen sich bereits innerhalb von Regionen und Kontinenten der von Curt Sachs in glühenden Farben geschilderte Wandel der Musikkultur des alten ägyptischen Reiches7 ebenso wie die islamische Reform im westafrikanischen Sahel8 und die (mündliche) Verbreitung des Cantus Planus benennen: Fränkische und päpstliche Chronisten führten die Entstehung regionaler Varietäten wahlweise auf eine sinistre Subversion der Reichseinheit oder die beschränkte Assimiliationsfähigkeit nordischer Barbarenkehlen zurück.9 Erst im „frühneuzeitliche[n] Zeitalter von Entdeckungen, Sklavenhandel und ‚ökologischen Imperialismus‘“10, verdichten sich transkontinentale Verbindungen, Verflechtungen und Interdependenzen schließlich zu jener „globalen Ökumene“11, welche die Globalisierung der Musik – parallel mit ihrer Transformation zur (potentiellen) Ware – auch als Geschichte der Adaptation ästhetischer Einstellungen ausweist.12 In diesem Sinne untersucht Henry Spiller den Einfluss indonesischer Gamelan-Ensembles auf sich von der klassischen Musikkultur Europas distanzierende Komponisten in den Vereinigten Staaten,13 während Amanda Weidmann und Lakshmi Subramanian die Genese der an spezifische Trägerschichten gebundenen konzertanten Musikdarbietung im kolonialen Südindien beschreiben:
„The staging of Karnatic music in public concerts […] involved a constellation of developments that profoundly affected the ways in which Karnatic music came to be performed and heard. In a concrete sense, the concert hall brought about a particular structure of presentation, one that was based on a clear separation between the musicians and the audience, and the idea of a ‚repertoire‘ of ‚timeless‘ compositions detachable both from their original context and the contexts of their repeated performances.“14
Ihr volles erkenntniskritisches Potential entfalten solche nicht selten von der aktuellen Erfahrung globaler Durchdringung inspirierte Fragestellungen freilich erst im Kontext der in der Musikwissenschaft noch immer vernachlässigten „Postcolonial Theory“.15 Die zunächst von Literatur-, Kultur und Sozialwissenschaftlern wie Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak oder Kwame Anthony Appiah initiierte Auseinandersetzung mit den (Nach)wirkungen der europäischen Expansion befasst sich mit einem breiten Spektrum von Themen, die von der sozialen Produktion subalterner „kolonialer Subjekte“ über globale Migrationsbewegungen und die Probleme multiethnischer Nationalstaaten bis hin zur eigenen transkulturellen Verortung16 dieser asiatischen, afrikanischen oder karibischen Intellektuellen reichen.17 Das von Bhabha dabei entwickelte Konzept der „hybridity“18 wird von Musikwissenschaftlern häufig nur als Ersatz für außer Kurs geratene Begriffe wie Akkulturation oder Synkretismus bemüht,19 ohne den spezifischen Kontext seiner Schilderung, die Erziehung trotz ihrer britischen Prägung immer als „eingeboren“ erkennbar bleibender kolonialer Subjekte („white but not quite“) näher zu berücksichtigen.20
Mehr noch als zur Analyse gewaltsamer Zusammenstöße und Eroberungszüge wie der spanischen Konquista21 erscheint postkoloniales Gedankengut somit zur Einordnung kultureller Export- und Austauschprozesse22 unverzichtbar: Der auf den Routen der Sklavenschiffe zwischen Europa, Nordamerika und Afrika etablierte Kulturraum des „Black Atlantic“23 erweist sich auch als konstitutiv für die Entwicklung und Verbreitung der modernen Popmusik. Und die anhaltende Resonanz von Opern, Sonaten und Symphonien in Ostasien kann nicht nur als ein eurozentrisches Oktroi, sondern ebenso als selbstbewusste Aneignung einer wie die englische Sprache nicht mehr allein von den Herrschern des Empires kontrollierten Überlieferung verstanden werden. Auch die von Sweers erwähnte Schwierigkeit, eine „ausgewogen balancierte Geschichte“ der Gitarre zu schreiben, hat Kofi Agawu in diesem Sinne zugespitzt:
„What sense does it make, after a century and a half of regular, continuous, and imaginative use, to describe the guitar as a ‚foreign‘ instrument in Africa, or a church hymn as representing an alien musical language?“
Unterstrichen werden die absurden Konsequenzen eines derartigen Authentizitätsfetischismus durch seine (postkoloniale) Projektion auf die europäische Musiktradition:
„Otherwise, we would have to insist, every time we hear the Beethoven Violin Concerto, that the violin originated in the Middle East, that strictly speaking, it is not a European instrument, and therefore that all compositions for violin by European are hybrid at the core, always already marked as ‚oriental‘.“24
Konträr zu seiner politischen Unabhängigkeit hat sich das vom militärischen Imperialismus nur peripher erfasste Japan der westlichen Musikkultur weit geöffnet,25 während ihre Wirkung im über mehrere Jahrhunderte kolonisierten Indien, das seine Kultur durch Filme heute seinerseits global zu verbreiten beginnt,26 weitaus schwächer geblieben ist. Gerade dies stellt aber auch die von Weidmann mit den sich widerstreitenden Motiven der Bewahrung, Zugänglichkeit und Autorität verbundenen Bestrebungen der Notation karnatischer Musik27 in einen größeren historischen Kontext. Während solche Aufzeichnungen im von der Verbreitung der Druckerpresse begleiteten Hoch- und Spätkolonialismus stetig zunehmen, verlieren sie im postkolonialen Zeitalter audiovisueller Medien wieder an Bedeutung. Weidmanns von der grundsätzlichen „Unvollkommenheit der Notenschrift“28 abstrahierende Darstellung berücksichtigt aber weder die auch im europäischen Kontext nur informell vermittelte Praxis „kleine[r] und große[r] Auszierungen, [aus denen] der vernünftige und gute Geschmack[entsteht]“,29 noch die widersprüchliche Stellung solcher Verschriftlichungsdebatten innerhalb des britischen Empire. So betrachtete der englische Musikologe Arthur Fox-Strangways die die Rolle des Ohrs stärkende Absenz der Schrift als willkommene Möglichkeit, durch die freie melodische Entwicklung der Ragas („like that of the woods in spring-time“) „rhythmical rigidities“ und „trammels of our tonality“ zu überwinden.30 Der Panafrikanist James E. Kwegyir Aggrey projizierte zur gleichen Zeit die „Unnotierbarkeit“ von Musik hingegen als kulturtechnische Errungenschaft in die globalen Dimensionen des „Black...