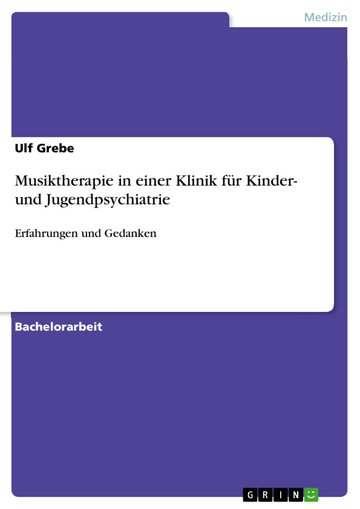Die Patienten der Klinik habe ich meistens zweimal „kennengelernt“: zum einen, wenn sie mir in einer musiktherapeutischen Einzel- oder Gruppensitzung begegneten und zum anderen, wenn ihr Fall in der wöchentlichen Teambesprechung mit Chefarzt auf den Tisch kam. Meist war die Therapiesitzung für mich die erste Begegnung, was noch dadurch befördert wurde, dass ich normalerweise nicht täglich in der Klinik war. Doch auch die Musiktherapeutin, Teresa Schlummer, lernte viele ihrer Patienten erst im Musiktherapieraum kennen und beschäftigte sich erst dann näher mit den ärztlichen und psychologischen Befunden. Sie wollte so die persönliche Kontaktaufnahme möglichst von Krankheitsvermutungen oder –diagnosen und fachlichen Wertungen frei halten und sich unvoreingenommen einen eigenen Eindruck verschaffen. Doch meist blieb auch, nachdem man die Patienten schon ein wenig kannte, ein Spannungsverhältnis zwischen diesen so unterschiedlichen Perspektiven bestehen. Das ging so weit, dass ich manchmal die in der Visite besprochene Person während der musiktherapeutischen Begegnung nicht wiederzuerkennen glaubte. Diese Ambivalenz zwischen Diagnose und persönlichem Eindruck, die mir eine für unsere Profession wichtige Erfahrung zu sein scheint, möchte ich an folgendem Fall veranschaulichen:
Hannes*, ein kleiner untersetzter Junge von 13 Jahren mit starker Brille, kurzen struppigen Haaren und tarnfarbener Bundeswehrhose kommt in die Trommelgruppe. Er wirkt auf mich im ersten Moment etwas begriffsstutzig. Seine Körperhaltung und Mimik sind wie „heruntergefahren“, er hat die Hände viel in den Hosentaschen und spricht einsilbig, eher leise und mit wenig Melodie. Doch im Laufe der Trommelstunde überrascht Hannes mich. Nicht nur, dass er im rhythmischen Tun erkennbar auftaut, er lässt auch eine kleine Bemerkung fallen, die ausgesprochen schlagfertig und witzig ist. Und als wir mit Trommeln im Kreis sitzen, kann man sehen, dass Hannes sich hier ganz zu Hause fühlt. Er trommelt gut, mit fast schon lässiger Geste.
Am selben Tag ist „Visite“, womit nicht nur die wöchentliche Runde des Chefarztes und seiner KollegInnen durch eine Station gemeint ist, sondern auch die anschließende Teambesprechung, an der auch die Fachtherapeuten zu mehreren Kollegen teilzunehmen pflegen. Der Ablauf ist immer ähnlich: Prof. Dr. (..., der Chefarzt, greift in den Aktenwagen, ruft den Namen des Patienten in die Runde und eröffnet so die Besprechung des Falles. Da die meisten Teilnehmer der Besprechung schon beim Rundgang dabei waren, haben sie die fragliche Person frisch vor Augen, und es gibt zu den aktenkundigen Informationen auch eine aktuelle Befindlichkeit. Diese wird ebenso thematisiert wie die aktuellen Befunde der medizinischen oder psychologischen Abteilung aus Diagnostik und Therapie, Berichte von Elterngesprächen, Rückmeldungen der Fachtherapeuten oder auch mal einer Lehrerin. Nach mal mehr, mal weniger ausführlicher Diskussion wird vom Chefarzt beschlossen, wie die Behandlung weitergehen soll.
Hannes ist Bewohner der Station für ältere Kinder, K2. Aus der Besprechung seines Falles notiere ich mir an diesem Tag einige Stichworte: „Hat Schwierigkeiten in Gruppen, kann sich nicht abgrenzen, kann sich nicht einschätzen, ‚verpeilt’, sprachlich schwach, ‚wie unter einer Glocke’. Ist er überfordert? Autistoid? Unsicher, weil er wenig gelernt hat?“
Im Laufe der Wochen wird das Bild, das die Visiten von Hannes zeichnen, schärfer. Nach eingehender Diagnostik wird die Autismus-Vermutung fallen gelassen. Ich erfahre, dass Hannes sich gerne zurückzieht und die Gesellschaft anderer Kinder nicht sucht. In den Trommelstunden fügt er sich hingegen scheinbar mühelos ein, spielt gruppendienlich und fällt hin und wieder mit schlagfertigen Bemerkungen aus seiner sonst wortkargen Rolle.
Ich erfahre, dass Hannes sehr unter der labilen Beziehung zu seiner Mutter leide, die schwer depressiv und suizidgefährdet sei.
Nach einer etwas längeren Pause im Praktikum erfahre ich, dass Hannes‘ Mutter sich am letzten Wochenende das Leben genommen hat. Erschüttert über dieses Ereignis wende ich mich an die Musiktherapeutin, Frau Schlummer, und frage sie, ob nicht die Musiktherapie etwas für Hannes tun könne. Sie sagt dazu, sie wolle abwarten, ob er ein dahingehendes Bedürfnis zeige. Ansonsten werde sie ihn mit dem Thema in Ruhe lassen. Seine Betreuung auf der Station werde den Notwendigkeiten angepasst.
Als Hannes kurz darauf das nächste Mal in die Trommelgruppe kommt, beginne ich erst zu verstehen, wie sie das meint: Nichts in seinem Verhalten lässt ahnen, was ihm zwischenzeitlich widerfahren ist. Er beteiligt sich rege, geht in Kontakt zur Gruppenleitung und zur Gruppe, erlaubt sich sogar ein paar Albernheiten. Nimmt er hier die Chance einer Auszeit wahr? Es hat ganz den Anschein.
Hannes‘ Geschichte an der KJPP ging noch ein wenig weiter. Bis er entlassen werden konnte, registrierte ich noch einige Schilderungen des Betreungspersonals, wonach er durchaus angemessene Reaktionen der Trauer und Verzweiflung zeigen konnte und dies auch tat. Doch auch unsere eigenen Erfahrungen mit ihm aus den Trommelstunden, wo er lebhaft, gewitzt und integriert gewirkt hatte, standen am Ende nicht mehr im Gegensatz zur Wahrnehmung der Ärzte und Psychologen: Autismus, Depression, Suizidgefahr – die schwerwiegenden Anfangsvermutungen – konnten im Verlaufe seines Aufenthaltes zurückgenommen werden.
Hannes wurde bis zuletzt vielschichtig und intensiv betreut. Von Seite der Klinik wurden die ihn stützenden Personen seines persönlichen Umfeldes, vor allem sein Vater, beraten und vernetzt. Es wurde ihm geholfen, den Abschied von seiner Mutter in einer für ihn körperlich und seelisch verkraftbaren Weise mit zu vollziehen. Und schließlich wurde eine Betreuungsform gesucht und gefunden, die ihm für die kommende Zeit eine Lebens- und Lernperspektive bieten konnte. Als Hannes nach mehrmonatigem Aufenthalt von der KJPP in die Obhut seines Vaters und einer betreuten Wohngruppe übergeben werden konnte, war sein Leben ein völlig anderes als zuvor. Doch er hatte den endgültigen Verlust seiner Mutter in einer Umgebung erlitten, die ihn schützte, die für ihn sorgte und ihm frohe Momente ermöglichte und die im Hintergrund darauf hinwirkte, dass sein Leben in verantwortlichen Bahnen weiter gehen konnte.
Auch die Wahrnehmung des Patienten und der Person Hannes hat im Laufe seiner Betreuung eine gewaltige Veränderung durchlaufen. Ähnlich wie den Ärzten und Psychologen, die anfangs Hannes’ kommunikative und lebenszugewandte Seite anscheinend nicht bemerkt hatten, war es auch der Musiktherapeutin und mir ergangen: Der Hannes, den wir in den Trommelstunden erlebten, schien nicht nur „ein anderer“ als der, der uns zunächst in den Visiten vorgestellt wurde. Unser Blick konnte in den relativ kurzen Momenten der Begegnung auch nicht das Drama umfassen, das sich in und um diesen Jungen abspielte. Für uns war es also wichtig, darüber aufgeklärt zu werden, denn es hätte auch sein können, dass er die Stunden im Musikraum für etwas anderes gebraucht hätte als eine Auszeit.
Ich habe eingangs von zwei unterschiedlichen, mitunter gegensätzlich scheinenden Perspektiven gesprochen. Natürlich gibt es in einer Einrichtung dieser Größe nicht nur zwei, sondern mehr. Doch das Erlebnis dieses Gegensatzes zweier Perspektiven hat mir nachdrücklich gezeigt, wie ausschnitthaft – und damit begrenzt – jede Wahrnehmung für sich genommen sein kann, und wie wichtig es ist, sich für andere Möglichkeiten zu interessieren. Schnelle Urteile, ganz gleich, ob in der Musiktherapiestunde oder bei der Visite gefällt, werden allzu leicht von einer neuen „Wirklichkeit“ über den Haufen geworfen (siehe auch Diskussion in Kapitel 8).
Neben Hannes habe ich noch etwa ein Dutzend weitere PatientInnen kennen gelernt, manche näher, andere weniger nah. Bestimmte Krankheitsdiagnosen bzw. Einweisungsgründe traten dabei vermehrt in Erscheinung. Bei den Mädchen waren es (besonders häufig) Essstörungen, außerdem Zwangsstörungen und Selbstverletzendes Verhalten. Bei den Jungen häuften sich die Befunde Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne Störung des Sozialverhaltens, Verdacht auf Autismus oder Mutismus und Angststörungen. Nach Geschlechtern ähnlich häufige Einweisungsgründe schienen Depressive Störungen, „Schulabsentismus“ und Suchterkrankung zu sein. (Diese Schilderung folgt allein meiner subjektiven Wahrnehmung. Eine Auskunft der Klinik zur Häufigkeit von Einweisungsgründen und Diagnosen konnte mir auf Nachfrage nicht gegeben werden.)
Wie im Einleitungskapitel schon erwähnt, gehören Angststörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Depressionen und Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS) zu den häufigsten Diagnosen bei Kindern und Jugendlichen. Baierl[18][18] beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche in dieser Lebensphase mindestens einmal depressiv werden mit 12 % für die Jungen und 20 % für die Mädchen. Damit seien zu einem beliebigen Messzeitpunkt zwischen 4 % und 8 % der Jugendlichen als depressiv einzustufen.
Um die Bedeutung dieser Zahlen zu werten, sollte man sich vor Augen halten, dass „bereits während...