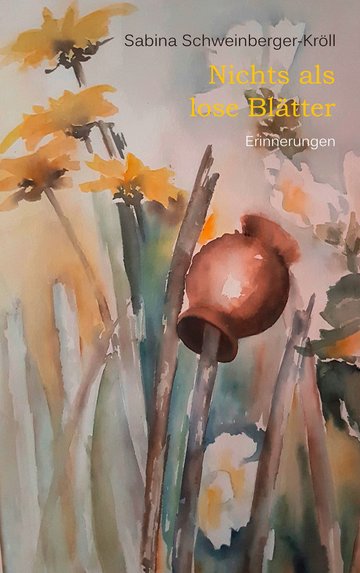Kindheits-Missgeschicke
Ein Ereignis, eigentlich war es ja ein Unglück, das mir im wahrsten Sinne des Wortes Schmerzen bereitet hat, ist mir fest in Erinnerung geblieben. Nicht nur ich, sondern alle haben darunter gelitten.
Es war ein schöner Tag. Die Sonne heizte vom Himmel herunter, und die Großmutter wollte im Küchengarten Kräuter pflücken und ich sollte ihr helfen. Die Kamillen blühten und dufteten, der Wermut, der Eibisch und die Minzen waren schon in den Leinensäcken auf dem Dachboden, der Kümmel hing, in ganzen Stauden in ein schleißiges (vom vielen Waschen fadenscheinig gewordenes) Leinentischtuch gebunden, auch dort. Daneben befand sich ein großes Wespennest. Den Wespen beim Ankommen und Wegfliegen zuzusehen war abenteuerliche Neugierde und Ängstlichkeit zugleich. Seit dem Mittagessen war ich bei der Großmutter im Garten und half ihr, Kamille zu pflücken. Auf meine Frage, warum wir alle Pflanzen heute pflücken müssten, erwiderte sie, ich solle in den Himmel hinaufschauen. »Da schwimmen die Fischlein und das bedeutet Föhn, da kann das Wetter ganz schnell umschlagen, wenn der Tauernwind auslässt. Das wäre doch schade um den guten Tee.« Föhnwolken sind mit ein wenig Fantasie Fischlein am blauen Himmel.
Ich hatte inzwischen einen Marienkäfer entdeckt und ließ ihn über meinen Handrücken laufen. Warum der kleine rote Käfer schwarze Punkte hatte, konnte sie mir auch nicht erklären.
Die Großmutter sagte, das seien Himmelskühe, und ich dürfe den Käfern und überhaupt den Tieren, die im Garten und auf der Wiese herumkriechen, hüpfen und fliegen, ja nichts zuleide tun! Wir bräuchten sie alle.
Ob wir wohl auch die Spinnen und den Mistkäfer brauchen?, hätte ich gerne gewusst. »Ja, ganz gewiss«, war die Antwort, »der liebe Gott hat allen Tieren und Pflanzen und auch uns Menschen das Seine zugeteilt.« Sie zog ein großes rotes Taschentuch aus ihrem Kittelsack und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Da bekam ich Durst.
Liebevoll, aber bestimmt sagte sie: »Beim Brunnen drunten ist ein Haferl, geh und trink.«
Nach nicht allzu langer Zeit war ich müde und Hunger bekam ich auch.
»Ach, Mädchen!« Ich glaubte, auch so was wie einen Seufzer zu hören. »Geh hinauf in den Krautgarten und suche dir eine schöne Rübe.«
Das ließ mich die Hitze und die Kamillen rasch vergessen. Der Krautgarten war ja auch ein paradiesischer Platz. Was es da alles gab: ein langes Beet mit großen, runden Krautköpfen, von denen wir, Markus, die Tante und ich, alle paar Tage die Krautwürmer abklauben mussten, in einen Eimer tun und in den Wald hinaustragen, für die jungen Vögel, damit diese kräftig würden für den langen Flug über die Tauern in das Winterquartier. Der Ronach (rote Rübe) war schon groß, und die Blätter glänzten. Ein Beet schwarzer Rettich und ein Fleckerl Mohn für den Scheiterhaufen (ein süßes Gericht) gab es ebenfalls, genauso wie zwei oder mehr Beete Runkelrüben für die Schweine, dann kam der »Rübenfleck«, gleich daneben standen die Bohnen (Saubohnen). Diese und das Beet mit den Früh-Erdäpfeln lieferten uns um diese Zeit reichlich Nahrung zum Abendessen.
Ich untersuchte das Rübenbeet gründlich, bis ich die größte fand. So eine frisch aus der Erde gezogene weiße Rübe war etwas ganz Gutes. Das Exemplar schleppte ich zur Großmutter.
»Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass du so lange weg gewesen bist. So eine große Rübe findet man nicht so schnell.« Sie nahm die Frucht ganz eng am Strunk und drehte die Blätter ab, dann wusch sie sie im Traufenwasser, das in einem Bottich aufgefangen wurde. Aus den unergründlichen Tiefen ihres Kittelsackes holte sie einen Veitl – ein Taschenmesser, das noch in der Steiermark in Handarbeit hergestellt wird. Dieser Veitl hatte Tradition, er war billig und erfüllte seinen Zweck, sogar Veitl-Clubs gab es – und schälte die Rübe so, dass sie aussah wie eine riesige Margerite, nur mit einem schneeweißen Kopf. Sie schnitt mir ein Stück von dieser Rübe ab.
Ehe sie sich versah, weinte ich lauthals: »Ich will die ganze, ich will die ganze!«
Vermutlich wurde es ihr zu viel, sie drückte mir das Stück von der Rübe in die Hand und sagte recht nachdrücklich: »Auf dem Balkon, wo deine Puppe schläft, ist jetzt Schatten, geh zu ihr, sie braucht dich auch.«
Dieser Ton duldete keinen Widerspruch, also ging ich auf den Balkon. Die Puppe lag in ihrem Bettchen und hatte die Augen zu, also schlief sie.
Oberhalb vom Haus, bei den zwei großen Kirschbäumen, mähte Markus Gras für die Heimkuh. Die Kuh nannte man so, weil das Tier alleine daheim im Stall war und die Familie mit ihrer Milch versorgte. Die anderen Rinder und Schafe waren alle auf der Alm.
Flugs hatte ich Großmutters Anordnung vergessen. Ich lief zu Markus hinauf, nahm den kleinen Rechen neben dem Korb und rief: »Ich reche das Gras zusammen!«
Und schon passierte es: Ich lief einfach in die Sense. Wie es genau geschah, wusste ich nicht, und Markus wusste es auch nicht. Blut floss aus meinem linken Bein oberhalb vom Knöchel. »Moid, Moid!«, schrie Markus ganz laut.
Ich erinnere mich nur noch an einen großen Mann mit einer weißen Schürze und an ganz helle Lampen.
Meine Mama, ihre älteste Schwester namens Moid, der taubstumme Knecht Mathias und Markus – ein etwas geistig behindertes Annehm-Kind, damals 13 Jahre alt –, sie alle brachten an diesem Tag Heu ein. Als sie fast fertig waren, schickten sie Markus einen Korb voll Gras mähen und diesen für die Heimkuh in den Stall bringen. Wie sich das Weitere an diesem verhängnisvollen Sommertag abspielte, erzählten mir später meine Mama, meine Großmutter und die Tante.
Mama trug mich in das Haus, legte mich in der Stube auf die Bank, lagerte das Bein ganz hoch und band es mit einem breiten Stück Stoff unterhalb vom Knie ab, sodass die Blutung ein wenig nachließ.
Die Tante lief nach Neukirchen, um den Doktor zu holen. Damals gab es nur einen Karrenweg zu uns auf den Berg. Es gab keine andere Möglichkeit, in das Tal, in den Ort oder von da zu uns heraufzukommen, als zu Fuß oder zu Pferd. Die Gehzeit beträgt – immer noch – eine Stunde!
Mama schickte Markus nach Rechtegg, um »die Göden und den Göden« zu holen. Das waren meine Taufpaten. Der Göden war Mamas Bruder.
In der Kammer schob sie ein Bett in die Mitte, legte Leintücher bereit und richtete alle Petroleumlampen, die im Hause waren.
Es ging schon gegen Abend zu, als der Doktor und die Tante zu Fuß auf Moosen ankamen.
Die Großmutter hatte heißes Wasser bereitet und betete ganz verzweifelt.
Da nie etwas stehen blieb und alles weiterging, vollendeten Markus und Mathias (»der Hiasl« genannt) die Arbeit für diesen Tag alleine. Wie Markus zumute sein musste, kann sich wohl keiner vorstellen. Die Kuh bekam trotzdem ihr Futter und wurde gemolken, die Hühner und Schweine versorgt.
Der Doktor nähte mein Bein, das oberhalb vom Knöchel bis auf den Knochen durchgeschnitten war, zusammen, alle Sehnen und Blutgefäße, so wie sie zusammengehören. Er vollbrachte ein wahres Kunststück unter so erschwerten Umständen, es gab keine Narkose und nur Petroleumlicht, der Operationstisch war ein Bett mit Strohsack und einem Leinentuch darüber.
Der Doktor meinte: »Wenn das Kind nicht die hohen Rindslederschuhe fest gebunden getragen hätte, wäre wohl auch der Knochen arg beschädigt gewesen. Da wüsste ich nicht, was ich getan hätte …« Diesem Doktor Fuchs verdanke ich, dass mein Bein ganz heil wurde und außer einer langen Narbe nichts zurückblieb. Dr. Fuchs war damals ein junger Gemeindearzt.
Selbst nach dem fünften Monat wollte die Wunde auf der Innenseite des Beines einfach nicht heilen, ganz dick und blau wurde es, und immer wieder kam Eiter heraus. Alle waren verzweifelt.
Mama fragte die Mitterhaus Theres, eine Tante und Salbenmacherin und überhaupt eine kräuterkundige Frau, um Rat. Diese meinte, da sei halt noch ein Faden drin.
Der Doktor stimmte dieser Diagnose zu und bat die Theres: »Probiere es mit deiner Salbe!« Drei Tage blieb die Theres bei uns und wechselte am Tag alle Stunde das Pflaster. Das Bein wurde ganz dünn, wie ausgeronnen.
Der Verdruss von Mama, Großmutter und Tante wurde immer größer.
›Wenn nur das Bein nicht abgenommen werden muss!‹, war die größte Sorge. Am dritten Tag kam aus der Wunde etwas Helles heraus, das sich nicht wegwischen ließ. Die Theres probierte mit den Fingern, daran zu ziehen. Ich sehe das heute noch vor mir, auf dem Küchentisch sitzend. Das ging so nicht. Kurzerhand holte die Theres ein Zangerl (eine kleine Zange, wie sie Feinmechaniker verwenden) aus der Tasche und zog damit einen Faden mit einem dicken Knopf daran heraus. Es hat höllisch wehgetan.
»Das war es«, erklärte sie,...