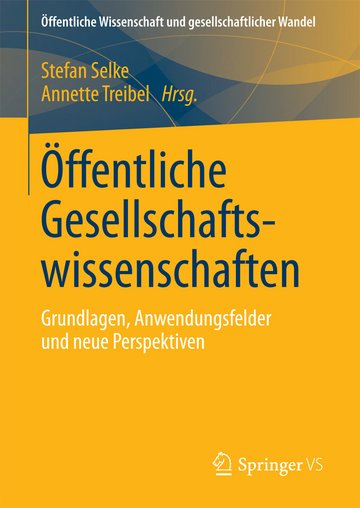| Inhalt | 6 |
| 1Relevanz und Dilemmata Öffentlicher Gesellschaftswissenschaften – ein Dialog über Positionen | 10 |
| Zur Relevanz Öffentlicher Wissenschaft | 11 |
| Dilemmata und Risiken | 20 |
| Persönliche Grenzen und Zielsetzungen | 24 |
| I Verortungen | 27 |
| 2 Öffentliche Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation & Co. Zur Kartierung zentraler Begriffe in der Wissenschaftskommunikationswissenschaft | 28 |
| 1 Begriffsvielfalt in der externenWissenschaftskommunikation: Babylon ist überall | 29 |
| 2 Wissenschaftspopularisierung | 31 |
| 3 Öffentliche Wissenschaft | 35 |
| 4 (Externe) Wissenschaftskommunikation | 39 |
| 5 Terminologisches Tableau und Ausblick | 42 |
| Literatur | 45 |
| 3 Öffentliche Wissenschaft.Von ‚Scientific Literacy‘ zu ‚Participatory Culture‘ | 50 |
| 1 Einleitung | 51 |
| 2 Begriffe der institutionellen Wissensvermittlung: Wissenschaftskommunikation und Öffentliche Wissenschaft | 52 |
| 3 Der lange Weg der Öffentlichen Wissenschaft | 55 |
| 4 Öffentliche Wissenschaft im Internet: Konvergenz der Wissensvermittlungstypen? | 60 |
| 5 Fazit: Wissenschaft der Öffentlichen Wissenschaft – Eine notwendige Disziplin | 64 |
| Literatur | 65 |
| IIÖffentliche Wissenschaft und (neue) Medien | 68 |
| 4Diebe, Drängler, Sensationen. Ein Praxisbericht aus der Wissenschafts-PR | 69 |
| 1 Debatten zur Wissenschaftskommunikation | 69 |
| 2 Business as usual | 74 |
| 3 Zusammenprall der Kulturen | 75 |
| 4 Haltet die Diebe! | 78 |
| 5 Sensationen | 80 |
| 6 Und nun? | 82 |
| Literatur | 83 |
| 5Public Sociology 2.0. Das Soziologiemagazin als öffentliches Fachportal im Social Web | 85 |
| 1 Zur Einführung | 86 |
| 2 Zum Begriff von Öffentlichkeit | 87 |
| 2.1 Entstehung und Potential gegenwärtiger Öffentlichkeit | 87 |
| 2.2 Öffentlichkeit und Social Media | 89 |
| 3 Das Soziologiemagazin als Praxisbeispiel ÖffentlicherSoziologie | 90 |
| 3.1 Das Soziologiemagazin: Print und E-Journal | 91 |
| 3.2 Internetauftritt mit Blogseite | 92 |
| 4 Zwischen Dialog und Diskurs: Betrachtungen zur Öffentlichen Wissenschaft | 94 |
| 5 Fazit: Kampf um Anerkennung und Singularität | 97 |
| Literatur | 98 |
| 6Öffentlichkeit, Soziologie und digitale Selbstdarstellung | 100 |
| 1 Öffentliche Soziologie und Personenwebpages | 101 |
| 2 Lehren aus der Verwendungsdebatte für die Öffentliche Soziologie | 104 |
| 3 Digitale Selbstdarstellung | 109 |
| 3.1 Selbstdarstellung und Personenwebpages | 110 |
| 3.2 Das Spannungsfeld digitaler Selbstdarstellung | 112 |
| 3.3 Disziplinäre öffentliche Selbstdarstellung | 116 |
| 4 Digitale Öffentliche Soziologie | 117 |
| Literatur | 120 |
| 7Expertin, Materiallieferantin, Projektionsfläche. Erfahrungen als Öffentliche Soziologin in den Medien | 123 |
| 1 Öffentliche Soziologie im persönlichen Praxistest | 124 |
| 2 Eigendynamik einer Buchrezeption | 126 |
| 2.1 Intentionen | 126 |
| 2.2 Aufmerksamkeit zwischen Null und Hundert – die erste Rezeptionsphase | 127 |
| 3 Interviewerfahrungen | 129 |
| 3.1 Die Jagd nach dem O-Ton: Wenn von 60 Minuten Interview zehn Sätze übrigbleiben | 129 |
| 3.2 „Annette Treibel, die Integrationsantreiberin“ – Bauchschmerzen über Headlines und Catchwords | 130 |
| 3.3 Kontrollverluste und Selbstvergewisserung: Aufwand und Ertrag von Interviews | 132 |
| 4 Erregungsmuster in den sozialen Netzwerken – Auswirkungen einer dpa-Meldung in der zweiten Rezeptionsphase | 135 |
| 4.1 „Quasselmösen“, „Gender-Gaga-Frauen“, „Überstudierte Frauen» – Wissenschaftlerinnen-Bashing im Internet | 136 |
| 4.2 „Ich wollt’s mir ja verkneifen, aber es gelingt mir schon physiologisch nicht“ – gewollter Kontrollverlust eines Fachkollegen | 140 |
| 5 Öffentliche Soziologie – wie und wozu? | 143 |
| 5.1 Wer braucht und will Öffentliche Soziologie? Scheinbare und tatsächliche Bedarfe | 143 |
| 5.2 Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven der Öffentlichen Soziologie – fünf Statements für die weitere Diskussion | 144 |
| Literatur | 147 |
| IIIAusgewählte Formate Öffentlicher Wissenschaft | 149 |
| 8Vortragserfahrungen – über vertane Chancen der Öffentlichen Soziologie | 150 |
| 1 Burawoy und die Wirklichkeit | 151 |
| 2 Situationen, kommunikative Gattungen, Genres und Textsorten | 151 |
| 2.1 Öffentliche Äußerungen als kommunikative Gattungen | 152 |
| 2.2 Die Vielfalt der Vortragskategorien | 153 |
| 2.3 Die Trivialisierungsangst der soziologischen Community | 154 |
| 3 Engagiertheitssoziologie und Orientierungsverlangen | 155 |
| 3.1 Aufmerksamkeit für die Nachfrageseite | 157 |
| 3.2 Das Orientierungsverlangen der Leute | 158 |
| 4 Typische Komplikationsszenarien nach Vorträgen | 159 |
| 4.1 „Horizont“ als Vortragsvoraussetzung | 161 |
| 4.2 Die thematische Selektivität der Öffentlichkeit | 162 |
| 4.3 Die Anschlussfähigkeit von Wissensbeständen | 165 |
| 4.4 Diverse Publika mit unterschiedlichen Ansprüchen | 166 |
| 5 Der öffentliche Vortrag als performativer Akt | 168 |
| 6 Resümee | 169 |
| Literatur | 169 |
| 9Die Versinnbildlichung von Gesellschaftswissenschaft. Herausforderung Science Slam | 171 |
| 1 Heutige Herausforderungen der öffentlichen Kommunikation von Wissenschaft | 172 |
| 2 Das Dilemma der Wissenschaftskommunikation | 174 |
| 3 Entwicklungen der Wissenschaftskommunikation und des Science Slam | 179 |
| 4 Der soziologische Austausch mit nicht-wissenschaftlicher Öffentlichkeit | 184 |
| Literatur | 186 |
| 10 Öffentliche Soziologie erprobt am Format des Science Slams. Eine Praxisreflexion | 189 |
| 1 Die Ausgangssituation und zwei Vorschläge | 190 |
| 2 Die Idee | 192 |
| 3 Der Science Slam als soziales Phänomen11 | 194 |
| 3.1 Zur Entstehung und Entwicklung des Science Slams | 194 |
| 3.2 Allgemeine Charakteristika und Kennzeichen des Science Slams | 194 |
| 3.3 Der Ablauf eines Science Slams | 197 |
| 4 Burawoys vier Soziologien in Bezug auf den Science Slam | 200 |
| 4.1 Kritische Soziologie | 200 |
| 4.2 Professionelle Soziologie | 203 |
| 4.3 Öffentliche Soziologie | 204 |
| 4.4 Angewandte Soziologie | 206 |
| 5 Fazit | 206 |
| Literatur | 208 |
| 11 Erwachsenenpädagogische Betrachtungen des Veranstaltungsformats Science Slam. Möglichkeit der zielgruppenspezifischen Wissenschaftskommunikation | 210 |
| 1 Gesellschaftspolitischer Kontext und erwachsenenpädagogischer Forschungszugang | 211 |
| 2 Öffentliche Wissenschaften durch Wissenschaftskommunikation | 212 |
| 2.1 Science Slam als Format der Wissenschaftskommunikation | 214 |
| 3 Erwachsenenpädagogische Perspektive auf Öffentliche Wissenschaften | 216 |
| 3.1 Science Slam als erwachsenenpädagogische Lernkultur | 217 |
| 4 Annäherung an eine erwachsenenpädagogische Grundlegung | 218 |
| Literatur | 221 |
| IV Anwendungsfelder und disziplinäre Perspektiven | 224 |
| 12Klimawandel: Praktiken der Wissensproduktion in deutschen Verwaltungen | 225 |
| 1 Einleitung | 226 |
| 2 Wissen und Wissensproduktion | 227 |
| 3 Klimawandel in der Stadtplanung | 229 |
| 4 Praktiken der Wissensproduktion in der Stuttgarter Stadtplanung | 230 |
| 5 Praktiken der Wissensproduktion in der Frankfurter Stadtplanung | 232 |
| 6 Fazit | 234 |
| Literatur | 235 |
| 13 „Amtliche“ Wissenschaft im Schnittfeld verschiedener Öffentlichkeiten. Das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge | 237 |
| 1 „Topthema“ Migration und eine staatliche Institution im Umbruch | 238 |
| 2 Entstehung und aktuelle Gestalt der Forschung im Bundesamt | 239 |
| 3 „Amtliche“ Migrations- und Integrationsforschung als Öffentliche Wissenschaft | 242 |
| 4 Ein Beispiel: Die Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ (2009) | 245 |
| 5 Fazit | 249 |
| Literatur | 250 |
| 14Öffentliche Wissenschaft, Modus 3 und die Vielfalt der Forschungs- und Lernorte | 254 |
| 1 Wissenschaft als abgeschlossener Sektor? | 255 |
| 2 Beschränkungen Öffentlicher Wissenschaft | 256 |
| 3 Modus 3 | 257 |
| 4 Beispiele für Wissenschaft im Modus 3-Verständnis | 260 |
| 4.1 Beispiel Schanze: Forschendes Lernen | 260 |
| 4.2 Beispiel Initiativen: Partizipatives Lernen | 263 |
| 5 Öffentliche Wissenschaft, Hochschule und Bildung | 265 |
| Literatur | 266 |
| 15 Forschungsnetzwerke als Öffentlichkeitskatalysatoren für die Wissenschaft. Wissenschaftskommunikation und Politikinformation am Beispiel des internationalen Netzwerks Population Europe | 267 |
| 1 Die Herausforderungen moderner Wissenschaftskommunikation und Politikberatung | 268 |
| 2 Das Netzwerk | 271 |
| 3 Kommunikations- und Dialogformate im Netzwerk | 274 |
| 4 Bündelung von Forschungskompetenz und Kommunikationsstrategien | 277 |
| 5 Netzwerkgestützte Wissenschaftskommunikation am Beispiel einer Wanderausstellung | 279 |
| 6 Zusammenfassung und Ausblick | 282 |
| Literatur | 284 |
| 16 Öffentliche Geographie? Zur Praxis der Wissensvermittlung Geographischer Gesellschaften | 286 |
| 1 Gesellschaftlicher Rahmen der Wissenschaft | 287 |
| 2 Öffentliche Wissenschaft – Öffentliche Geographie | 288 |
| 3 Die Rolle der Geographischen Gesellschaften für die Disziplin der Geographie | 291 |
| 4 Zur Praxis der Wissensvermittlung in den Geographischen Gesellschaften | 293 |
| 4.1 Die Selbstdiagnose durch VertreterInnen der Geographischen Gesellschaften | 294 |
| 4.2 Empirische Ergebnisse | 295 |
| 5 Schlussfolgerungen – Kultur und Struktur in der Wissensvermittlung | 299 |
| 5.1 Disziplinübergreifende Schlussfolgerungen | 300 |
| Literatur | 301 |
| 17 Die Ko-Produktion von Wissen in der Partizipativen Gesundheitsforschung. Folgen für die Forschungspraxis | 304 |
| 1 Einleitung: Das Feld der Partizipativen Gesundheitsforschung | 305 |
| 2 Gesundheit und Partizipation | 306 |
| 3 Methodologische Konsequenzen | 307 |
| 3.1 Wissensordnungen und ihre Konsequenz | 307 |
| 3.2 Forschung als kooperativer Erkenntnisprozess | 309 |
| 3.3 Macht, Reflexivität und Subjekt | 311 |
| 3.4 Qualitative oder quantitative Forschung? | 311 |
| 3.5 Geltungsbereich, Evidenz und Gütekriterien | 312 |
| 4 Methodische Konsequenzen | 313 |
| 5 Partizipative Forschung, Wissenschaftskanon und erweitertes Wissenschaftsverständnis | 314 |
| 6 Fazit oder: die Frage nach der Frage | 315 |
| Literatur | 316 |
| 18Monastische Lebensform als engagierte Wissensform | 319 |
| 1 Gelebte Öffentliche Theologie? | 320 |
| 2 Engagierter Mönch und Öffentlicher Theologe: Thomas Merton | 323 |
| 3 Lebensform: monastisch | 325 |
| 4 Öffentlicher Kontext: Engagement | 328 |
| 5 Wissensform: theologisch | 331 |
| 6 Berufung: prophetisch | 334 |
| Literatur | 336 |
| VInnovationen und Entwicklungen | 338 |
| 19 Öffentliche Soziologie als experimentalistische Kollaboration. Zum Verhältnis von Theorie und Methode im Kontext disruptiven sozialen Wandels1 | 339 |
| 1 Einleitung | 340 |
| 2 Fokus Biodiversitätsforschung | 343 |
| 3 Pragmatistische Methodologie | 344 |
| 4 Gesellschaftstheoretische Folgenabschätzung | 349 |
| 5 Fazit | 350 |
| Literatur | 351 |
| 20 Mittendrin statt nur dabei. Die Rolle der Soziologie bei der Gestaltung sozialer Innovationen | 354 |
| 1 Einleitung | 355 |
| 2 Die neue Wissensordnung und die Soziologie | 356 |
| 3 Ein neues Innovationsparadigma | 357 |
| 4 Soziale Innovation als gesellschaftliche Realexperimente | 359 |
| 5 Gestaltung koevolutionärer Lernprozesse | 361 |
| 6 Fazit | 364 |
| Literatur | 365 |
| 21 Öffentliche Wissenschaft. Forschung und Innovation (FuI) partizipativ gestalten | 368 |
| 1 Gemeinwohlorientierte Zukunftsgestaltung | 369 |
| 2 Herausforderungen der Partizipation in der Wissenschaft | 370 |
| 3 Voraussetzungen | 372 |
| 3.1 Normativer Ansatz: Forschung und Gemeinwohl | 373 |
| 3.2 Von der Scientific Literacy zur Transformativen Literacy | 374 |
| 4 Rahmenbedingungen der FuI-Strategien | 374 |
| 5 Öffentliche Wissenschaft: Von der Akzeptanz zur Wissenschaftskompetenz | 376 |
| 5.1 Akzeptanz und Wissenschaftskommunikation | 376 |
| 5.2 Warum sollten sich die Bürger für Wissenschaft interessieren? | 377 |
| 6 Integration neuer Kommunikationsschnittstellen | 377 |
| 6.1 Akteure der Zivilgesellschaft in der Öffentlichen Wissenschaft | 377 |
| 6.2 Akteure der Zivilgesellschaft als Partner einer Transdisziplinären Wissenschaft | 378 |
| 6.3 Wie kann eine systemische Wissenschaftskommunikation gelingen | 379 |
| 7 Fazit | 380 |
| Literatur | 381 |
| 22Bürgerwissenschaft zwischen Opportunismus und Opposition1 | 382 |
| 1 Bürger engagieren sich in der Wissenschaft | 383 |
| 1.1 Entwicklungslinien einer Öffentlichen Wissenschaft | 384 |
| 2 Gesellschaft und Öffentlichkeit im neoliberalen Kapitalismus | 386 |
| 3 Bürgerwissenschaft als Gesellschaftskritik | 389 |
| 3.1 Eckpunkte einer Öffentlichen Wissenschaft | 391 |
| Literatur | 394 |
| 23 Gelehrsamkeit statt Betriebsamkeit. Öffentliche Hochschulen als Werkzeuge konvivialer Gesellschaften | 397 |
| 1 Zukünftige Hochschulen für konviviale Gesellschaften | 398 |
| 2 Betriebsamkeit statt Gelehrsamkeit – Effekte übereffizienter Werkzeuge | 401 |
| 2.1 Pathologien industriegeleiteter Forschung | 402 |
| 2.2 Pathologien der Lehre: Verlust von Öffentlichkeit(en) | 405 |
| 2.3 Pathologien des Engagements: Eventisierte gesellschaftliche Verantwortung | 406 |
| 3 Visionen Öffentlicher Hochschulen | 407 |
| 3.1 Beteiligung am großen Puzzle – Öffentliche Hochschulen als Resultat gesellschaftlicher Rückkopplung | 408 |
| 3.2 Öffentliche Hochschulen als Verlängerung des Konzepts einer Public Sociology | 411 |
| 4 Öffentliche Hochschulen in konvivialer Zukunftsperspektive | 415 |
| 4.1 Dienende Funktion durch öffentliches Wissen und Förderung sozialer Innovationen | 417 |
| 4.2 Wissensintegration und Lehre in freiwilliger De-Privilegisierung | 418 |
| 4.3 Schutz- und Bildungsfunktion in marktfreien sozialen Räumen | 420 |
| 5 Von Nutzen- zu Wertszenarien – Probieren geht über Studieren | 421 |
| Literatur | 423 |
| AutorInnenangaben | 426 |