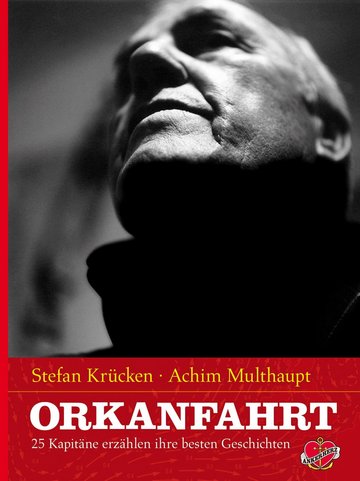Wer so lange zur See gefahren ist wie ich, erkennt einen Sturm an seinem Klang. Bis 9 Beaufort ist es ein Brüllen, ab 11 Beaufort ein Stöhnen. Je stärker ein Sturm, desto tiefer seine Stimme, das ist die Regel. Was ich jetzt auf der Brücke der Svea Pacific höre, macht mir Sorgen. Von draußen dringt ein schwingender Ton herein, ein dumpfes Brummen, wie von einer gewaltigen Orgel.
Der Nordatlantik ist so aufgepeitscht, dass man vor der Scheibe nur noch eine graue Wand sieht. Gewaltige Brecher krachen aufs Deck, das Schiff erzittert unter jedem Schlag, arbeitet schwer in seinen Verbänden. Der Stahl schreit regelrecht, wie ich es noch nie in meinem Leben gehört habe.
Manche Wellen sind 20 Meter hoch, sie heben und senken die Svea Pacific, einen Massengutfrachter von 2509 Bruttoregistertonnen, 88 Meter lang, 15,5 Meter breit, wie ein Spielzeug. »Herr Kapitän, gehen Sie bitte schnell in den Salon«, ruft der Erste Offizier, der gerade auf die Brücke kommt. Ich übertrage ihm das Kommando und nehme die Treppe. Der Salon liegt ein Deck tiefer, darin ein Konferenztisch, Metallstühle, die in den Boden geschraubt sind, ein Fernseher, die Wände sind mit braunem Resopal getäfelt.
Vor den Fenstern hat sich die Mannschaft versammelt und starrt hinaus, obwohl es nichts zu sehen gibt. 13 Mann, alle stammen von den Philippinen. Sie tragen Rettungswesten. Ihre Gesichter sind bleich vor Angst, einige wirken abwesend, wie betäubt. Der Zweite Offizier, er heißt Garcia, zeigt keine Reaktion, als ich ihm meine rechte Hand auf die Schulter lege. Sie fürchten um ihr Leben, und damit liegen sie nicht einmal falsch. Ich bin auch nicht sicher, ob wir die nächsten Stunden überleben werden.
Da fällt mir eine Kassette ein, die mir meine Frau Siggi mitgegeben hat: Country-Musik, die höre ich so gerne, Johnny Cash. Ich drehe die Musik so laut auf, wie es nur geht. Johnny Cash singt:
How high’s the water, mama? / Two feet high and risin’ / How high’s the water, papa? / Two feet high and risin’
Ich pfeife dazu die Melodie, als liefen wir an einem Sommertag durch ruhige See und nicht mitten durch die Vereinigung eines furchtbaren Tiefdruckgebiets mit dem Hurrikan Grace – eine Konstellation, die manche Meteorologen später »Monsterorkan« oder »Jahrhundertsturm« nennen werden. Sogar Hollywood hat einen Film darüber gedreht, Der Sturm mit George Clooney in der Hauptrolle; sehr realistisch übrigens, ich habe mir das auf Video angesehen.
»Ach was Männer, stellt euch nicht so an«, brumme ich und versuche, so gleichgültig wie möglich zu klingen, »ihr müsst erst mal im Winter durch die Biskaya fahren, da habt ihr jeden Tag so ein Wetter!«
In dem Moment kommt der Erste Ingenieur Thode herein – ohne Rettungsweste, wie ich erleichtert feststelle – und nickt mir zu. Er fragt auf Deutsch: »Käpten, mal ehrlich, meinen Sie, dass wir es schaffen?« Chief Thode ist groß und stämmig gebaut, mit einem dichten Vollbart im Gesicht, er sieht aus wie der kleine Bruder eines Grizzlybären. Er fragt und grinst dabei, als habe er gerade einen schmutzigen Witz erzählt, denn die Mannschaft darf bloß nichts mitbekommen. Eine Panik ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können.
Ich lächle zurück: »Chief, sieht nicht gut aus.«
Thode dankt, dann sagt er auf Englisch zur Crew: »Der Kapitän hat Recht, in der Biskaya ist es noch schlimmer.« Dann grinsen wir beide um die Wette. In Hollywood hätte das Clooney auch nicht besser hingekriegt.
Als Kapitän muss man manchmal Schauspieler sein, das gehört zum Beruf. Meine wahren Gefühle darf ich nicht zeigen: Ungewissheit, Zweifel, davon soll keiner etwas merken. Um es ganz klar zu sagen: Ich glaube von Minute zu Minute weniger daran, dass wir diesen Sturm überstehen.
Seit dem 19. Oktober 1991 sind wir nun auf See, ausgelaufen von Houston in Texas, mit 3393 Tonnen Baustahl an Bord. T-Träger für Liverpool, ein Hochhaus soll damit gebaut werden. Bis hinauf zur Lukenabdeckung sind die Laderäume gestaut, zum Glück. Denn egal, wie stark sich das Schiff auf die Seite legt, die Ladung kann nicht kippen, nicht »übergehen«, wie man in der Seefahrersprache sagt.
Nach einer Woche erreicht uns die Nachricht, dass sich der Hurrikan Grace hinter uns mit hoher Geschwindigkeit nähert. Mit voller Kraft laufen wir vor ihm her, verfolgt von seinen Wellen, als unser Funker am Morgen des 27. Oktobers noch ein gewaltiges Sturmtief meldet. Es vergrößert sich nahe Neufundland und bewegt sich mit 33 Knoten nach Südwesten. Den Berechnungen nach würde es zwar unseren Kurs kreuzen, aber ein ganzes Stück vor uns durchziehen.
28. Oktober, 6 Uhr. Alles anders, als Wetterbericht und Berechnungen versprochen hatten. Das Sturmtief nähert sich viel langsamer, mit einer Geschwindigkeit von nur noch fünf Knoten in der Stunde. Eine erschreckende Nachricht: Wir laufen also mitten hinein in den gewaltigen Sturm.
Mein ganzes Leben fahre ich zur See, seit 1952, da war ich 16. Als Kapitän habe ich Schiffe jeder Größe befehligt. Vor Monrovia wurde mein Frachter einmal von Piraten überfallen, in Madagaskar gerieten wir mitten in eine Revolution; im Hafen von Lagos habe ich mehrere Leichen vorbeitreiben sehen. Einmal hat mich ein Taifun erwischt, Kurs Honolulu, und zwar so heftig, dass sich die chinesische Mannschaft vor Panik in ihren Kabinen einschloss. 24 Stunden bevor die Taifun-Warnung der Wetterberatung eintraf, hatte ich aus einem komischen Gefühl heraus den Kurs um 180 Grad geändert. In der modernen Seefahrt werden die Schiffe – ähnlich wie Flugzeuge in der Luftüberwachung – von Seewetterämtern über die Meere gelotst, die Reedereien geben dafür viel Geld aus. In unserem Fall aber kam die Warnung viel zu spät, und ohne den radikalen Kurswechsel wären wir verloren gewesen.
Mich kann so schnell nichts beunruhigen, aber als ich den Wetterbericht studiere, zieht es mir den Magen zusammen.
28. Oktober, 14 Uhr. Der Sturm schickt seine ersten Boten, die Dünung nimmt stetig zu. Unser Schiff beginnt stark zu rollen, 20 Grad nach Backbord, 20 Grad nach Steuerbord. Die Svea Pacific ist ein solides Schiff, das alles laden kann: Erz, Stahl, Container. Aber sie ist Baujahr 1980, was für einen Bulkcarrier, der stark beansprucht wird, ziemlich alt ist. Obendrein ist sie reif für die Werft; die Luken sind nicht mehr ganz dicht.
Ich gebe Anweisungen, das Schiff für den Sturm klarzumachen. Alle Bullaugen werden geschlossen, was noch an Deck, in der Küche oder der Messe herumliegt, wird verstaut. Der Maschinenraum wird abgeschlossen; ab sofort darf ihn nur noch der Chief betreten. Man nennt das »wachfreien Betrieb«, die Maschine wird dann von der Brücke aus gefahren. Am Abend brist der Wind aus südwestlicher Richtung auf, Windstärke acht, zunehmend. Die Wellen sind bereits an die acht Meter hoch. Ich lasse die Deckbeleuchtung einschalten und die ganze Nacht brennen, um im Schadensfall sofort reagieren zu können.
29. Oktober, 12 Uhr. Schwerer Sturm, mindestens 11 Beaufort. Das Barometer fällt weiter, unter 1000 Millibar, was bedeutet, dass der Orkan an Stärke weiter zunehmen wird. Schwere Brecher schlagen von steuerbord über das Deck und die Luken, ich muss den bisherigen Kurs aufgeben und beidrehen. Wir laufen jetzt frontal gegen die Wellen, mit einer Geschwindigkeit, die so weit reduziert ist, dass die Svea Pacific gerade noch steuerfähig bleibt: Man legt sich mit dem Bug in den Wind und bietet möglichst wenig Angriffsfläche, wie ein Pfeil. Den Sturm »abreiten« nennt man das.
Am Nachmittag messen wir Orkanstärke 12, nun ist es, als fahre man durch einen Suppenkessel. Die Wellen kommen in merkwürdig kurzen Abständen; je kürzer die Periode ist, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie brechen. Sie prügeln auf uns ein wie Fäuste aus Wasser. Der Ozean spielt mit uns, wirft uns hin und her, so geht das in den Abend und weiter, die ganze Nacht.
Jeder, der nicht auf der Brücke seinen Dienst verrichtet, hält sich in diesen Stunden irgendwo fest; man versucht, sich gegenseitig Mut zu machen. Es ist auch ein Nervenspiel. Normale Mahlzeiten werden nicht mehr eingenommen, der Smutje öffnet ein paar Konservendosen, Fisch, Ananas, Corned Beef, solche Sachen. Als Kapitän ist man sowieso die ganze Zeit auf der Brücke. Ich trinke Kaffee, kannenweise Kaffee, und knabbere einen Schokoladenriegel nach dem anderen, das gibt Energie und beruhigt die Nerven.
30. Oktober, gegen 11 Uhr, Position 41˚ Nord und 57˚ West: Das Barometer ist auf 985...