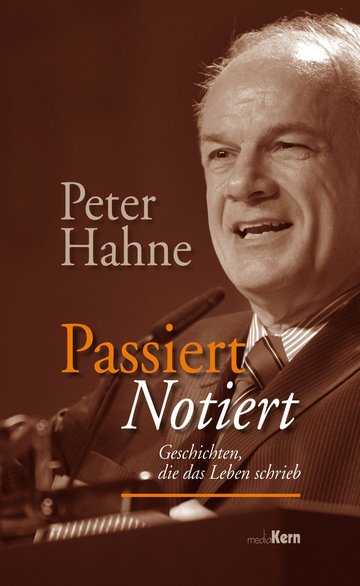Vom Bülowbogen nach Sommerfeld
Auf dem Weg vom Hauptstadtstudio nach Hause fuhren wir gerade am U-Bahnhof Gleisdreieck vorbei, als der Taxifahrer meinte: »Na, Sie haben’s aber an der Hüfte …« Da brauchte er nicht viel Fantasie, so hatte ich mich in seinen Wagen gequält. Seit Monaten kämpfte ich gegen heftigen Schmerz besonders auf der linken Seite. Beim Aussteigen zu Hause half er mir und riet: »Lassen Sie’s operieren, ich habe es gerade auf beiden Seiten hinter mir und bin jetzt ohne Beschwerden.« Dann gab er mir den entscheidenden Tipp: die Sommerfeld-Klinik in Brandenburg. »Das brauche ich mir noch nicht mal aufzuschreiben«, entgegnete ich. Wir waren ja gerade dort vorbeigekommen: am Drehort der legendären Arztserie »Praxis Bülowbogen«, in der der große Schauspieler Klaus Schwarzkopf den Penner »Gleisdreieck« spielte, benannt nach dem U-Bahnhof.
Eine klassische Berliner Arztpraxis der 1970er-Jahre in einer normalen Altbauwohnung mit quietschendem Parkett und Stuck an der Decke und einem Wartezimmer voller skurriler Berliner Originale. Das war noch Fernsehen! Anita Kupsch spielte die immerwährende Sprechstundenhilfe, wie man sich das beim »Landarzt« so vorstellt. Auch sie machte übrigens wie ich Urlaub auf der Bettmeralp im Wallis. Günter Pfitzmann spielte den Arzt Dr. Peter Brockmann, der dann von Rainer Hunold alias Dr. Peter Sommerfeld abgelöst wurde. Der dritte Peter konnte sich das also über diese Eselsbrücke leicht merken: »Ich schaue gleich mal im Internet nach.«
Sommerfeld – nur 30 Minuten von Wilmersdorf entfernt an der Autobahn nach Hamburg, von der Abfahrt tief in den Wald hinein: die ehemalige Berliner Lungenheilstätte. Das ganze Ensemble, original Kaiser Wilhelm, denkmalgeschützt und tipptopp modernisiert. Ich googelte die Bewertungen: alles bestens. Na gut, ich frage mal meine Professoren-Freunde von der Charité um Rat, es eilt ja nicht … Nächster Montag: Der »Focus« listete die 100 besten Ärzte und Kliniken für Hüft- und Kniegelenke auf, Sommerfeld unter den Top Ten. Zufall?
Ich sollte mit meiner Hüft-Geschichte noch öfter erleben, dass Zufall wirklich nichts anderes ist als ein Pseudonym Gottes. Ich machte Nägel mit Köpfen und schrieb den Klinikchef Professor Andreas Halder an. Prompte Antwort am Telefon in militärischer Kürze und mit Berliner Schnauze: »Na, dann kommse mal.«
Als Erstes war Röntgen dran, ich hatte mich ja noch nie untersuchen lassen. Die freundliche Schwester sagte nach dem »Fotografieren«: »Ach, ich bewundere Sie so, Herr Hahne.« Ich strahlte sie an und dachte, sie meinte das Fernsehen. Doch sie stellte nur lapidar fest: »Sie müssen die letzten fünf Jahre doch unheimliche Schmerzen gehabt haben.« Stimmt!
Dann der Professor – eingerahmt von zwei Assistenten, die mich schon ganz mitleidig anschauten, als bangten sie um mein Leben, die bedauernswerten Bilder vor sich auf ihren Laptops. Ohne irgendwelchen Small Talk schaute er mich an, dann wieder die Bilder und stellte folgende eindrucksvolle Diagnose: »Alles Schrott! Alles im Eimer! Da müssen wir ran!« Dabei hatte ich noch seine Worte im Ohr: »Eine Operation ist immer das Allerletzte, was infrage kommt«, obwohl er damit ja sein Geld verdient. Dieses Allerletzte war nun eingetreten und wir vereinbarten den ersten OP-Termin für den historischen 17. Juni, unvergessen. Dann hatte ich meine Pensionierung hinter mir und Zeit genug. Nur der Südtirol-Urlaub, ohnehin für den Wanderer eine Qual, musste weichen.
Wie ein Lauffeuer verbreitete es sich unter Kollegen, in den Gemeinden und bei Vorträgen: »Hahne kriegt neue Hüftgelenke.« Es war ja auch kaum zu übersehen, wie nötig das war – obwohl ja bekanntlich nichts alternativlos ist. Das sehen nur Illusionspolitiker in ihrer abgesicherten Parallelgesellschaft anders. Merkels Satz »Wir schaffen das« kommentierte ich am selben Abend: »Das habe ich das letzte Mal von Kaiser Wilhelm gehört.« Wir, das ist das dumme Volk, das das zu schaffen hat, basta!
Ich muss es schließlich wissen, ich bin in Minden-Ravensberg aufgewachsen, sozusagen unter dem monumentalen Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica, wo mit dem Weserdurchbruch die Norddeutsche Tiefebene beginnt. »Wo die Weser einen großen Bogen macht, wo der Kaiser Wilhelm hält die treue Wacht … Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus.« In meiner Heimatstadt Minden ist zudem Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der Große Kurfürst und preußische Herzog, mit einem Denkmal verewigt und der meinte: »Die Mindener sind meine treuesten Untertanen!« Von Alternativlosigkeit hätte der nie gesprochen, weil es ein Zeichen von Schwäche, kombiniert mit Selbstherrlichkeit, ist.
Und weil im Leben normal denkender Leute nichts alternativlos ist, hatten dann auch viele OP-Kritiker ihre »Alternative für Hahne« bereit, die Briefe und Mails könnten dieses Buch mühelos füllen. Den originellsten Gegenvorschlag hatte Professor Johannes Zeichen, Chef der Unfallchirurgie des zweitgrößten Universitätskrankenhauses von NRW, des Klinikums Minden.
Ich hatte dort den Jubiläums-Festvortrag zugesagt und er versprach mir schriftlich: »Nach Ihrem Vortrag rollen wir Sie sofort aus dem Audimax des Campus-Gebäudes in den Operationssaal und unser Team zeigt, was es kann.« Bei dem Gedanken, dass im Merkblatt der Sommerfeld-Klinik sinngemäß stand, man solle seine Patientenverfügung und den Organspendeausweis mitbringen und am besten auch noch sein Testament machen, eine echte Alternative …
Aber Spaß beiseite: Wie beim Thema Impfen gibt es regelrechte Glaubenskriege pro und kontra Operation. Auch ernst zu nehmende Fachleute unter den Christen rieten mir ab, schlugen therapeutische Übungen und homöopathische Mittel vor. Anders gestrickte Zuschauer zum Beispiel vom geschätzten MDR-Talk »Riverboat« waren da schon bei esoterischen Spökenkiekereien und dem Kaffeesatzlesen des Klabautermanns: Wenn schon eine Operation, dann aber in einer bestimmten Mondphase und keinesfalls in einem OP-Saal, der auf einer Wasserader liegt. Und es sei auch überlebenswichtig, ob das Team nun in Blau oder in Grün gewandet sei …
Als ich in den OP geschoben wurde, war mir vor der »Einschläferung« nur eines wichtig: dem Team zu sagen, »dass jetzt Hunderte in Deutschland für uns beten, damit Sie Ihre Begabung richtig zur Entfaltung bringen können«. Gott hat den Ärzten Gaben gegeben genauso wie Handwerkern, Hausfrauen, Lehrerinnen oder Moderatoren. Die gilt es abzurufen im Sinne Martin Luthers: »Heute habe ich viel zu tun, ich muss also viel beten.«
Im Internetauftritt der Sommerfeld-Klinik war mir schon das Seelsorge-Angebot aufgefallen. Bei der Aufnahme wurde ich extra noch mal darauf hingewiesen. Und an den Schwarzen Brettern steht in jeder Station: »Wir laden ein zu christlichen (!) Andachten und Gottesdiensten. Sie werden gerne dorthin gefahren.«
Und so klein ist die Welt: Der neue Leiter der christlich geführten Altmühlseeklinik Hensoltshöhe und Nachfolger meines Freundes Dr. Hans-Ulrich Linke, der Orthopäde Dr. Friedbert Herm, hat vorher in großem Segen und allgemeiner Anerkennung als Chef der Sommerfelder Reha-Klinik gewirkt. Auf allen Zimmern Bibeln!
Und das i-Tüpfelchen: Als ich mit dessen Nachfolger Dr. Volker Liefring nach der zweiten OP das Aufnahmegespräch hatte, endete das überraschend in einer Gebetsgemeinschaft. Auch er ein überzeugter Christ, bewährt und bewahrt schon in DDR-Zeiten. Für ihn war ich Patient und Bruder. Gott hat seine Leute überall.
Professor Thomas Dörner von der Charité, Blutgerinnungsexperte, freute sich an meiner Euphorie nach der ersten OP, riet mir dann aber vor der zweiten, was ich von einem relativ jungen Mediziner nie erwartet hätte: »Gehen Sie demütig in die nächste Runde.« Also nicht das hochmütige »Wir schaffen das, es hat doch bestens geklappt«, sondern ganz neu abhängig zu sein von der Qualifikation der Ärzte und der Güte Gottes. Demut! So auch mein Freund, Professor Wolfram Wermke, der wiederum Sommerfelder Ärzte ausgebildet hat. Die Welt ist klein!
Ja, übermütig sollte man nicht werden, auch wenn beide Operationen ohne Komplikationen verlaufen sind. Katrin Falkowski, zuständig für die OP-Pläne im Patientenmanagement, hat sich rührend um mich gekümmert. Zwei Sätze hat sie mir mitgegeben: »Seien Sie zunächst vorsichtig. Eine falsche Bewegung, und alles war umsonst.« Und dann, worüber ich auf den ersten Blick geschmunzelt habe: »Sie müssen erst mal eins werden mit Ihren neuen Hüftgelenken.« Aber mit dem zweiten sieht man ja bekanntlich besser! Es stimmt: Nach drei, vier Wochen habe ich überhaupt nicht mehr an die Riesenapparate gedacht, die mir da eingebaut wurden. Sie gehören jetzt dazu. Nur in der Sicherheitskontrolle des Flughafens werde ich daran erinnert. Ein Piepton als Signal, das Danken nicht zu vergessen. Vor allem auch für...