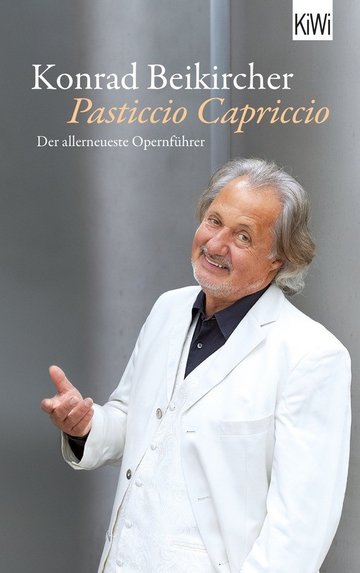Zwei große Opernmythen
1. La Scala
Jedem Opernfreund weltweit ist die Scala in Mailand ein Begriff und nicht nur das: Sie ist der Inbegriff der Oper überhaupt. Auch wer nie in der Oper war, kennt die Scala und hält sie für den Olymp der Opernwelt. Ich frage mich, woher dieser Mythos kommt und wie er entstanden ist, denn die Scala ist ein Mythos, zweifellos.
Denn: Es gibt schönere Opernhäuser in der Welt als das renovierte Teatro alla Scala (das so heißt, weil es seit 1776 auf dem Platz steht, wo bis dahin die Kirche von Santa Maria alla Scala stand), ich sage nur La Monnaie in Brüssel, die Opèra Garnier, eines der zwei staatlichen Pariser Opernhäuser, das La Fenice in Venedig, die Staatsoper Wien, von mir aus Bayreuth wegen seiner Harmonie mit der Landschaft (wenn man in die richtige Richtung schaut!), die Oper Budapest, von Juwelen wie dem Theater in Schwetzingen, in der einst Mozart auftrat, ganz zu schweigen. Es gibt musikalisch interessantere Opernhäuser als die Scala mit ihrem eher klassischen Repertoire, Häuser, die mehr wagen, mehr experimentieren, die näher am Puls des musikalischen Lebens sind (Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich Ihnen jetzt ein paar Häuser nennen werde, um in den anderen nicht mehr auftauchen zu dürfen?). Es gibt Häuser mit besseren Orchestern als es das der Scala ist (ob sie allerdings auch so gefühlvoll sein können, lasse ich mal dahingestellt), ich brauche nur Wien zu sagen, Amsterdam, London, New York oder Paris. Es gibt Opernhäuser, in denen das Publikum ihre Lieblinge noch enthusiastischer feiern kann als es die Mailänder tun, so da wären Parma, Neapel oder Buenos Aires. Allerdings sind Letztere auch die Opernhäuser, in denen die Diven und Stars gnadenlos an die Wand gebuht werden, wenn sie enttäuschen, oder in denen vierzig Hobbytenöre plötzlich aufstehen und dem Tenor da oben das hohe C entgegenschmettern, sollte es ihm ausgegangen sein (Placido Domingo soll in Parma extra danebengehauen haben, weil er das mal erleben wollte!). Da sind die Mailänder doch etwas zurückhaltender.
Das alles also kann es nicht sein, warum die Scala als das Opernhaus weltweit gilt. Dass in Mailand so vieles zusammenpasst, kann aber auch nicht der Grund für diese alles überragende Weltgeltung sein: High Society und Glamour wie in Mailand gibt es auch anderswo, vielleicht noch mehr, wenn man an Paris oder New York denkt. Selbst das etwas trampelige Bayreuth hat da einiges zu bieten und was die bizarre Seite angeht, ist das Opernfestival von Glyndebourne in der Nähe von London ja nach wie vor ungeschlagen. Sind doch die Mailänder obendrein so etwas wie die Düsseldorfer Italiens: modebewusst, aber nicht prahlerisch, laufstegsicher, aber nicht wirklich mediengeil, schrill, aber nicht neureich. Geld haben die Leute anderswo auch, sicherlich mehr als die Mailänder und ihre Oper (die ja finanziell eher »al verde« ist, also immer mal wieder das Grüne am Boden des Portemonnaies sieht), und Italianità haben die Venezianer, die Neapolitaner, die Römer oder die Sizilianer auch. Woher also kommt dieser Mythos »La Scala«? Es kam einiges zusammen, was zu ihm führte.
Sie wurde 1776 im richtigen Moment gebaut, nämlich während einer Zeitspanne, in der die Oper als Kunstgattung anfing, sich von den Adelsresidenzen und ihren »Inner-Circle-Aufführungen« zu emanzipieren. Man spielte am Anfang zwar brav seinen Paisiello und Cimarosa, also die Opera buffa napoletana, schwenkte dann aber sehr schnell auf Paër und Mayr um und damit auf die hochernste, quasi amtliche neoklassizistische, eher französische Linie. Diese bereitete den Boden für Rossini und ab der Aufführung der Zauberflöte (1816) war man aus den Kinderkrankheiten heraus (eine davon war zum Beispiel, dass die Scala auch an Zirkusleute vermietet worden war oder sogar an ein Stierkampfunternehmen, das die Bühne zur Arena verwandelt hatte – für manches Opernhaus unserer Eventgesellschaft wäre das doch eine Überlegung wert, oder?!). Jetzt wurde man die Avanguardia, die Vorhut der großen Oper. Rossini, Donizetti, Bellini: eine Uraufführung nach der anderen fand in Mailand statt. Und dann schließlich der internationale Durchbruch mit den Uraufführungen der frühen Verdi-Opern bis zum Nabucco. In derselben Zeit war die Politik des Hauses, die allerersten Sängerinnen und Sänger nach Mailand zu holen. Und sie kamen alle: von der Colbran bis zur Patti, von Pacini bis Tamagno (dem Othello der Uraufführung), selbst Fanny Elsler gab sich die Ehre und tanzte die Mailänder um den Verstand.
Es kam aber etwas ganz Wichtiges hinzu, was die Scala zum nationalen Heiligtum machte: die Einigungsbewegung in Italien, il risorgimento. Das von den Österreichern besetzte Mailand wurde immer mehr zum Zentrum des Risorgimento und als dann Verdi seinen Gefangenenchor »Va pensiero – Flieg Gedanke« schrieb (ohnehin die eigentliche italienische Nationalhymne) und dieser in Mailand erklang, wurde die lombardische Stadt der Motor, der zur Einigung führte. Diese Chöre (und Verdi kannte genau ihre politische Wirkung) haben das Gefühl, EIN Italien sein zu müssen, in alle Herzen getragen und haben darin das Feuer der Einigung entfacht. Damit wurde die Oper selbst für alle Italiener eine nationale Kunstform. Diese Koppelung der Gefühle ist heute noch spürbar (hören Sie sich mal »Nabucco« in der Aufnahme von 1949 mit der Callas an und das Inferno, das nach dem Chor losbricht, weil die Neapolitaner damals die Amerikaner loswerden wollten und einer in den Schlussakkord rief: »Viva Italia!«) – und sie ist wunderbar.
Der zweite Strang in der Geschichte, der den Mythos Scala endgültig zementierte, war die Qualität der damaligen Arbeit. Arturo Toscanini und sein unerschütterlicher Qualitätsanspruch haben aus einem Haufen Musiker ein Orchester geformt, er brachte dem Scala-Publikum Wagner und Tschaikowski nahe (von Puccini und der legendären Uraufführung der Turandot ganz zu schweigen), er holte alle großen Sänger seiner Zeit nach Mailand (die waren in der Zeit lieber in den USA und verdienten sich dort ihre goldenen Nasen) und sie kamen auch: Gigli, Lauri-Volpi, Gilda Dalla Rizza, der wunderbare Tita Ruffo, Mafalda Favero und sogar Caruso und Schaljapin. Sie standen für höchste Sangeskunst, Toscanini für unerbittliche Werktreue allerhöchsten Anspruchs und das zusammen führte zu einer Referenzaufführung nach der anderen. So entstand eine Renaissance der italienischen Oper, die Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit ihren Siegeszug antrat. (Wir erinnern uns: Speziell beim deutschen Publikum waren Opern wie Aida, Nabucco oder Lucia di Lammermoor, von Donizettis Köstlichkeiten ganz zu schweigen, als seichte Unterhaltung verschrien!) Wollte die Met, das Teatro Colon oder London oder oder … einen vernünftigen Verdi aufführen, holte man sich die Sängerinnen und Sänger, die in Mailand reüssiert hatten. So wuchs sehr schnell der Ruf der Scala als der Oper, an der man sich zu orientieren hatte, will man italienische Opern aufführen. Vollends zementierte sich dann dieser Ruf, als sich mit Furtwängler, de Sabata, Walter und Karajan die Creme der Dirigenten den Stab in die Hand gab und als Größen wie del Monaco, Tebaldi, di Stefano und schließlich die Callas in der Scala quasi zu Hause waren. Als dann auch noch Karajan, als er in den 1950er-Jahren künstlerischer Leiter der Wiener Staatsoper war, einen Vertrag mit der Scala machte, um sie zu Gastspielen an die Staatsoper zu holen, war klar: Es gibt nur eine Nummer 1 und das ist die Scala (der Name selbst ist schon Programm und klingen tuts ja auch richtig musikalisch). Fragen wir einfach nicht weiter nach (auch weil das eine sehr, sehr deutsche Eigenschaft ist), sondern genießen wir einfach, dass es so was Schönes wie die Scala gibt, machen wir unsere Reverenz vor dieser wundervollen italienischen Diva und werfen ihr Rosen zu. Sie hat es verdient.
2. Bayreuth
»Hier war alles ein schöner, tiefbegeisterter Wille«
Diesen Satz schrieb Richard Wagner in seiner vorsichtigen Bilanz der ersten Bayreuther Festspiele 1876. Im Grunde ist das auch die Erklärung für den Mythos, der Bayreuth wurde – und der es von Anfang an war: der »schöne, tiefbegeisterte Wille«. Das fing 1810 an, als der wunderbare Dichter Jean Paul (1825 in Bayreuth gestorben) schrieb, »dass wir bis jetzt auf den Mann harren, der eine ächte Oper zugleich dichtet und setzt«. Dieser Mann wurde immer wieder als Wagner identifiziert, der seinerseits den Mythos Bayreuth in einer begeisterten Notiz weitertrieb, wenn er als alter Herr seiner Cosima in die Feder diktierte, wie er mit 22 Jahren »in das vom Abendsonnenschein lieblich beleuchtete Bayreuth« gekommen und quasi seitdem diesem Ort magisch verbunden sei. Alle haben am Mythos Bayreuth mitgewebt, am meisten aber der Meister selber, und es hat geklappt wie bei keinem anderen Mythos. Das ist umso erstaunlicher, als die Gründe für Bayreuth als Festspielort eher trivial und absolut egozentrisch waren, was es natürlich zu verschleiern galt. Die Ideen nämlich, die zu Bayreuth führten, kamen aus unterschiedlichen und eher praktischen Ecken: In den 1840er-Jahren, als Wagner auf Stoffsuche war und die abseitigsten Ideen hatte (Barbarossa finden wir in der Stoffsammlung, Wieland den Schmied, was ja immerhin germanischer Sagenkreis ist, dann Achilles, na ja, und, ganz weit vorn: Jesus von Nazareth, den er als Sozialreformer sah, sozusagen auf den Barrikaden von 1848 gekreuzigt), las er Aischylos und hatte von da an vor Augen, dass es im antiken Griechenland so etwas wie den attischen Tragödientag gegeben haben muss, den Tag, an dem in olympischer Abgeschiedenheit die Tragödie ein...