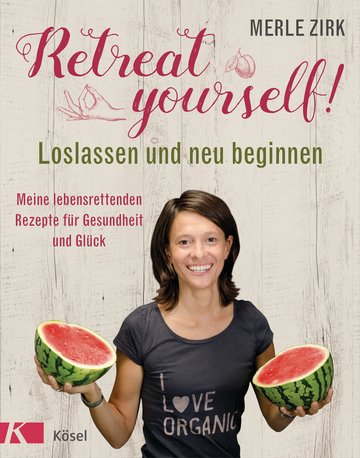Nicht nur die Dankbarkeit finde ich immer häufiger, es ist auch Angst, die sich oft wie ein Schleier über mich legt. Im Laufe der Chemotherapie gibt es Phasen, über die ich mit niemandem spreche. Ich fühle mich trotz der vielen Anteilnahme allein und hilflos. Es ist eine Art Zwischenzustand, in dem ich schwebe. Ich bin am Leben, aber irgendwie nicht im Leben. Ich versuche, neben den wöchentlichen Arztterminen weiterhin teilzuhaben, aber oft gelingt mir das nicht. Meine Perspektive verschiebt sich. Meine Familie und meine Freunde wollen alles Gute für mich, das weiß und spüre ich. Ich freue mich, wenn sie mir von ihrem jeweiligen Alltag erzählen, mich mit einbeziehen – und doch: In mir ändert sich alles. Anfangs versuche ich, die »alte Merle« zu bleiben und irgendwie mitzumachen. Zumindest nach außen hin funktioniert das gut. Auch optisch verändere ich mich nicht groß, denn meine Haare bleiben zur Überraschung aller. Die Perücke, die ich mir noch organisiert habe, verschiedene Mützchen und Vorbereitungen, die ich für den Haarverlust getroffen habe, sind hinfällig. Äußerlich sieht mir niemand an, dass ich krank bin.
Und was im Inneren vor sich geht, halte ich erst mal geheim. Ich werde sensibler, melancholischer, irgendwie roher. Bis heute. Ich weiß, dass sich viele Menschen in meinem Umfeld die Merle zurückwünschen, die ich früher einmal war. Immer gut gelaunt, partymäßig unterwegs und immer auf vielen Hochzeiten tanzend. Aber ich kann und vor allem: Ich will diese Merle nicht mehr sein.
Die Angst, dass mein Leben ganz schnell vorbei sein kann, die Schmerzen, das Wissen um den Tumor, der sich in mir breitgemacht hat, die befallenen Lymphknoten und nicht zuletzt die Chemotherapie formen meine Seele und eine neue Weise, auf das Leben zu schauen.
Mich endlich
richtig nähren
Ich beende die Chemotherapie auf Anraten meines Onkologen vorzeitig nach dem fünften Zyklus. Im Gegensatz zum ersten Zyklus waren die weiteren Chemotherapien nämlich mit so vielen schlimmen Nebenwirkungen behaftet, dass Aufwand und weiterer möglicher Nutzen in keinem Verhältnis stehen. So bin ich im Sommer des Jahres 2013 also mit der Akuttherapie meiner Krebserkrankung durch. Mit den Nerven und meiner Lebensenergie auch.
Meine Anker werden Urlaube mit Freunden und die Beschäftigung mit Nahrungsmitteln und alternativen Heilmethoden. In dieser Phase beginne ich mich intensiver mit der Ernährung zu befassen, da ich den tiefen Wunsch empfinde, all die Gifte aus meinem Körper zu verabschieden. Ich möchte selbst aktiv zu meiner Gesundung beitragen und die Verantwortung für mein eigenes Leben nicht länger an der Garderobe der Arztpraxen abgeben. Die Worte »gesund« oder »geheilt« möchte dort niemand in den Mund nehmen.
Ich fange an zu recherchieren, zu kochen, zu lesen und zu forschen. Es passiert Erstaunliches: Nachdem ich über ein paar Wochen keine Milchprodukte mehr zu mir genommen habe, verschwinden plötzlich meine Wassereinlagerungen in den Beinen. Probleme, die durch die Entnahme der Lymphknoten verursacht wurden. Ich erfahre am eigenen Körper, welchen Unterschied die Ernährung machen kann. Daraufhin saugen meine Augen und Ohren alles auf, was sie nur annähernd als relevant einstufen. Schritt für Schritt werden weitere Lebensmittel, die mir nicht guttun, von meinem Speiseplan gestrichen. Das Wichtige dabei: All das gibt mir Mut und Zuversicht und das Gefühl, dass ich selbst – zumindest partiell – mein Leben und meine Gesundheit beeinflussen kann.
Bis die Reha im Oktober startet, habe ich bereits einige neue Mitarbeiter in meinem »Get-Healthy-Business«. Neben dem Onkologen und seinem Ärztekollegen mit Schwerpunkt auf Traditioneller Chinesischer Medizin, meiner wundervollen Lymphdrainagetherapeutin und der liebevollen Heilpraktikerin gesellt sich eine Orthomolekularärztin hinzu. Ihre Fachgebiete sind komplementäre Krebsmedizin, Hormon- und Darmgesundheit.
Hier lerne ich Dinge, von denen ich vorher noch nie etwas gehört habe. Ein ganz neues Feld tut sich für mich auf. Ich schöpfe Hoffnung, ich lese, ich lerne – und vor allem gibt mir diese Beschäftigung mit Gesundheitsfragen Halt. Etwas, was die Reha in einer baden-württembergischen Kleinstadt nicht schafft. Das Essen dort ist eine unfassbare Zumutung für die Krebspatienten, die hier vor allem sind. Viel Fleisch, Milchprodukte, Weißmehlbrötchen, zuckrige Kuchen und Süßkram zieren den Speiseplan. Mein täglicher Gang zum Biomarkt im Ort wird zu einer wichtigen Routine. In der Einrichtung merkt keiner, dass ich nur die aufgewärmte Suppe vom Kantinenlieferservice zu mir nehme. Mein Vorrat auf dem Zimmer wird mehr und vielfältiger. Ich habe Spaß daran, Essen reinzuschmuggeln und auszubrechen aus den Vorschriften und den für mich unverständlichen Empfehlungen.
Dennoch habe ich mit mir zu kämpfen. Ich kann zwar kontrollieren, was ich meinem Körper durch den Mund zuführe, aber ich kann nicht kontrollieren, was meine Gefühle machen. Die Psychotherapie der onkologischen Einrichtung ist bemüht, auch dahin den Fokus zu legen. Dass körperliche Krankheit mit der Psyche zu tun hat, ist mittlerweile bekannt. In den fünf Wochen vor Ort reißen Wunden aus meiner Vergangenheit auf. Ganz grob gesagt geht es um die Beziehung zu meinem Vater und damit zusammenhängende Ereignisse in meiner Kindheit und Jugend. Die Therapiestunden, die in der Reha auf meinem Plan stehen, reichen leider von vorn bis hinten nicht aus, um das anzuschauen, was zu diesem Thema seit Jahrzehnten in mir verborgen liegt. Und ehrlich gesagt bin ich mit dem Wegsehen bisher auch ganz gut zurechtgekommen. Nicht hinschauen, nicht fühlen und nicht wiedererleben. Eigentlich der perfekte Plan. Im Nachhinein ist mir klar, dass dieses lange Verdrängen von Trauer, Wut und Schmerzen zu meiner Überlebensstrategie geworden war. In der Reha öffne ich mich seit Langem einer Therapeutin. Ich lasse in meiner Kindheit und in meiner Familiengeschichte herumstochern, ohne zu merken, dass sich ein ganz großes, schwarzes Loch auftut.
Ein Loch, in das ich spätestens nach der Rückkehr nach München vollständig hineinfalle. Mein Onkologe, der immer so ungeniert ehrlich zu mir ist, nennt mich ein Häufchen Elend. Ich stelle mich einem anderen psychotherapeutischen Arzt vor und bekomme die Diagnose »Posttraumatische Belastungsstörung«.
Dann, wenn alle Welt davon ausgeht, dass ich weitermachen kann wie früher, erwischt es mich. Ich taumle, ich suche Halt und Orientierung. Ich brauche viel Zeit für mich und komme bei dem Pensum, das die anderen absolvieren, nicht mit. Später erfahre ich, dass ich nicht allein bin mit dieser Erfahrung. Viele Krebspatienten mobilisieren in der Akuttherapie unglaubliche Kräfte. Die Zeit danach wird oft zum Problem. Weitermachen wie früher fällt für viele aus. Zu stark hat sich alles verändert. Völlig neu anfangen ist aber auch nicht gleich oder leicht möglich.
Ich habe wieder tatkräftige Hilfe für meine Situation. Mein Onkologe setzt sich für eine stationäre psychologische Behandlung ein. Die Bewilligung der Anträge dauert und so entscheide ich spontan, meinen Jahrestag der Krebsdiagnose im Dezember mit etwas völlig Neuem zu verbringen, um nicht noch tiefer zu fallen. Ich reise für eine Woche in die Türkei, um an einem Yoga- und Aufstellungsseminar teilzunehmen. Die Aufstellungsarbeit ist eine Methode, bei der Themen, die uns belasten und die mit dem Familiensystem zusammenhängen, gemeinsam mit anderen Gruppenteilnehmern erkannt und gelöst werden.
Die Erfahrung dort ist ein weiterer Schubs in ein Leben der Selbstfürsorge und des Mutes. Ich komme mit anderen Frauen in Kontakt, alle sehr viel reifer als ich, die mit diversen Schicksalsschlägen in ihren Leben zu kämpfen hatten. Ich wage es, den Kursleiterinnen zu vertrauen. Ich öffne mich den Methoden der Aufstellungsarbeit und ich lasse mich ein. Auf die Trauer, die Wut, die Schmerzen. Ich weine und ich lache so viel wie selten zuvor in meinem Leben.
SICH VOLL UND GANZ EINLASSEN
Zum damaligen Zeitpunkt war mir die Wichtigkeit und die Tragweite der Psychotherapie nicht bewusst. Ich habe mir den Klinikaufenthalt nicht selbst ausgesucht, sondern lediglich auf ein Geschenk reagiert. Allerdings mit der Bereitschaft, mich voll einzulassen, zu vertrauen und zu schauen, was sich entwickelt. Heute weiß ich, dass dieser Aufenthalt mit all seinen Möglichkeiten extrem viel für mich bereit gehalten hat und ich diese offene Hand voller Wandlungschancen nur zu gern genommen habe.
Im neuen Jahr schmeißen meine Freundinnen eine Party für mich, fast schon eine Abschiedsparty, denn ich gehe für fünf Wochen in die stationäre Psychotherapie nach Niederbayern. Mein Abenteuer in der psychosomatischen Klinik. Es ist schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Und gleichzeitig so heilend. Mein Stundenplan ist engmaschig. Ich habe Walkingeinheiten, Gesprächstherapie in der Gruppe, Maltherapie, Körpertherapie und Fitnessprogramm. Dazu gibt es Einzelsitzungen mit der behandelnden Ärztin. Ich lerne die unterschiedlichsten Menschen und deren Probleme kennen. Mit manchen spannt sich ein Band, das bis heute besteht. Dass der Aufenthalt dort lebensverändernd für mich wird, hätte ich nie zu träumen gewagt. Aber ich verstehe plötzlich so vieles. Meinen Umgang mit schmerzhaften Themen, meine gescheiterte Beziehung und nicht zuletzt meine Kindheit.
Die Körpertherapiesitzungen werden für mich zu einem Schlüssel. Zu dem Schlüssel, der in das Schloss einer bisher nie geöffneten Tür passt. Der Raum dahinter gibt Dinge frei, die der Verstand...