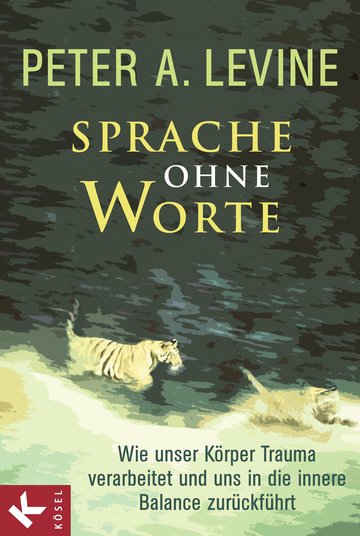Kapitel 1
Die Macht einer Sprache ohne Worte
»Wenn man innerlich gelernt hat, was Furcht und
Zittern ist, so ist man gegen den Schrecken durch
äußere Einflüsse gesichert.«
I Ging, Hexagramm 51, Das Erregende
(Das Erschüttern, der Donner)
Wie selbstsicher wir auch sein mögen, unser Leben kann im Bruchteil einer Sekunde völlig zerstört werden. Wie in der biblischen Geschichte von Jona können die bislang unbekannten Mächte von Trauma und Verlust uns völlig verschlingen. Gefangen und verloren in ihrem kalten, dunklen Bauch, erstarren wir vor Entsetzen und Hilflosigkeit.
Zu Beginn des Jahres 2005 verließ ich an einem milden Morgen in Südkalifornien mein Haus. Die angenehme Wärme und die leichte Meeresbrise beschwingten meine Schritte. Dieser Wintermorgen weckte wahrscheinlich bei allen Menschen im Land den Wunsch, ihre Schneeschieber beiseite zu stellen und sich an die warmen, sonnigen Strände Südkaliforniens zu begeben. Es versprach einer jener vollkommenen Tage zu werden, an denen wir das sichere Gefühl haben, dass nichts falsch laufen und nichts Böses passieren kann. Aber es passierte.
Ein Augenblick der Wahrheit
Voller Vorfreude auf meinen lieben Freund Butch, dessen 60. Geburtstag wir feiern wollten, lief ich die Straße entlang.
Ich betrat einen Fußgängerüberweg ... und im nächsten Augenblick liege ich völlig erstarrt und betäubt auf der Straße, unfähig mich zu bewegen oder zu atmen. Mir ist absolut unklar, was da gerade passiert ist. Wie bin ich hier hingeraten? Durch den dichten Nebel meiner Verwirrung und Ungläubigkeit eilen Menschen auf mich zu. Sie bleiben stehen, entsetzt. Ziehen einen immer engeren Kreis um mich, beugen sich abrupt über mich, starren auf meinen gelähmten, verrenkten Körper. Aus meiner hilflosen Lage da am Boden kommen sie mir vor wie eine Schar gefräßiger Raben, die im Begriff sind, sich auf ein verletztes Opfer zu stürzen – mich. Langsam gewinne ich die Orientierung zurück und erkenne den tatsächlichen Angreifer. Wie in einer altmodischen Blitzlichtaufnahme sehe ich einen beigefarbenen Wagen, der mit seinem zahnähnlichen Frontblech und einer zersplitterten Windschutzscheibe über mir lauert. Die Tür schlägt plötzlich auf. Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, springt mit weit aufgerissenen Augen heraus. Sie starrt mich benommen und entsetzt an. Auf eigenartige Weise weiß ich, was passiert ist, und weiß es zugleich nicht. Die Puzzlestücke fügen sich zusammen zu einer furchtbaren Gewissheit: Als ich den Fußgängerüberweg betrat, muss mich dieses Auto angefahren haben. Verwirrt und ungläubig sinke ich zurück in eine vernebelte Zwischenwelt. Ich bin unfähig, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen oder willentlich aus diesem Alptraum zu erwachen.
Ein Mann eilt auf mich zu und kniet sich neben mich. Er stellt sich als Rettungssanitäter außer Dienst vor. Als ich versuche herauszufinden, woher seine Stimme kommt, ermahnt er mich streng: »Nicht den Kopf bewegen!« Der Widerspruch zwischen seinem scharfen Befehl und dem natürlichen Impuls meines Körpers, sich der Stimme zuzuwenden, versetzt mich in angstvolle, lähmende Angespanntheit. Meine Wahrnehmung ist seltsam gespalten, und ich erlebe, wie ich auf unheimliche Weise meinen Körper verlasse. Es ist, als schwebte ich über ihm und schaute hinab auf die Szene, die sich da unter mir abspielt.
Ich schnelle zurück in den Körper, als der Mann neben mir grob nach meinem Handgelenk greift und meinen Puls prüft. Dann ändert er seine Haltung und hockt jetzt direkt über mir. Ungeschickt greift er mit beiden Händen nach meinem Kopf und hält ihn fest, damit er sich nicht mehr bewegt. Sein abruptes Verhalten und seine scharfen Kommandos versetzen mich in Panik, sodass ich noch mehr erstarre. Die Angst sickert langsam in mein verwirrtes, vernebeltes Bewusstsein: Vielleicht habe ich mir das Genick gebrochen, denke ich. Ich habe das dringende Bedürfnis nach einem anderen Menschen, auf den ich mich konzentrieren kann. Ich brauche den tröstlichen Blick eines Menschen, an dem ich mich festhalten kann wie an einem Rettungsring. Aber die Angst ist so groß und ich fühle mich so hilflos und gelähmt, dass ich mich nicht bewegen kann.
Die Fragen des Guten Samariters prasselten auf mich herab wie Salven eines Maschinengewehrs: »Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Wohin wollten Sie? Welches Datum haben wir heute?« Aber ich spüre meinen Mund nicht und bringe kein Wort heraus. Ich habe nicht die Kraft, seine Fragen zu beantworten. Seine Art, sie zu stellen, verwirrt mich total. Schließlich gelingt es mir, ein paar Worte zu stammeln. Meine Stimme ist angespannt und klingt gepresst. Ich bitte ihn sowohl mit den Händen als auch mit Worten: »Bitte treten Sie zurück.« Er leistet meiner Bitte Folge. Wie ein neutraler Beobachter, der über die Person spricht, die da auf dem Asphalt liegt, versichere ich ihm, verstanden zu haben, dass ich meinen Kopf nicht bewegen soll, und sage ihm, dass ich seine Fragen später beantworten werde.
Die Macht von Freundlichkeit
Ein paar Minuten später bahnt sich eine Frau unaufdringlich ihren Weg durch die Menge zu mir und setzt sich ruhig neben mich. »Ich bin Ärztin, Kinderärztin«, sagt sie. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Bitte bleiben Sie einfach bei mir«, antworte ich. Ihr einfaches, freundliches Gesicht wirkt zugewandt und zeigt ruhige Anteilnahme. Sie nimmt meine Hand in ihre, ich drücke sie. Sanft erwidert sie die Geste. Als mein Blick den ihren sucht, spüre ich, wie meine Augen feucht werden. Der angenehme, merkwürdig vertraute Duft ihres Parfüms sagt mir, dass ich nicht allein bin. Durch ihre ermutigende Gegenwart fängt diese Frau mich emotional auf. Wie eine zitternde Welle durchläuft mich Erleichterung, und ich nehme meinen ersten tiefen Atemzug. Dann jagt ein eiskalter Schauer des Entsetzens durch meinen Körper. Tränen strömen mir jetzt aus den Augen. Innerlich höre ich die Worte: Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert ist; das ist nicht möglich; das passt doch gar nicht zusammen mit meinen Plänen für Butchs Geburtstagsfest heute Abend. Der Sog unermesslichen Bedauerns zieht mich mit aller Macht in die Tiefe. Immer noch läuft ein Schauder nach dem anderen durch meinen Körper. Die Realität setzt ein.
Nach einer Weile löst ein sanfteres Vibrieren das abrupte Zittern ab. Wellen von Angst und Besorgnis erfassen mich abwechselnd. Mir wird die Möglichkeit bewusst, dass ich ernsthaft verletzt sein könnte. Vielleicht ende ich im Rollstuhl, verkrüppelt und abhängig. Wieder überfluten mich heftige Wellen von Leid. Ich habe Angst, völlig darin zu ertrinken, und halte mich am Blick der Frau fest, die neben mir sitzt. Als ich langsamer atme, nehme ich wieder den Duft ihres Parfüms wahr. Ihre beständige Gegenwart trägt mich. Ich fühle mich nicht mehr so überwältigt, und auch die Angst verliert an Macht. Ich empfinde einen Funken Hoffnung, dann eine heftige Welle von rasendem Zorn. Mein Körper bebt und zittert immer noch. Er ist abwechselnd eiskalt und heiß wie im Fieber. Rotglühende Wut explodiert tief in meinem Bauch: Wie konnte diese dumme Göre mich auf einem Fußgängerüberweg anfahren? Konnte sie nicht aufpassen? Verdammt!
Schrillende Sirenen und blinkendes Rotlicht blenden alles andere aus. Mein Bauch zieht sich zusammen, und meine Augen suchen erneut den freundlichen Blick der Frau. Wir drücken uns die Hände, und der Knoten in meinem Bauch lockert sich.
Ich höre, wie mein Hemd aufgerissen wird. Geschockt flüchte ich mich wieder in die Position des Beobachters, der über meinem am Boden liegenden Körper schwebt. Ich sehe, wie uniformierte Fremde systematisch Elektroden an meinem Brustkorb befestigen. Der Gute Samariter von vorhin berichtet irgendjemand, dass mein Puls bei 170 war. Ich höre, wie jemand mein Hemd noch weiter aufreißt. Das Notarztteam lässt eine Nackenstütze unter meinen Nacken gleiten und schiebt mich vorsichtig auf eine Tragbahre. Während sie mich festschnallen, höre ich wirre Bruchstücke des Funkgesprächs. Die Sanitäter fordern ein voll ausgerüstetes ärztliches Notfallteam an. Ich bin alarmiert. Ich bitte darum, ins nächste Krankenhaus, nur einen guten Kilometer von hier, gebracht zu werden. Doch man sagt mir, aufgrund meiner Verletzungen wäre es besser, mich in die große Unfallklinik nach La Jolla zu bringen, die etwa 50 Kilometer entfernt liegt. Mir sinkt das Herz. Überraschenderweise klingt die Angst jedoch schnell wieder ab. Als ich in den Krankenwagen gehoben werde, schließe ich zum ersten Mal die Augen. Immer noch begleiten mich der schwache Duft des Parfüms der Frau und ihr ruhiger, freundlicher Blick. Wieder habe ich das tröstende Gefühl, dass ihre Gegenwart mich trägt und hält.
Als ich die Augen im Krankenwagen wieder öffne, bin ich plötzlich ganz wach, als wäre ich total mit Adrenalin vollgepumpt. Doch obwohl dieses Gefühl sehr intensiv ist, überwältigt es mich nicht. Meine Augen wollen umherschweifen, um die fremde und bedrohliche Umgebung zu erforschen, ich weise mich jedoch bewusst an, nach innen zu gehen. Ich beginne meine Körperempfindungen zu überprüfen. Durch diese bewusste Ausrichtung werde ich aufmerksam auf ein intensives, unangenehmes Vibrieren in meinem ganzen Körper.
Neben dieser unangenehmen Empfindung bemerke ich eine merkwürdige Spannung in meinem linken Arm. Ich lasse diese Empfindung in den Vordergrund meines Bewusstseins treten und verfolge, wie sich die Spannung im Arm aufbaut. Langsam wird mir klar, dass der Arm nach oben schnellen will. Während...