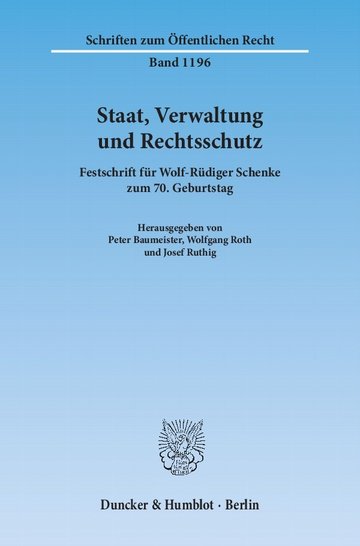| Vorwort | 6 |
| Inhaltsverzeichnis | 10 |
| Richard Bartlsperger: Das subjektive öffentliche Recht als Apriori des Verfassungsstaates | 18 |
| I. Bekanntes und Verborgenes zum Begriff des subjektiven öffentlichen Rechts | 20 |
| II. Das subjektive öffentliche Recht als traditionelle und zu überwindende Domäne des Verwaltungsrechts | 23 |
| 1. Ideengeschichtlicher Beginn und wirkungsgeschichtlicher Ausgangspunkt | 24 |
| 2. Kontinuität unter neuen verwaltungsrechtlichen und veränderten staatsrechtlichen Voraussetzungen | 33 |
| III. Die grundrechtliche Rechtsweggewährleistung als staats- und rechtstheoretische Aussage | 44 |
| IV. Primat des subjektiven Rechts | 47 |
| Wilfried Berg: Das Grundrecht der Freizügigkeit und die Grenzen der Staatsorganisation | 52 |
| I. Verfassung und Zeit | 52 |
| II. Die Garantie der Freizügigkeit in der Zeit | 53 |
| 1. Das Grundrecht auf Freizügigkeit in der deutschen Verfassungsentwicklung | 54 |
| a) Die historischen Wurzeln der Freizügigkeit | 54 |
| b) Das Bonner Grundgesetz von 1949 | 55 |
| c) Staatsbürger und staatliche Souveränität | 58 |
| 2. Staatsziele des Grundgesetzes und der Lissabon-Vertrag | 59 |
| III. Ausblick | 61 |
| Herbert Bethge: Die materielle Verfassungsstreitigkeit zwischen Verfassungsgerichtsbarkeit- und Fachgerichtsbarkeit | 62 |
| I. Die Grundlagen | 62 |
| 1. Die Normativität der Verfassungsgerichtsbarkeit | 62 |
| 2. Die normative Kraft des Enumerationsprinzips | 63 |
| 3. Bundesverfassungsgerichtsbarkeit als formelle Verfassungsgerichtsbarkeit | 66 |
| II. Die Abschichtung zwischen Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit | 69 |
| 1. Die systematische Plausibilität der unterschiedlichen Kompetenzzuweisungen | 69 |
| 2. Das Entscheidungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts in verfassungsrechtlichen Streitigkeiten | 72 |
| 3. Die falsche These von der Justitiabilität aller Verfassungsstreitigkeiten | 73 |
| III. Die Reichweite der materiellen Verfassungsstreitigkeit | 77 |
| 1. Die Figur der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit | 77 |
| 2. Die prinzipale Normenkontrolle des formellen Gesetzgebers | 78 |
| 3. Die Verfassungsbeschwerde als Normkontrollklage und Normerlassklage | 78 |
| IV. Schlussbemerkung | 80 |
| Christoph Degenhart: Verfassungsfragen der Fraktionsenquête | 82 |
| I. Anlass und Gegenstand der Untersuchung: die „Fraktionsenquête“ | 82 |
| II. Die nähere Problemstellung – verfassungsrechtliche Funktionen und zulässige Gegenstände des parlamentarischen Enquêterechts | 84 |
| 1. Parlamentsfunktionen und Enquêterecht | 84 |
| 2. Regierungskontrolle als Kernbereich des parlamentarischen Untersuchungsrechts | 84 |
| 3. Die „Kollegialenquête“ – Untersuchung parlamentsinterner Vorgänge? | 85 |
| 4. Fraktionsenquête – die nähere Fragestellung | 86 |
| III. Verfassungsrechtliche Stellung der Parlamentsfraktionen – zum Grundsatz des Funktionsschutzes | 88 |
| 1. Funktionsschutz als Schranke des Enquêterechts | 88 |
| 2. Funktionsschutz der Parlamentsfraktion, insbesondere der Opposition | 89 |
| IV. Verfassungsrechtliche Bewertung der Fraktionsenquête | 90 |
| 1. Fraktionsenquête und Funktionsschutz | 90 |
| 2. Fraktionsenquête und öffentliches Interesse | 91 |
| a) Zweckwidriger Einsatz des Enquêterechts und öffentliches Interesse | 91 |
| b) Folgerungen: Enquêterecht des Parlaments und Funktionsschutz der Fraktion | 92 |
| V. Insbesondere: Fraktionsenquête, Fraktionsmittel und Rechnungshofkontrolle | 93 |
| 1. Erforderlichkeit der Enquête nach Rechnungshofkontrolle? | 93 |
| 2. Rechnungshofprüfung nach Landesverfassungsrecht als abschließende Regelung? | 94 |
| a) Fraktionsautonomie und unabhängige Prüfung durch den Rechnungshof | 94 |
| b) Rechnungshofkontrolle als sachgerechter Ausgleich – abschließender Charakter | 95 |
| VI. Fazit | 96 |
| Otto Depenheuer: Der verfassungsrechtliche Schutz des Betriebsgeheimnisses | 98 |
| I. Der offene Verfassungsstaat und der Schutz von Geheimnissen | 98 |
| II. Das Geschäftsgeheimnis als Element der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) | 100 |
| III. Das Geschäftsgeheimnis als vermögenswerte Rechtsposition (Art. 14 Abs. 1 GG) | 102 |
| 1. Der Vermögenswert des Betriebsgeheimnisses „Preisgestaltung“ | 102 |
| 2. Eigentumsrechtliche Zuweisung über den Schutz des „eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs“ | 104 |
| 3. Geschäftsgeheimnisse als eigenständige Rechtsposition | 105 |
| a) Zuweisung als Rechtsposition durch das TRIPs-Abkommen | 106 |
| b) Zuweisung als Rechtsposition durch EU-Recht | 106 |
| c) Zuweisung als Rechtsposition durch nationales Recht | 107 |
| IV. Ergebnis | 108 |
| Markus Deutsch: Gemeinsame Finanzierung von Infrastrukturprojekten durch Bund und Länder – Zum Verbot der „Mischfinanzierung“ | 110 |
| I. Einleitung | 110 |
| II. Die Aussagen der Finanzverfassung | 111 |
| 1. Art. 104 a GG als Kernaussage der Finanzverfassung | 111 |
| 2. Die Probleme der Konnexität von Aufgaben- und Ausgabenverantwortlichkeit | 112 |
| a) Gesetzesvollzug und Ausgabenverantwortung | 112 |
| b) Das Aufeinandertreffen von Kompetenzen | 112 |
| III. Das Verbot der Mischfinanzierung | 114 |
| 1. Die Mischfinanzierung in der Rechtsprechung | 114 |
| a) Keine Ansprüche auf Mitfinanzierung aus Art. 104a Abs. 1 GG | 114 |
| b) Die Übertragung der Aufgabenwahrnehmung und ihre Mitfinanzierung | 115 |
| c) Die einheitliche Sachaufgabe | 116 |
| d) Die Beteiligung an der Aufgabe des anderen Verwaltungsträgers | 117 |
| 2. Die Bewertung der Mischfinanzierung im Schrifttum | 118 |
| a) Mitfinanzierung nur bei ausdrücklicher Zulassung | 118 |
| b) Überschneidung von Verwaltungszuständigkeiten | 119 |
| c) Zusammenarbeit bei der Aufgabenwahrnehmung | 120 |
| 3. Die gemeinsame Finanzierung beim Zusammentreffen von Aufgaben | 120 |
| a) Der Grad der Betroffenheit | 121 |
| aa) Räumliche Überschneidung | 121 |
| bb) Unterschiedliche Kompetenzen im Hinblick auf den gleichen Sachgegenstand | 121 |
| cc) Veranlassung der Kompetenzwahrnehmung der anderen Gebietskörperschaft | 122 |
| b) Der Zweck des Art. 104 a Abs. 1 GG | 123 |
| aa) Kein Zwang zum Verzicht auf die Aufgabenwahrnehmung | 123 |
| bb) Der Konflikt über das Wie der Aufgabenwahrnehmung | 123 |
| 4. Die Funktion des Art. 104a Abs. 1 GG | 124 |
| a) Das Verbot des Führens am goldenen Zügel | 125 |
| b) Umfang der Mitfinanzierung | 125 |
| aa) Die Bestimmung der Aufgabe | 125 |
| bb) Die Höhe der Mitfinanzierung | 126 |
| (1) Befugnisse der Kompetenzträger | 126 |
| (2) Der Anteil an der Aufgabenerfüllung | 127 |
| IV. Zusammenfassung | 128 |
| Thomas Fetzer: Steuerrecht und Normenklarheit | 130 |
| I. Einleitung | 130 |
| II. Normenbestimmtheit und Normenklarheit als Verfassungsgebote | 132 |
| 1. Verfassungsrechtliche Verortung von Normenbestimmtheit und Normenklarheit | 132 |
| 2. Der Grundsatz der Normenklarheit | 133 |
| a) Abgrenzung von Normenklarheit und Normenbestimmtheit | 133 |
| b) Das erforderliche Maß an Normenklarheit | 135 |
| III. Die Bedeutung des Grundsatzes der Normenklarheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Steuerrecht | 137 |
| IV. Die Regelungen zur Mindestbesteuerung und Normenklarheit | 139 |
| 1. Die Regelungen zur Mindestbesteuerung | 139 |
| 2. Die Vorlage durch den Bundesfinanzhof | 140 |
| 3. Die Reaktion des Bundesverfassungsgerichts | 141 |
| V. Bewertung der verfassungsgerichtlichen Entscheidung | 143 |
| VI. Ausblick | 145 |
| Kristian Fischer: Sonderabgaben, Ausgleichsabgaben und Vorteilsabschöpfungsabgaben im Spiegel der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts | 148 |
| I. Einführung | 148 |
| II. Typen von nichtsteuerlichen Abgaben | 148 |
| 1. Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktion | 148 |
| 2. Ausgleichsabgaben | 150 |
| 3. Vorteilsabschöpfungsabgaben | 150 |
| 4. Ableitungen für die Erhebung umweltschutzorientierter Abgaben | 151 |
| III. Verfassungsrechtliche Parameter | 152 |
| 1. Kompetenzrechtliche Fragestellungen nach der Föderalismusreform | 153 |
| 2. Die Schutz- und Begrenzungsfunktion der Finanzverfassung | 156 |
| 3. Die Sonderabgabenjudikatur des BVerfG | 157 |
| IV. Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für die Abgabenerhebung | 160 |
| 1. Sonderabgaben mit Finanzierungsfunktion | 160 |
| 2. Ausgleichsabgaben | 160 |
| 3. Vorteilsabschöpfungsabgaben | 161 |
| 4. Ableitungen für die Erhebung umweltschutzorientierter Abgaben | 165 |
| V. Schlussbetrachtung | 166 |
| Werner Frotscher: Das Bundesratsprinzip – „gute, deutsche“ Verfassungstradition? | 168 |
| I. Einführung | 168 |
| II. Die deutsche Verfassungstradition | 170 |
| 1. Der Reichstag des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation | 171 |
| 2. Die Bundesversammlung („Bundestag“) des Deutschen Bundes | 172 |
| 3. Das Staatenhaus nach der Reichsverfassung vom 28.3.1849 | 172 |
| 4. Der Bundesrat nach der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16.4.1871 | 173 |
| 5. Der Reichsrat nach der Weimarer Reichsverfassung | 175 |
| 6. Die Entstehung des Grundgesetzes: Bundesrats- contra Senatsprinzip | 177 |
| III. Folgerungen und Argumente für die reformpolitische Diskussion | 179 |
| Nobuhiko Kawamata: Zur Absolutheit des Folterverbots – ein Vergleich zwischen der japanischen und der deutschen verfassungsrechtlichen Diskussion | 186 |
| I. Einleitung | 186 |
| II. Die Diskussion in Deutschland | 188 |
| 1. Pro Relativierung | 188 |
| a) Brugger | 188 |
| b) Starck | 190 |
| 2. Contra Relativierung | 190 |
| 3. Rechtsprechung | 192 |
| a) Landgericht Frankfurt | 192 |
| b) Bundesverfassungsgericht | 193 |
| c) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte | 193 |
| III. Diskussion in Japan | 193 |
| 1. Rechtssituation | 194 |
| 2. Möglichkeit der Relativierung in Japan | 195 |
| a) Das materiellrechtliche absolute Folterverbot in Art. 36 JV | 195 |
| b) Das verfahrensrechtliche Verbot der Beweiswertung des durch Folter erlangten Geständnisses | 197 |
| IV. Zur Effektivierung des Folterverbotes | 197 |
| 1. Überwachung der Verhöre | 198 |
| 2. Definition von Folter | 198 |
| V. Schlussbemerkung | 199 |
| Eckart Klein: Überlegungen zu Kompetenzausstattung und Kompetenzhandhabung des Bundesverfassungsgerichts | 202 |
| I. Einführung | 202 |
| II. Verfassungsbeschwerde und abstrakte Normenkontrolle | 203 |
| 1. Verfassungsbeschwerde | 203 |
| 2. Abstrakte Normenkontrolle | 205 |
| III. Zuordnung neuer Kompetenzen | 206 |
| 1. Kompetenzkontrolle | 206 |
| 2. Kompetenzfreigabeverfahren | 207 |
| IV. Ausweitung bestehender und Erschließung neuer Kompetenzen durch das Bundesverfassungsgericht | 208 |
| 1. Instrumentalisierung von Art. 38 GG | 209 |
| 2. Ultra-vires-Kontrolle von Organakten der Europäischen Union | 209 |
| 3. Moderation statt Entscheidung | 210 |
| 4. Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts zur Kompetenzerweiterung | 211 |
| V. Ablehnung von Initiativen zur Änderung von Verfahren | 212 |
| VI. Schlussbemerkung | 213 |
| Winfried Kluth: Gesetzgebung im Spannungsfeld von Parlamentarismus und Föderalismus – Reformperspektiven für das Vermittlungsverfahren | 214 |
| I. Gesetzgebung im Exekutivföderalismus | 214 |
| II. Grundlagen und Grenzen parlamentarischer Öffentlichkeit im unitarischen Parteien-Bundesstaat | 216 |
| 1. Die Mitwirkungsrechte des Bundesrats im Gesetzgebungsverfahren | 216 |
| 2. Funktionale Bedeutungsschichten des Vermittlungsverfahrens | 217 |
| III. Die parlamentarische Beratung als Kernelement demokratischer Gesetzgebung | 220 |
| 1. Eine Rückbesinnung zwischen Idealen der allgemeinen Staatslehre und verfassungsrechtlichem Realismus | 220 |
| 2. Das Gesetz und seine Begründung in öffentlicher Debatte | 222 |
| a) Das allgemeine Gesetz als Kernelement demokratischer Herrschaft | 222 |
| b) Begründungsanforderungen im Gesetzgebungsverfahren | 223 |
| IV. Rechtsvergleichende Betrachtungen zur Begründungspraxis und zum Vermittlungsverfahren in der Rechtsetzung der Europäischen Union | 226 |
| 1. Rechtsvergleichung mit der Europäischen Union? | 226 |
| 2. Normative Vorgaben und Praxis der Begründung von Rechtsetzungsakten | 228 |
| 3. Genese und Struktur des Vermittlungsverfahrens zwischen Rat und Europäischem Parlament | 229 |
| 4. Vorzüge des Verfahrens | 231 |
| V. Übernahme der EU-Regelung für das deutsche Vermittlungsverfahren | 231 |
| VI. Ausblick | 232 |
| Peter Cornelius Mayer-Tasch: „Wir sind das Volk! | 234 |
| Reinhard Mußgnug: Ämtervergabe durch Wahl | 244 |
| I. Die Lücke im Schutzbereich des Art. 33 Abs. 2 GG | 244 |
| 1. Freie Wahl contra Bestenauslese | 244 |
| 2. Verdrängung der Konkurrentenklage durch die Wahlanfechtung | 246 |
| II. Ämterwahl contra Ämtervergabe durch Kollegialentscheidung | 247 |
| 1. Die Richter-„Wahl“ | 247 |
| 2. Das akademische Berufungsverfahren | 249 |
| III. Die Rechtfertigungsbedürftigkeit der Ämterwahl | 250 |
| 1. Gerechtfertigte Ämterwahlen | 251 |
| 2. Die nordrhein-westfälische Schulleiterwahl | 252 |
| IV. Der Wahlbeamte | 254 |
| 1. Einbindung in die Verwaltungshierarchie | 255 |
| 2. Das passive Wahlrecht des Wahlbeamten | 256 |
| 3. Fachliche Anforderungen für Wahlbeamte | 259 |
| 4. Rücknehmbarkeit der Ernennung | 261 |
| 5. Der amtsunfähige Wahlbeamte | 261 |
| V. Schlußbemerkung | 262 |
| Hans-Jürgen Papier: Das Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit aus verfassungsrechtlicher Sicht | 264 |
| I. Freiheits- und Sicherheitszwecke des Verfassungsstaates | 264 |
| II. Rechtsstaatliche Bindungen | 268 |
| III. Resümee | 275 |
| IV. Schluss | 276 |
| Gerd Roellecke: Traditionen des Rechtsstaates in Deutschland | 278 |
| I. Forderung, Norm und Begriff | 278 |
| II. Religiöse Legitimation weltlicher Herrschaft | 279 |
| III. Beginn der Gewaltenteilung | 280 |
| IV. Die Entdeckung des Subjektes in der Reformation | 281 |
| V. Säkularisierung von Recht und Politik | 284 |
| VI. Die Ablösung des Adels durch das Berufsbeamtentum | 285 |
| VII. Der Justizbeamte und das Gesetz | 286 |
| VIII. Der Rechtsstaat als Staat des positiven Rechts | 287 |
| Michael Sachs: Die Bundeswehr als „Parlamentsheer“ – und der Bundesrat? | 288 |
| I. Einleitung | 288 |
| II. Die Argumentation des AWACS/Somalia-Urteils | 290 |
| III. Kritische Würdigung | 292 |
| 1. Grundsätzliche Einwände | 292 |
| a) Abstützung auf aufgehobene Verfassungsbestimmung | 292 |
| b) Verselbständigte Bedeutung verfassungsrechtlicher Tradition | 293 |
| c) Rückgriff auf nicht einschlägige Verfassungsbestimmungen | 293 |
| d) Fehlen jeder Diskussion einer Bundesratsbeteiligung | 293 |
| 2. Immanente Schwächen der Argumentation | 294 |
| a) Zur Aussagekraft des aufgehobenen Art. 59a GG | 294 |
| b) Zur Aussagekraft der verfassungsgeschichtlichen Tradition | 296 |
| c) Zur Aussagekraft der Bestimmungen des geltenden Verfassungsrechts | 297 |
| IV. Ergänzende Überlegungen | 299 |
| 1. „Parlamentsvorbehalt“ und Bundesrat | 299 |
| 2. Zur wehrverfassungsrechtlichen Stellung des Bundesrates | 301 |
| a) Die Entstehung des Art. 59a GG | 301 |
| b) Kein Ausschluss des Bundesrats durch Art. 50 GG | 302 |
| c) Kein Ausschluss des Bundesrats mangels Länderrelevanz des Streitkräfteeinsatzes | 302 |
| d) Der Bundesrat als Element der Gewaltenteilung | 303 |
| V. Schluss | 303 |
| Ralf P. Schenke: Die Garantie eines wirksamen Rechtsschutzes in Art. 47 Abs. 1 Grundrechtecharta | 306 |
| I. Die Bedeutung der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG | 307 |
| II. Rechtsmethodische Vorbemerkungen | 309 |
| III. Der Tatbestand | 310 |
| 1. Berechtigte | 310 |
| 2. Das verletzte Recht | 311 |
| a) Die verteidigungsfähigen Rechtspositionen | 311 |
| b) Anforderungen an das subjektive Recht | 312 |
| c) Anforderungen an die Plausibilität der Rechtsverletzung | 313 |
| 3. Die Verletzungshandlung | 314 |
| a) Der Akt öffentlicher Gewalt i.S.d. Art. 19 Abs. 4 GG | 314 |
| b) Die Rechtsverletzung i.S.d. Art. 13 EMRK | 315 |
| c) Die Rechtsverletzung i.S.d. Art. 47 Abs. 1 GrCh | 316 |
| IV. Der Gewährleistungsgehalt | 318 |
| 1. Adressaten | 319 |
| a) Art. 19 Abs. 4 GG | 319 |
| b) Art. 13 EMRK | 319 |
| c) Art. 47 Abs. 1 GrCh | 320 |
| aa) Die horizontale Dimension | 320 |
| bb) Die vertikale Dimension | 321 |
| 2. Grenzen und Beschränkungsmöglichkeiten | 322 |
| a) Der Ausgestaltungsspielraum des Art. 19 Abs. 4 GG | 322 |
| b) Art. 13 EMRK | 323 |
| c) Art. 47 GrCh | 323 |
| 3. Primär- versus Sekundärrechtsschutz | 324 |
| a) Art. 19 Abs. 4 GG | 324 |
| b) Art. 13 EMRK | 324 |
| c) Art. 47 Abs. 1 GrCh | 325 |
| V. Fazit und Ausblick auf die bleibende Bedeutung des Art. 19 Abs. 4 GG | 326 |
| Matthias Bäcker: Kriminalpräventives Strafrecht und polizeiliche Kriminalprävention | 332 |
| I. Begriff und innerstrafrechtliche Funktionen des kriminalpräventiven Strafrechts | 334 |
| 1. Rolle des Täters bei der Bezugstat | 336 |
| 2. Nähe zwischen Vorfeld- und Bezugstat | 338 |
| 3. Strafprozessuale Funktionen kriminalpräventiver Straftatbestände | 340 |
| a) Ermittlungsfunktion | 341 |
| b) Sicherungs- und Beweiserleichterungsfunktion | 343 |
| II. Kriminalpräventives Strafrecht und polizeirechtliche Befugnistatbestände | 344 |
| 1. Auswirkungen kriminalpräventiver Straftatbestände auf polizeiliche Ermittlungsbefugnisse | 345 |
| a) Befugnisse zur Gefahrenabwehr | 345 |
| b) Befugnisse zur Verhütung von Straftaten | 346 |
| 2. Steuerungsverluste im Polizeirecht durch kriminalpräventives Strafrecht | 350 |
| 3. Möglichkeiten einer polizeirechtsimmanenten Lösung | 352 |
| III. Das kriminalpräventive Strafrecht als Herausforderung für Straf- und Staatsrechtswissenschaft | 353 |
| Kurt Graulich: Bekämpfung der Piraterie als Polizeiaufgabe | 356 |
| I. Piraterie als Problem des Rechts | 356 |
| II. Internationales Recht und Piraterie | 357 |
| 1. Völkerrecht | 358 |
| a) Seerechtsübereinkommen (SRÜ) | 358 |
| b) Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt (SUA) | 358 |
| 2. Europäisches Unionsrecht | 359 |
| 3. Europäische Menschenrechtskonvention | 360 |
| III. Deutsches Recht und Bekämpfung der Piraterie | 361 |
| 1. Verfassungsrecht | 361 |
| a) Verbandskompetenz für Seesicherheit? | 361 |
| b) Vollzugskompetenz für Seesicherheit? | 362 |
| c) Zur Geltung der Grundrechte bei der Bekämpfung der Piraterie | 363 |
| 2. Recht der Gefahrenabwehr | 364 |
| a) Seeaufgabengesetz | 364 |
| b) Bundespolizeigesetz | 364 |
| 3. Strafrecht und Strafverfahrensrecht | 365 |
| IV. Bekämpfung der Piraterie durch deutsche Sicherheitskräfte | 366 |
| 1. Einsatz der Bundesmarine gegen Piraten | 367 |
| a) Einsatz der Bundesmarine zur Verteidigung (Art. 87a Abs. 2 GG) | 367 |
| b) Verwendung im Rahmen eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit (Art. 24 Abs. 2 GG) | 367 |
| c) Nothilfe | 368 |
| d) Einsatz nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts (Art. 25 GG)? | 369 |
| 2. Einsatz der Bundespolizei gegen Piraten | 369 |
| a) Sachliche und räumliche Zuständigkeit der Bundespolizei | 369 |
| b) Strafverfolgung | 371 |
| c) Maßnahmen auf hoher See (§ 6 BPolG) und zur Rettung von Personen aus gegenwärtiger Gefahr (§ 8 Abs. 2 BPolG) | 371 |
| 3. Kombinierter Einsatz von Material der Bundesmarine und Personal der Bundespolizei? | 372 |
| a) Die negative Schnittmenge militärischer und polizeilicher Kompetenzen | 373 |
| b) Begrenzungsgebot statt Trennungsgebot beim Einsatz von Bundeswehr und Polizei | 374 |
| c) „Materialleihe“ statt „Trennungsgebot“ | 376 |
| Klaus Grupp: Zur Gefahrenabwehr bei Gefahrguttransporten | 378 |
| I. Tatsächliche Voraussetzungen | 378 |
| II. Die geltenden Rechtsgrundlagen | 380 |
| 1. Überstaatliches Recht | 380 |
| 2. Nationales Recht | 382 |
| III. Genehmigungserfordernisse und -erteilungspraxis | 385 |
| IV. Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge | 385 |
| V. Rechtliche Grenzen einer telematischen Begleitung | 387 |
| 1. Die Pflicht zur technischen Ausstattung von Gefahrguttransport-Fahrzeugen | 387 |
| a) Die Kollision mit europarechtlichen Bestimmungen | 388 |
| b) Das Fehlen einer Rechtsgrundlage | 389 |
| 2. Die Verpflichtung zur Datenübermittlung | 390 |
| a) Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung | 391 |
| b) Das Erfordernis gesetzlicher Regelung | 392 |
| Christoph Gusy: Die „Schwere“ des Informationseingriffs | 396 |
| I. Fragestellung | 396 |
| II. Schwerwiegende Informationseingriffe: Zur Entwicklung der Rechtsprechung | 398 |
| III. Vom Ende der Gewissheit? Neuere Rechtsprechung | 400 |
| 1. Rasterfahndung – Privatsphäre oder Öffentlichkeitssphäre? | 401 |
| 2. Videoüberwachung von Verkehrsdaten – grundrechtsneutral oder einschüchternd? | 402 |
| 3. Vorratsdatenspeicherung – schwerwiegend oder Bagatelleingriff? | 404 |
| 4. Zusammenfassung | 405 |
| IV. Verfassungsrechtliche Kriterien zur Bestimmung der Eingriffsschwere | 406 |
| 1. Schutzbereichsbezogene Kriterien: Eingriff in ein besonders geschütztes Grundrechtsgut | 407 |
| 2. Eingriffsbezogene Kriterien: Was bleibt vom Grundrechtsschutz? | 408 |
| 3. Rechtsfolgenbezogene Kriterien: Informationserhebung und Informationsverwendung | 410 |
| 4. Die gesellschaftliche Dimension des Datenschutzes: Freie Bürger in einer freien Gesellschaft | 411 |
| V. Schluss: Ende oder Wende des Datenschutzrechts? | 413 |
| Dieter Lorenz: Die polizeiliche Überwachung von entlassenen Straftätern | 416 |
| I. Die Rechtsprechung des EGMR zur Sicherungsverwahrung und ihre Folgen | 416 |
| II. Die polizeiliche Handlungsbefugnis | 418 |
| 1. Polizeiliche Datenerhebung | 419 |
| a) Längerfristige Observation | 419 |
| b) Polizeiliche Dauerüberwachung | 419 |
| 2. Persönlichkeitsschutz und Freiheitsbeschränkung | 420 |
| 3. Gesetzesvorbehalt | 421 |
| III. Die bundesstaatliche Problematik | 422 |
| IV. Ausblick | 424 |
| Hans-Ullrich Paeffgen: Prozessuale Zwischenlösungen bei der Vorratsdatenspeicherung? | 428 |
| I. Problemansprache | 428 |
| II. Genese | 430 |
| 1. Einstweilige Anordnung | 430 |
| 2. Hauptsache-Entscheid | 431 |
| 3. Rechtsfolgen von Hauptsache-Verfahren und einstweiliger Anordnung | 431 |
| 4. Frage der Rechtsfolgen jener einstweiligen Anordnung im Strafverfahren | 440 |
| III. Conclusio | 444 |
| Franz-Josef Peine: Kampfmittelbeseitigungsrecht — ein Sonderfall des Gefahrenabwehrrechts | 448 |
| I. Einleitung | 448 |
| II. Kampfmittelbeseitigungsrecht | 449 |
| 1. Begriffsbestimmung | 449 |
| 2. Gesetzeslage | 450 |
| a) Fehlendes Bundesrecht | 450 |
| b) Spezielles Recht der Länder | 450 |
| aa) Regelung durch Gesetz | 450 |
| bb) Regelung durch Rechtsverordnung | 450 |
| cc) Verwaltungsvorschriften | 451 |
| dd) Überblick über den Inhalt der Regelungen | 451 |
| 3. Zuständigkeit | 452 |
| 4. Materiell-rechtliche Fragen | 454 |
| a) „Blindgängergefahr“ als Gefahrverdacht | 454 |
| b) Die Pflicht zur Vornahme gefahrerforschender Maßnahmen | 457 |
| c) Gefahrerforschung und Verhältnismäßigkeit – Reihenfolge der Untersuchungen | 459 |
| d) Die Inanspruchnahme von Störern | 459 |
| aa) Handlungsstörer | 460 |
| bb) Zustandsstörer/Gefahrerforschende Maßnahmen | 460 |
| cc) Zustandsstörer/Duldungspflichten | 462 |
| dd) Zustandsstörer/Gefahrenbeseitigung | 462 |
| e) Die Qualität der Gefahrenbeseitigung | 463 |
| 5. Finanzielle Fragen der Kampfmittelbeseitigung | 463 |
| a) Gefahrerforschungsmaßnahmen | 463 |
| b) Gefahrbeseitigungsmaßnahmen | 463 |
| c) Praxis der Kostentragung | 465 |
| III. Schlussbemerkung | 465 |
| Bodo Pieroth: Der Gesetzesvorbehalt für die Zahl und die Standorte von Polizeidirektionen | 466 |
| I. Der nicht entschiedene Rechtsstreit | 466 |
| II. Die einschlägigen Maßstäbe | 468 |
| 1. Gesetzesvorbehalt und Parlamentsvorbehalt | 468 |
| 2. Zugriffsrecht des Parlaments | 470 |
| 3. Art. 90 S. 2 ThürLVerf im innerdeutschen Rechtsvergleich | 473 |
| a) Kein ausdrücklicher Gesetzesvorbehalt | 473 |
| b) Gesetzesvorbehalt für die Organisation der Verwaltung | 474 |
| c) Spezieller organisationsrechtlicher Gesetzesvorbehalt für die „räumliche Gliederung“ | 475 |
| 4. Abgrenzung von Satz 2 und Satz 3 des Art. 90 ThürLVerf | 476 |
| III. Die konkreten Folgerungen | 477 |
| 1. Anwendung des Art. 90 S. 2 ThürLVerf | 477 |
| 2. Bestätigung durch das gemeindeutsche Polizeirecht | 479 |
| a) Terminologie | 479 |
| b) Die Regelung der zweiten Stufe | 479 |
| c) Die Regelung weiterer Stufen | 480 |
| d) Zwischenergebnis | 480 |
| IV. Ergebnis | 480 |
| Rainer Pitschas: Innere und zivile Sicherheit in der offenen Gesellschaft | 482 |
| I. Collaborative Sicherheitsgovernance im vorsorgenden Sozialstaat | 482 |
| 1. Staatsaufgabe „Sicherheit“ und staatliche Schutzpflicht | 482 |
| a) Sicherheit als Verfassungsprinzip | 482 |
| b) Staatliche Schutzpflicht | 484 |
| 2. Von der Staatsaufgabe „innere Sicherheit“ zur collaborativen Sicherheitsgovernance | 484 |
| a) Kooperative Kriminalitätsbekämpfung durch Staat- und Bürgergesellschaft | 484 |
| b) „Sicherheitspolitisches Mitwirkungsverhältnis“ und collaborative Sicherheitsgovernance | 485 |
| c) Legitimität collaborativer Sicherheitsgovernance im vorsorgenden Sozialstaat | 487 |
| II. Öffentlich-private Sicherheitspartnerschaft(en) als Gestaltungsform collaborativer Sicherheitsgovernance | 488 |
| 1. Privatisierung von Polizeiaufgaben und bürgerschaftliche Sicherheitsarbeit | 489 |
| 2. Struktur der Sicherheitspartnerschaft(en) | 490 |
| 3. Sicherheitspartnerschaft als werthafte Gestaltungsform collaborativer Sicherheitsgovernance | 490 |
| 4. Fortbestehende Gewährleistungsverantwortung des Staates | 491 |
| III. Sicherheitsunternehmen im Fokus öffentlich-privater Sicherheitspartnerschaft | 492 |
| 1. Empirische Grunddaten öffentlich-privater Sicherheitspartnerschaft mit dem Sicherheitsgewerbe | 492 |
| a) „Sicherheitsmarkt“ für private Sicherheitsdienste | 492 |
| b) Insbesondere: Dynamisches Wachstum der Branche in Sicherheitsdienstleistungen und -technik (weltweit) | 493 |
| c) Das Sicherheitsgewerbe in Zahlen (Deutschland) | 493 |
| d) Ausbau der beruflichen Infrastruktur im Sicherheitsgewerbe | 494 |
| 2. Öffentlich-private Sicherheitspartnerschaft als Raum faktisch begrenzter Staatlichkeit | 494 |
| 3. Steuerungsdefizite und Legitimationsschwächen öffentlich-privater Sicherheitspartnerschaft | 495 |
| a) Defizitäre Wahrnehmung der staatlichen Gewährleistungsverantwortung für innere Sicherheit | 495 |
| b) Legitimationsschwächen privater Sicherheitsdienstleistungen | 496 |
| IV. Notwendigkeit eines neuen Strategiekonzepts collaborativer Sicherheitsgovernance | 497 |
| V. Zusammenfassung | 497 |
| Josef Ruthig: Grundrechtlicher Kernbereich und Gefahrenabwehr: Verfahren, Rechtsschutz, Schadensersatz | 500 |
| I. Einführung | 500 |
| II. Der Kernbereich privater Lebensgestaltung: Versuch einer Annäherung | 504 |
| 1. Das Fehlen einer Definition | 504 |
| 2. Der ungeklärte Zweck des Kernbereichsschutzes | 507 |
| 3. Kernbereichsschutz und Gesetzesvorbehalt | 508 |
| III. Ein Zwischenergebnis | 510 |
| 1. Kernbereichsschutz durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit | 510 |
| 2. Kernbereichsschutz durch Verfahren | 511 |
| IV. Konkretisierungen | 512 |
| 1. Die Verfahrensgestaltung: Abbruch bzw. Beendigung der Maßnahme | 512 |
| a) Live-Überwachung | 514 |
| b) Behördenleitervorbehalt | 515 |
| c) Ermöglichen nachträglichen Rechtsschutzes durch Mitteilungspflichten und Auskunftsansprüche | 515 |
| 2. Richtervorbehalt | 516 |
| a) Zuständigkeit und Verfahren | 517 |
| b) Kernbereichsprognose | 518 |
| c) Zusätzliche Datensichtung vor Weiterverwertung | 519 |
| 3. Nachträglicher Rechtsschutz bei heimlichen Maßnahmen | 519 |
| a) Großzügige Zulassung der Verfassungsbeschwerde | 519 |
| b) (Nachträgliche) verwaltungsgerichtliche Feststellungsklage | 521 |
| 4. Staatshaftung | 521 |
| a) Amtshaftung: Schmerzensgeld bei rechtswidrigen Eingriffen in den Kernbereich | 521 |
| b) Offene Fragen | 522 |
| V. Fazit | 523 |
| Jae-Young Son: Grenzen der sog. „Kernbereichs-Dogmatik“ des Bundesverfassungsgerichts | 526 |
| I. Einführung in die Problematik | 526 |
| II. Die sog. Kernbereichs-Dogmatik des BVerfG | 526 |
| 1. Die Rechtsprechung des BVerfG zum Kernbereich privater Lebensgestaltung | 526 |
| 2. Der Kernbereichsschutz im Lauschangriff-Urteil des BVerfG vom 3.3.2004 | 527 |
| a) Der Kernbereich privater Lebensgestaltung als eine absolute Schranke staatlicher Informationseingriffe | 529 |
| b) Zur inhaltlichen Bestimmung des Kernbereichs privater Lebensgestaltung | 530 |
| III. Grenzen der Kernbereichs-Dogmatik des BVerfG | 532 |
| 1. Dogmatische Bedenken gegen die Rechtsprechung des BVerfG | 532 |
| a) Hängt die absolute Schutzwürdigkeit von Räumlichkeiten von ihrer konkreten Nutzung ab? | 532 |
| b) Die Relativierung des Kernbereichsschutzes | 534 |
| c) Das Gebot der unverzüglichen Löschung höchstpersönlicher Daten ergibt sich auch ohne die Annahme eines Kernbereichs bereits aus dem Folgenbeseitigungsanspruch | 536 |
| 2. Absoluter Schutz von Privatwohnungen? | 537 |
| IV. Resümee | 540 |
| Jürgen Wolter: Strafprozessuale Verwendung von Zufallsfunden nach polizeirechtlichen Maßnahmen | 542 |
| I. Ausgangspunkte und Mannheimer „Institut für deutsches und europäisches Strafprozessrecht und Polizeirecht“ | 542 |
| II. Gesetzliche Mängel bei den geltenden §§ 161 Abs. 2, 100d Abs. 5 Nr. 3, 161 Abs. 3 StPO und Gesetzesvorschlag (§ 161 Abs. 2 StPO-E) | 545 |
| 1. Das Merkmal „zu Beweiszwecken“ | 546 |
| 2. Die sog. Vereinbarkeit (Umgehungsverbot und „umfassender hypothetischer Ersatzeingriff“) | 550 |
| a) Umgehungsverbot („Entsprechungsklausel“) | 551 |
| b) Klausel des umfassenden hypothetischen Ersatzeingriffs: „Straftat, auf Grund derer eine solche Maßnahme angeordnet werden könnte“ | 552 |
| c) Ergänzung: „Hypothetische Verwertungs- und Verwendungsverbote“ | 552 |
| 3. Die „Verwertbarkeit“ der Daten im polizeirechtlichen Ausgangsverfahren bei § 161 Abs. 3 StPO | 554 |
| 4. Gesetzesvorschlag (§ 161 Abs. 2 StPO-E) | 554 |
| III. Die „Verwertbarkeit“ der Daten im polizeirechtlichen Ausgangsverfahren bei § 161 Abs. 2 StPO und § 161 Abs. 2 StPO-E | 555 |
| IV. Die Unhaltbarkeit der Al Quaida-Entscheidung (BGHSt 54, 69) | 558 |
| V. Ergebnis und Widmung | 559 |
| Thomas Würtenberger: Resilienz | 562 |
| I. Resilienz als Leitidee der Sicherheitsarchitektur | 563 |
| II. Die im Ausland entwickelten Resilienz-Konzepte | 565 |
| 1. In der Europäischen Union | 565 |
| 2. In den Vereinigten Staaten von Amerika | 566 |
| 3. Im Vereinigten Königreich | 567 |
| 4. In der Schweiz | 568 |
| 5. Zusammenfassung | 569 |
| III. An Resilienz orientierte politisch-rechtliche Gestaltung in Deutschland ohne eigenständiges Resilienz-Konzept | 570 |
| 1. Resilienz als Grundlage der Sicherheitsforschung | 570 |
| 2. Verfassungsrechtliche Grundlagen | 572 |
| 3. Im Katastrophenschutzrecht | 573 |
| 4. Die Vernetzung von staatlichem und gesellschaftlichem Bereich | 575 |
| 5. Die Organisation von Informations-, Kommunikations- und Koordinationsstrukturen | 577 |
| IV. Schlussbemerkung | 578 |
| Mark A. Zöller: Neue unionsrechtliche Strafgesetzgebungskompetenzen nach dem Vertrag von Lissabon | 580 |
| I. Einführung | 580 |
| II. Besonderheiten der Gesetzgebung auf EU-Ebene | 580 |
| III. Gesetzgebungskompetenzen der EU im Bereich des Strafrechts | 581 |
| 1. Fehlende Kompetenz zum Erlass supranationaler Strafrechtsnormen | 582 |
| a) Allgemeine Kompetenz zur Setzung supranationalen Strafrechts | 582 |
| b) Bereichsspezifische Kompetenznormen | 583 |
| aa) Art. 325 Abs. 4 AEUV | 583 |
| bb) Art. 79 Abs. 2 AEUV | 586 |
| 2. Kompetenzen zur Harmonisierung der nationalen Strafrechtsordnungen | 587 |
| a) Kompetenzen im Bereich des materiellen Strafrechts | 588 |
| aa) Originäre Strafrechtsangleichungskompetenz (Art. 83 Abs. 1 AEUV) | 588 |
| bb) Annexkompetenz (Art. 83 Abs. 2 AEUV) | 591 |
| b) Kompetenzen im Bereich des formellen Strafrechts | 593 |
| 3. Grenzen der Strafrechtsangleichung | 595 |
| a) Die „Notbremsenregelung“ der Art. 82 Abs. 3, 83 Abs. 3 AEUV | 595 |
| b) Subsidiaritätsprinzip | 596 |
| c) Verhältnismäßigkeitsprinzip | 598 |
| d) Strafrechtsspezifisches Schonungsgebot? | 598 |
| IV. Fazit | 599 |
| Peter Baumeister: Rücknahmeermessen bei einem anfechtbaren rechtswidrigen Verwaltungsakt? | 602 |
| I. Einleitung | 602 |
| II. Die Auffassung der herrschenden Lehre | 604 |
| III. Kritische Analyse der Argumente der h. L. | 606 |
| 1. Die Vereinbarkeit mit dem Wortlaut | 606 |
| 2. Das Bedürfnis für eine Ermessensreduktion | 607 |
| 3. Der praktische Nutzen der Anerkennung eines Aufhebungsanspruchs | 612 |
| 4. Möglichkeit der verfassungskonformen Auslegung des § 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG | 613 |
| IV. Kritik einer Aufhebungspflicht neben § 48 VwVfG | 615 |
| V. Fazit | 618 |
| Winfried Benz: Anforderungen an das Führungspersonal in Hochschulen | 620 |
| I. Einführung | 620 |
| II. Der Veränderungsprozess | 621 |
| III. Anforderungen an das Führungspersonal | 623 |
| IV. Zur Professionalisierung des Leitungspersonals | 627 |
| V. Ausblick | 632 |
| Martin Burgi: Der Vertragsarzt und die Konkurrenz neuer Versorgungsformen im Spiegel von Schutznormlehre und Regulierungsansatz | 636 |
| I. Problemstellung | 636 |
| II. Konkurrenzschutz im Recht der ambulanten Gesundheitsdienstleistungen | 638 |
| 1. Grundmodell und neue Versorgungsformen nach dem SGB V | 638 |
| 2. Klassische, neue und ganz neue Fragen des Konkurrenzschutzes | 640 |
| 3. Stand der Rechtsprechung | 642 |
| III. Der größere Analyserahmen | 644 |
| 1. Stärkere Wettbewerbsorientierung | 644 |
| 2. Sozialrecht als Regulierungsrecht? | 644 |
| IV. Anwendung der Schutznormlehre | 645 |
| 1. Entwicklungsstand | 645 |
| 2. Zur Anfechtungsberechtigung der Vertragsärzte | 646 |
| V. Bilanz | 648 |
| Hans-Joachim Cremer: Die Verurteilung der Bundesrepublik Deutschland durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als Wiederaufnahmegrund nach § 153 Abs. 1 VwGO i.V. mit § 580 Nr. 8 ZPO | 650 |
| I. Spürbare Relevanz der EMRK für das deutsche Recht | 650 |
| II. Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Verfahren vor den Verwaltungsgerichten nach einer „Verurteilung“ Deutschlands durch den EGMR | 652 |
| 1. Die Ausstrahlung des § 580 Nr. 8 ZPO auf andere Prozessordnungen | 652 |
| 2. § 580 Nr. 8 ZPO als lex posterior zu § 31 Abs. 1 BVerfGG: EMRK-freundliche Relativierung der Bindungswirkung von Entscheidungen des BVerfG | 654 |
| 3. Der Wiederaufnahmegrund des § 153 Abs. 1 i.V. mit § 580 Nr. 8 ZPO aus der Warte des historischen Gesetzgebers | 655 |
| a) Die Feststellung einer Konventionsverletzung durch ein Urteil des EGMR | 655 |
| b) Das Erfordernis, dass sich die festgestellte EMRK-Verletzung auf die verwaltungsgerichtliche Entscheidung ausgewirkt hat | 656 |
| c) Die implizite Beschränkung der Wiederaufnahmeklage auf verwaltungsprozessual Beteiligte, die selbst erfolgreich vor dem EGMR Beschwerde geführt haben | 657 |
| 4. Wie verhält sich das gesetzgeberische Verständnis des § 153 Abs. 1 VwGO i.V. mit § 580 Nr. 8 ZPO zur Pflicht zur Beachtung der Rechtskraft und zur Befolgung von EGMR-Urteilen nach der EMRK? | 658 |
| a) Das EGMR-Urteil als Feststellungsurteil | 659 |
| b) Formelle Rechtskraft und materielle Rechtskraft im strengen Sinne | 659 |
| c) Die Befolgungspflicht aus Art. 46 Abs. 1 EMRK als materielle Rechtskraft im weiteren Sinne | 661 |
| aa) Zwei Komponenten: Die Pflicht zur Beendigung der EMRK-Verletzung und die Pflicht zur Wiedergutmachung | 661 |
| bb) Art. 46 EMRK verlangt nicht, die Wiederaufnahme rechtskräftig abgeschlossener Gerichtsverfahren zuzulassen, wohl aber den EMRK-Verstoß so weit wie möglich zu bereinigen | 663 |
| d) Folgerungen aus Art. 46 EMRK für die Auslegung von § 153 Abs. 1 VwGO i.V. mit § 580 Nr. 8 ZPO, insbesondere das Verständnis des „Beruhens“ auf einer EMRK-Verletzung | 665 |
| e) Probleme infolge der Erledigung von Verwaltungsakten bis zur Entstehung des Wiederaufnahmegrundes: Gibt es ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Fortsetzungsfeststellungsklage trotz des EGMR-Urteils? | 669 |
| f) Umstellung auf Fortsetzungsfeststellungsklage im wiederaufgenommenen Verfahren nach Erledigung einer Verpflichtungsklage | 676 |
| g) Zur Möglichkeit, das Verfahren über eine Feststellungsklage wiederaufzunehmen | 677 |
| h) Kann die Wiederaufnahmeklage auch von Dritten erhoben werden, die in gleicher Weise wie der erfolgreiche Beschwerdeführer in ihren Konventionsrechten verletzt sind? | 679 |
| aa) Ausstrahlung einer „Verurteilung“ durch den EGMR auf Parallelfälle | 679 |
| bb) Sind parallel Betroffene befugt, eine Wiederaufnahmeklage zu erheben? | 683 |
| III. Verwaltungsverfahrensrechtliche Wirkungen einer „Verurteilung“ durch den EGMR | 685 |
| 1. Wiederaufgreifen des Verwaltungsverfahrens in den Fällen des § 580 Nr. 8 ZPO | 685 |
| 2. Möglichkeiten der Behörde, einen konventionswidrigen Verwaltungsakt von Amts wegen aufzuheben | 686 |
| IV. Schlussbetrachtung | 687 |
| Klaus Ferdinand Gärditz: Das Sonderverwaltungsprozessrecht des Asylverfahrens | 690 |
| I. Sonderverwaltungsprozessrecht – zum Nischendasein verurteilt? | 690 |
| II. Verfassungsunmittelbares Verwaltungsprozessrecht – ein regelungstechnischer Fehlgriff? | 691 |
| III. Strukturelle Herausforderungen der Verwaltungsgerichte in Asylverfahren | 695 |
| 1. Tatsachenfeststellung oder Tatsachenkonstruktion? | 696 |
| 2. Apokryphes Beweisrecht | 697 |
| 3. Dysfunktionalitäten des geltenden Rechts | 699 |
| IV. Besonderheiten des Verwaltungsprozessrechts im AsylVfG | 700 |
| 1. Die Integration des Prozessrechts in das Verwaltungsverfahren | 701 |
| 2. Das besondere Prozessrecht | 701 |
| a) Beschränkung des Rechtsmittelrechts | 702 |
| b) Beschränkung des Eilrechtsschutzes | 703 |
| c) Das ambivalente Rechtsschutzkonzept des AsylVfG | 706 |
| V. Schlussfolgerungen | 707 |
| Max-Emanuel Geis: Die Feststellungsklage als Normenkontrolle zwischen suchender Dialektik und dogmatischer Konsistenz | 710 |
| I. Die Problematik | 710 |
| II. Rechtsfortbildung im Ping-Pong-Verfahren | 711 |
| 1. „Back to the roots“ | 711 |
| 2. Ping: Der Aufschlag des BVerfG | 713 |
| 3. Pong: Die Antwort des BVerwG | 713 |
| 4. Ping-Pong: Der Beschluss des BVerfG vom 17.01.2006 | 714 |
| III. Die dogmatischen Verwerfungen des Ping-Pong-Spiels | 715 |
| 1. Verwerfungen bei der Zuständigkeit | 715 |
| 2. Die Entwertung des „Rechtsverhältnisses“ | 716 |
| 3. Inkongruenzen bei Antragsberechtigung und Passivlegitimation | 717 |
| 4. Inkongruenzen bei der Rechtswirkung der Entscheidung | 718 |
| 5. Inkongruenz bei den Rechtsmitteln | 719 |
| IV. Zusammenfassung | 719 |
| Torsten Gerhard: Das Verbot der Vollstreckung von Verwaltungsakten als Rechtsfolge prinzipaler Normenkontrollen | 722 |
| I. Die Regelungskonzeption des § 183 VwGO | 723 |
| 1. Konflikt zwischen materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit | 724 |
| 2. Gesetzliche Regelungen zur Lösung dieses Konfliktes | 725 |
| a) Beibehaltung des status quo | 725 |
| b) Vollstreckungsverbot zur Vermeidung einer Verfestigung rechtswidriger Zustände | 725 |
| II. Entsprechende Anwendbarkeit des § 183 VwGO auf Verwaltungsakte | 726 |
| 1. Gesetzgebungshistorie | 727 |
| 2. Systematische und teleologische Erwägungen | 727 |
| 3. Übertragbarkeit des in § 183 VwGO enthaltenen allgemeinen Rechtsgedankens | 728 |
| III. Wirkungen des Vollstreckungsverbotes | 729 |
| 1. Vollstreckungsverbote als Durchbrechung des Grundsatzes der Vollstreckbarkeit rechtswidriger Verwaltungsakte | 729 |
| 2. Begriff der „Vollstreckung“ | 730 |
| 3. Zeitlicher Anwendungsbereich des Vollstreckungsverbotes | 732 |
| 4. Verbot der Vollstreckung von Amts wegen | 733 |
| IV. Prozessuale Möglichkeiten des Betroffenen zur Durchsetzung des Vollstreckungsverbotes | 735 |
| V. Zusammenfassung | 738 |
| Bernd Grzeszick: Kausalität und normative Verantwortlichkeitszuordnung im Rahmen der außervertraglichen Haftung der Europäischen Union | 740 |
| I. Einleitung | 740 |
| II. Europäische Kontrolle der Fusion von Legrand und Schneider | 740 |
| 1. Überblick über das Spannungsfeld und die Bedeutung der EuGH-Entscheidung | 740 |
| 2. Hintergrund: Fusion, Kontrollverfahren und EuG-Urteile | 741 |
| a) Fusion und Kontrollverfahren | 741 |
| b) EuG-Urteile Schneider I und Schneider II | 743 |
| c) Kontrollverfahren nach den EuG-Urteilen | 743 |
| III. EuG-Urteil Schneider III | 744 |
| 1. Urteilsausspruch | 744 |
| 2. Urteilsbegründung | 744 |
| a) Rechtswidrigkeit des Organverhaltens | 744 |
| b) Schaden und Verursachung | 746 |
| c) Mitverantwortung des Geschädigten | 747 |
| IV. Rechtsmittel gegen EuG-Urteil Schneider III und EuGH-Urteil Schneider IV | 747 |
| 1. Rechtsmittel der Kommission gegen EuG-Urteil Schneider III | 747 |
| 2. Schlußantrag des Generalanwalts | 747 |
| 3. EuGH-Urteil Schneider IV | 748 |
| a) Urteilsausspruch | 748 |
| b) Urteilsbegründung | 749 |
| aa) Rechtsverstoß hinreichend qualifiziert | 749 |
| bb) Kausalität als entscheidender Punkt | 749 |
| V. Bewertung | 750 |
| 1. Generelle Stellungnahmen | 750 |
| 2. Haftungsrechtsdogmatische Aspekte | 750 |
| a) Erfordernis einer unmittelbaren oder direkten Kausalverbindung | 751 |
| aa) conditio sine qua non-Test | 751 |
| bb) Mehrheit von Kausalfaktoren und ihre Adäquanz | 752 |
| cc) Zusätzliche Anforderungen und psychische Verursachung | 752 |
| dd) Vergleich der Ansätze von GA Colomer und EuGH | 753 |
| ee) Zuordnung von Verantwortlichkeiten | 755 |
| b) Gefahr eines doppelten Haftungsstandards? | 757 |
| VI. Schlußbetrachtung | 758 |
| Annette Guckelberger: Die Präklusionsregelung des § 47 Abs. 2a VwGO bei der Normenkontrolle | 760 |
| I. Entstehungsgeschichte sowie Sinn und Zweck des § 47 Abs. 2a VwGO | 760 |
| II. Die Bedeutung des § 47 Abs. 2a VwGO | 763 |
| 1. Tatbestandsvoraussetzungen | 763 |
| 2. Rechtsfolgen des § 47 Abs. 2a VwGO | 766 |
| III. Einzelprobleme zu § 47 Abs. 2a VwGO | 769 |
| 1. Anwendbarkeit des § 47 Abs. 2a VwGO bei Flächennutzungsplänen? | 769 |
| 2. Relativierung des Einwendungsausschlusses | 770 |
| 3. Unterschiedliche Präklusionshinweise | 772 |
| 4. Zulässigkeit des Normenkontrollantrags bei ergänzendem Verfahren | 775 |
| IV. Fazit | 776 |
| Dirk Hanschel: Das Widerspruchsverfahren als föderales Experimentierfeld – Plädoyer für ein Fakultativmodell, alternative Streitbeilegung und dezentrale Widerspruchsausschüsse | 778 |
| I. Einleitung | 778 |
| II. Der Bewertungsrahmen: Funktionen des Widerspruchsverfahrens und Kritik | 779 |
| III. Überblick über den Stand der Reformen | 781 |
| 1. Rechtliche Grundlage der Reformbemühungen auf der Bundesebene | 781 |
| 2. Nachfolgende Änderungen auf der Landesebene und ihre Evaluation | 784 |
| a) Bayern | 784 |
| b) Mecklenburg-Vorpommern | 787 |
| c) Niedersachsen | 789 |
| IV. Stellungnahme | 792 |
| 1. Grundsätzliche Beibehaltung des Widerspruchsverfahrens | 792 |
| 2. Ausnahme nur bei evidenter Ineffektivität | 793 |
| 3. Ausgestaltung des Widerspruchsverfahrens als fakultatives Verfahren | 794 |
| 4. Alternative Mittel der Streitbeilegung | 795 |
| a) Keine Ersetzung, sondern Ergänzung des Widerspruchsverfahrens | 795 |
| b) Mediation, Verhandlungen und informelle Absprachen | 797 |
| c) Intensivierung des Informationsaustauschs, insbesondere erweiterte Anhörung | 798 |
| d) Formlose Rechtsbehelfe | 799 |
| 5. Das Modell der Widerspruchsausschüsse | 800 |
| V. Fazit | 801 |
| Friedhelm Hufen: Von der „heimlichen Normenkontrolle“ zur umfassenden Gerichtskontrolle exekutiver Normsetzung | 804 |
| I. Einleitung – Problemstellung | 804 |
| II. Die Feststellungsklage auf Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses aus Rechtsnormen | 806 |
| 1. Rechtsweg und zuständiges Gericht | 806 |
| 2. Beteiligte | 806 |
| 3. Konkretheit des Rechtsverhältnisses | 807 |
| 4. Klagebefugnis | 807 |
| 5. Feststellungsinteresse | 808 |
| III. Zum fortbestehenden Bedürfnis nach prinzipaler Normenkontrolle | 808 |
| 1. Möglichkeiten und Grenzen der Inzidenter-Kontrolle | 808 |
| 2. Aufgaben für den Gesetzgeber | 810 |
| IV. Voraussetzungen einer prinzipalen Normenkontrolle von untergesetzlichem Bundesrecht | 811 |
| 1. Rechtsweg und zuständiges Gericht | 811 |
| 2. Statthaftigkeit | 811 |
| 3. Antragsbefugnis | 811 |
| V. Schlussfolgerung und Ausblick | 812 |
| Christian Hug: Rechtsschutz gegen den Ruhestand | 814 |
| I. Einführung | 814 |
| II. Der Eintritt in den Ruhestand im öffentlichen Dienstrecht | 816 |
| 1. Beamtenrecht | 816 |
| a) Beamte im Bundesdienst | 817 |
| b) Beamte im Landesdienst | 818 |
| 2. Richterrecht | 818 |
| a) Richter im Bundesdienst | 819 |
| b) Richter im Landesdienst | 819 |
| III. Rechtsschutz im Hauptsacheverfahren | 820 |
| 1. Rechtsweg | 820 |
| 2. Statthafte Klageart | 826 |
| 3. Klagebefugnis | 828 |
| a) Beamte | 828 |
| b) Richter im Landesdienst | 834 |
| 4. Vorverfahren, Klagefrist | 834 |
| IV. Rechtsschutz im Eilverfahren | 834 |
| V. Schlussbetrachtung | 836 |
| Martin Ibler: Verwaltungsrechtsschutz des Baunachbarn unmittelbar aus Art. 14 GG versus „Anwendungsvorrang des einfachen Rechts“ | 838 |
| I. Ein konkreter Ausgangspunkt | 838 |
| II. Zum Verhältnis von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG zu Art. 1 Abs. 3 GG | 839 |
| III. Art. 14 GG als Abwehrrecht oder als Schutzpflicht im Baunachbarrecht? | 841 |
| IV. Zur Bedeutung eines Verwaltungsakts, der die baurechtswidrige Nutzung eines Grundstücks ausdrücklich duldet, für das Eigentumsgrundrecht des Nachbarn | 843 |
| V. Der sog. Anwendungsvorrang des einfachen Rechts | 844 |
| VI. Der Anwendungsvorrang des einfachen (Baunachbar)Rechts im Licht der Rechtsschutzgarantie | 846 |
| VII. Ergebnis | 848 |
| Hans D. Jarass: Das Recht auf eine gute Verwaltung, insb. auf ein faires Verwaltungsverfahren | 850 |
| I. | 850 |
| II. | 853 |
| III. | 856 |
| IV. | 859 |
| Karl-Hermann Kästner: Privatisierung kommunaler Einrichtungen – eine rechtliche Bestandsaufnahme | 864 |
| I. Typologie der Privatisierungsformen | 866 |
| 1. Organisationsprivatisierung | 867 |
| a) Erscheinungsformen | 867 |
| b) Einflusssicherung als zentrales Problem der Organisationsprivatisierung | 869 |
| c) Abgrenzung zum Begriff der Public-Private-Partnership | 869 |
| d) Abgrenzung zur Beleihung | 870 |
| 2. Aufgabenprivatisierung | 871 |
| a) Erscheinungsformen | 871 |
| b) Aufgabenprivatisierung und Gewährleistungsverantwortung | 872 |
| 3. Funktionale Privatisierung | 873 |
| a) Erscheinungsformen | 873 |
| b) Betreiber-, Betriebsführungs- und Konzessionsmodell | 874 |
| c) Vergaberechtliche Folgefragen | 875 |
| 4. Vermögensprivatisierung | 875 |
| a) Erscheinungsformen | 875 |
| b) Vermögensprivatisierung zur Finanzierung von Vorhaben | 876 |
| II. Zulässigkeit und Grenzen der Organisationsprivatisierung | 876 |
| 1. Betrieb öffentlicher Einrichtungen durch kommunale Eigengesellschaften | 876 |
| a) Verfassungsrechtliche Grenzen | 877 |
| aa) Staatsstrukturbestimmungen | 877 |
| bb) Beamtenrechtlicher Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG | 878 |
| b) Kommunalrechtliche Grenzen | 879 |
| aa) Vorschriften über den Betrieb öffentlicher Einrichtungen | 879 |
| bb) Anschluss- und Benutzungszwang | 881 |
| cc) Anwendungsbereich | 881 |
| dd) Kommunalwirtschaftsrechtliche Grenzen | 881 |
| c) Spezialgesetzliche Grenzen | 882 |
| 2. Betrieb öffentlicher Einrichtungen durch gemischt-wirtschaftliche Gesellschaften | 884 |
| III. Zulässigkeit und Grenzen der Aufgabenprivatisierung | 885 |
| 1. Eingreifen von Privatisierungsgeboten | 885 |
| 2. Verfassungsrechtliche Grenzen der Aufgabenprivatisierung | 887 |
| a) Garantie der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG | 887 |
| b) Notwendige Staatsaufgaben als Privatisierungsgrenzen | 890 |
| c) Staatsstrukturprinzipien und Grundrechte als Privatisierungsgrenzen | 891 |
| 3. Kommunalrechtliche Grenzen | 891 |
| 4. Spezialgesetzliche Grenzen | 892 |
| IV. Zulässigkeit und Grenzen der funktionalen Privatisierung | 893 |
| 1. Verfassungsrechtliche Grenzen | 893 |
| 2. Kommunalrechtliche Grenzen | 894 |
| 3. Spezialgesetzliche Grenzen | 895 |
| V. Vermögensprivatisierung | 896 |
| 1. Leasingfinanzierung kommunaler Investitionen | 896 |
| 2. Cross-Border-Leasing im Besonderen | 896 |
| a) Eigenart des Cross-Border-Leasing | 897 |
| b) Problempunkte des Cross-Border-Leasing | 898 |
| c) Durch Cross-Border-Leasing aufgeworfene Rechtsfragen | 898 |
| VI. Schluss | 899 |
| Wolfgang Kahl: Verwaltungsprozessuale Probleme der reformatio in peius | 902 |
| I. Einleitung | 902 |
| II. Klagegegenstand | 903 |
| 1. Ursprünglicher Verwaltungsakt in Gestalt des Widerspruchsbescheids | 903 |
| 2. Widerspruchsbescheid | 906 |
| III. Verhältnis von Einheitsklage und isolierter Anfechtungsklage | 908 |
| IV. Klagegegner | 910 |
| 1. Einheitsklage gegen Ausgangs- und Widerspruchsbescheid | 911 |
| 2. Isolierte Anfechtung des Widerspruchsbescheids | 911 |
| V. Aufhebungsentscheidung des Gerichts | 914 |
| VI. Schluss | 916 |
| Hae Ryoung Kim: Die verwaltungsgerichtlichen Klagearten in Korea | 918 |
| Vorrede | 918 |
| I. Einleitung | 918 |
| II. Verwaltungsprozessuale Klagearten in Korea | 919 |
| 1. Über die Anfechtungsklage | 920 |
| 2. Die Ermöglichung einer Fortsetzungsfeststellungsklage durch die KVwGO | 922 |
| 3. Anwendungsmöglichkeit der Anfechtungsklage gegenüber solchem Verwaltungshandeln, das keinen Verwaltungsakt beinhaltet | 923 |
| 4. Über die Partei-Klage zur Klärung von Streitigkeiten über öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse | 924 |
| 5. Über den numerus clausus der Klagearten | 924 |
| 6. Über die Organstreitigkeiten und die Popularklage | 925 |
| III. Das Fehlen von Klagearten zur Sicherung eines angemessenen Rechtsschutzes | 925 |
| 1. Allgemeine Leistungsklage ist nicht statthaft | 925 |
| 2. Keine vorbeugende Unterlassungsklage | 927 |
| 3. Kein verwaltungsgerichtliches abstraktes Normenkontrollverfahren | 927 |
| 4. Die Möglichkeit einer Normerlassklage? | 928 |
| IV. Jüngste Vorhaben zur Novellierung der KVwGO | 929 |
| V. Schluss | 933 |
| Franz-Ludwig Knemeyer: Von der rechtmäßigen zur auch guten Verwaltung | 934 |
| I. Bemühungen um eine Gute Verwaltung – Der Hintergrund | 934 |
| II. Zügige Verwaltungsverfahren – zügiges Verwaltungshandeln – ein zentrales Ziel guter Verwaltung | 938 |
| 1. Rechtliche Grundsatzregelungen für zügige Verwaltungsverfahren | 938 |
| 2. Zur Rechtsnatur und Bedeutung des Prinzips der Zügigkeit | 939 |
| 3. Zügigkeit außerhalb von Verwaltungsverfahren im Sinne von § 9 VwVfG | 940 |
| III. Das allgemeine Prinzip guter Verwaltung – Good Administration. Gute Verwaltung – Bürgerrecht und Leitlinie für eine integre Verwaltung. Gute Verwaltung durch selbst gesetzte Behördenverfassung | 941 |
| 1. Erweiterung des Blicks in nicht formalrechtlich fassbares Verwaltungshandeln | 941 |
| 2. Auslöser für Good-Administration-Aktivitäten | 942 |
| 3. Erweiterung von Kodizes zu einem umfassenden Behörden-Innenrecht, einer eigenständig gesetzten selbständigen „Behördenverfassung“ | 943 |
| Jürgen Kohl: Baden verboten am Rheinischen Lido | 946 |
| I. Einleitung | 946 |
| II. Die geschichtliche Entwicklung des Rheinstrandbades in Mannheim | 947 |
| III. Rechtliche Grundlagen | 951 |
| 1. Gemeingebrauch an öffentlichen Gewässern | 951 |
| 2. Einschränkungen des Gemeingebrauchs an Gewässern | 952 |
| a) Durch das Bundeswasserstraßengesetz | 952 |
| b) Einschränkungen des Gemeingebrauchs durch § 28 Abs. 2 bzw. § 30 Abs. 2 WasG BW | 952 |
| c) Beschränkung des Gemeingebrauchs durch Benutzungsordnungen für öffentliche Einrichtungen | 953 |
| d) Einschränkungen des Gemeingebrauchs durch Allgemeines Polizeirecht | 954 |
| 3. Gedanke der Selbstgefährdung | 954 |
| 4. Rechtsschutz | 955 |
| IV. Schlussbetrachtung | 956 |
| Klaus Lange: Der Kommunalverfassungsstreit | 960 |
| I. Das Thema | 960 |
| II. Abgrenzung des Kommunalverfassungsstreits | 960 |
| III. Die Beteiligungsfähigkeit | 963 |
| IV. Klageart | 966 |
| 1. Kein Ausschluss der Gestaltungsklage | 966 |
| 2. Die Feststellungsklage | 969 |
| V. Klagebefugnis | 971 |
| VI. Kosten | 973 |
| VII. Ergebnis | 975 |
| Hans-Werner Laubinger: Der Rechtsschutz kirchlicher Bediensteter | 976 |
| I. Einführung in die Problematik | 976 |
| II. Die Rechtsstellung der kirchlichen Bediensteten | 976 |
| 1. Kirchen und nichtkorporierte Religionsgemeinschaften | 976 |
| 2. Kirchenbeamte | 977 |
| 3. Pfarrer | 978 |
| 4. Privatrechtlich Beschäftigte der Kirchen | 980 |
| 5. Mitarbeitervertretungsrecht | 981 |
| III. Rechtsschutz der privatrechtlich Beschäftigten der Kirchen | 981 |
| 1. Arbeitsrechtsweg | 982 |
| 2. Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht | 983 |
| 3. Individualbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte | 983 |
| IV. Rechtsschutz der Kirchenbeamten und Pfarrer | 984 |
| 1. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts | 984 |
| 2. Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte | 988 |
| 3. Die Rechtsprechung der Zivilgerichte | 992 |
| 4. Die Ansätze für den Zugang von Pfarrern und Kirchenbeamten zu den staatlichen Gerichten im Überblick | 995 |
| V. Lösungsvorschlag | 1002 |
| 1. Justizgewährungspflicht und Justizgewährungsanspruch | 1002 |
| 2. Staatliches Recht und kirchliches Recht | 1003 |
| 3. Die Beschränkung der staatlichen Justizgewährungspflicht durch das kirchliche Selbstbestimmungsrecht | 1005 |
| 4. Die Eröffnung des staatlichen Rechtswegs bei Rüge der Verletzung kirchlichen Rechts | 1010 |
| a) Verzicht auf die Einrichtung einer rechtsstaatlichen Anforderungen genügenden kirchlichen Gerichtsbarkeit | 1010 |
| b) Kirchliche Ermächtigung der staatlichen Gerichte zur Überprüfung kirchlicher Maßnahmen am Maßstab des kirchlichen Rechts | 1011 |
| 5. Ausschluss bestimmter Maßnahmenarten von der gerichtlichen Überprüfung | 1012 |
| VI. Resümierende Schlussbemerkung | 1012 |
| Hartmut Maurer: Rechtsschutz gegen Verkehrszeichen | 1014 |
| I. Einführung | 1014 |
| II. Rechtsgrundlagen | 1014 |
| III. Die Rechtsform des Verkehrszeichens | 1015 |
| 1. Die Entwicklung von der Rechtsverordnung zum Verwaltungsakt | 1015 |
| 2. Die verschiedenen Argumente pro und contra | 1017 |
| 3. Die Regelung des VwVfG | 1017 |
| IV. Rechtsschutz | 1019 |
| 1. Problematik | 1019 |
| 2. Die Rechtsprechung zur Anfechtung der Verkehrszeichen | 1019 |
| V. Stellungnahme | 1021 |
| 1. Öffentliche Bekanntmachung? | 1021 |
| 2. Die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 IV GG | 1022 |
| 3. Bestandskraft | 1023 |
| 4. Wiederaufgreifen des Verfahrens als Alternative? | 1024 |
| VI. Polizeiliches Abschleppen eines Kraftfahrzeugs wegen eines erst nachträglich aufgestellten Parkverbotsschildes | 1025 |
| Hiroaki Murakami: Der effektive Rechtsschutz im japanischen Verwaltungsprozessrecht – Bedeutung und Grenzen der Reform 2004 | 1028 |
| I. Einleitung | 1028 |
| II. Entwicklungen bis zum Erlass des Verwaltungsprozessgesetzes von 1962 | 1028 |
| 1. Verwaltungsprozess unter der Meiji-Verfassung | 1028 |
| 2. Reformen nach dem Zweiten Weltkrieg | 1029 |
| III. Verwaltungsprozess vor der Reform 2004 | 1030 |
| 1. System des Verwaltungsprozesses | 1030 |
| a) Klagearten | 1030 |
| b) Verwaltungsprozess und Zivilprozess | 1030 |
| c) Objektive Klage und subjektive Klage | 1031 |
| d) „Nicht benannte Anfechtungsklage im weiteren Sinne“ | 1031 |
| e) „Aufhebungsklagezentrismus“ | 1032 |
| 2. Klagevoraussetzungen | 1032 |
| a) Gegenstand der Klage | 1032 |
| b) Klagebefugnis | 1033 |
| c) Nachträglicher Verlust des rechtlichen Interesses | 1033 |
| d) Beklagter | 1033 |
| e) Zuständige Gerichte | 1034 |
| f) Klagefrist | 1034 |
| g) Vorverfahren | 1034 |
| 3. Verfahren | 1034 |
| 4. Urteil | 1035 |
| a) „Umstandurteil“ | 1035 |
| b) Drittwirkung des Aufhebungsurteils | 1035 |
| c) Bindungskraft des Aufhebungsurteils für die Verwaltungsbehörden | 1035 |
| 5. Vorläufiger Rechtsschutz | 1036 |
| a) Strenge Voraussetzungen der Aussetzung der Vollziehung | 1036 |
| b) Defizite des vorläufigen Rechtsschutzes | 1036 |
| c) Einspruch des Ministerpräsidenten | 1036 |
| 6. Zusammenfassung: Desinteresse an der Effektivität des Rechtsschutzes | 1037 |
| IV. Die Reform 2004 | 1037 |
| 1. Zweck der Reform | 1037 |
| 2. Klagearten | 1037 |
| a) Verpflichtungsklage | 1037 |
| b) Unterlassungsklage | 1038 |
| c) Öffentlich-rechtliche Feststellungsklage | 1038 |
| 3. Klagevoraussetzungen | 1039 |
| a) Klagebefugnis | 1039 |
| b) Veränderung der Regelungen über den Beklagten | 1039 |
| c) Erweiterung der zuständigen Gerichte | 1039 |
| d) Verlängerung der Klagefrist | 1040 |
| e) Einführung der Klagebelehrung | 1040 |
| 4. Verfahren | 1040 |
| 5. Vorläufiger Rechtsschutz | 1040 |
| a) Lockerung der Voraussetzungen der Aussetzung der Vollziehung | 1040 |
| b) Einführung der einstweiligen Verpflichtung und Unterlassung | 1041 |
| 6. Zusammenfassung: Bedeutung der Reform für den effektiven Rechtsschutz | 1041 |
| V. Grenzen der Reform 2004 | 1042 |
| 1. System des Verwaltungsprozesses | 1042 |
| a) Verpflichtungsklage und Unterlassungsklage | 1042 |
| b) Rechtsschutz gegen andere Akte als Verfügungen | 1042 |
| c) Schwierigkeit der Klagewahl | 1042 |
| 2. Klagevoraussetzungen der Aufhebungsklage | 1043 |
| a) Gegenstand der Klage | 1043 |
| b) Klagebefugnis | 1043 |
| c) Nachträglicher Verlust des rechtlichen Interesses | 1043 |
| 3. Vorläufiger Rechtsschutz | 1044 |
| a) Voraussetzungen des vorläufigen Rechtsschutzes | 1044 |
| b) Einspruch des Ministerpräsidenten | 1044 |
| VI. Fazit | 1044 |
| Jost Pietzcker: Der „Rechtswidrigkeitszusammenhang“ beim Verwaltungszwang | 1046 |
| I. | 1046 |
| II. | 1047 |
| III. | 1048 |
| IV. | 1050 |
| V. | 1053 |
| VI. | 1058 |
| VII. | 1059 |
| Thomas Puhl: Abgabenverschonung als Finanzierung? – Gedanken zum kartellvergaberechtlichen Auftraggeberbegriff | 1062 |
| I. Die Bedeutung des kartellvergaberechtlichen Auftraggeberbegriffs | 1063 |
| II. Der funktionale Auftraggeberbegriff des Kartellvergaberechts | 1065 |
| III. Öffentliche Finanzierung i.S.v. § 98 Nr. 2 GWB | 1068 |
| 1. Allgemeine Kriterien des EuGH | 1068 |
| 2. Definitionen in Literatur und Rechtsprechung | anerkannte Formen der Staatsfinanzierung | 1073 |
| IV. Die Abgabenverschonung als Finanzierung i.S.v. § 98 Nr. 2 GWB | 1077 |
| 1. Grundlagen | 1077 |
| a) Parallelen zum Beihilfenrecht | 1077 |
| b) Forderungsverzicht und Verschonungssubventionen als „Finanzierung“ | 1080 |
| 2. Die mangelnde Steuersubjektqualität juristischer Personen des öffentlichen Rechts | 1082 |
| 3. Allgemeine Steuervergünstigungen wegen „Gemeinnützigkeit“ | 1083 |
| a) Körperschaft- und Gewerbesteuer | 1084 |
| b) Erbschaft- und Schenkungsteuer | Grundsteuer | 1086 |
| c) Umsatzsteuer | 1087 |
| 4. Spezielle Steuervergünstigungen | 1088 |
| 5. Sonstige Abgabenverschonungen | 1088 |
| V. Resümee | 1089 |
| Ulrich Ramsauer: Stabilität und Dynamik des Verwaltungsverfahrensrechts | 1090 |
| I. Einführung | 1090 |
| II. Das Verwaltungsverfahrensgesetz als „geronnene Rechtsdogmatik“ | 1091 |
| III. Das Verwaltungsverfahrensgesetz als lex imperfecta | 1092 |
| 1. Beschränkungen des Anwendungsbereichs | 1092 |
| a) Verwaltungsverfahrensgesetze in Bund und Ländern | 1092 |
| b) Das Subsidiaritätsprinzip | 1094 |
| c) Die Dreisäulentheorie | 1095 |
| 2. Das Verwaltungsverfahrensgesetz als Teilkodifikation | 1096 |
| a) Beschränkung auf öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit | 1096 |
| b) Auf Verwaltungsakte bzw. Verwaltungsverträge gerichtete Verfahren | 1098 |
| c) Beschränkung auf die „nach außen wirkende“ Verwaltungstätigkeit | 1098 |
| d) Die Ausnahmen des § 2 Abs. 2 und 3 VwVfG | 1099 |
| e) Sonst fehlende verfahrensrechtliche Regelungen | 1099 |
| 3. Die „Verlustliste“ der Verwaltungsverfahrensgesetze | 1100 |
| a) Die selbständige Kodifikation der Umweltverträglichkeitsprüfung | 1100 |
| b) Informations-, Akteneinsichts- und Auskunftsrechte, Datenschutz | 1100 |
| IV. Die Herausforderungen der Europäisierung | 1101 |
| V. Die bisherigen Novellierungen | 1102 |
| VI. Das Verfahrensrecht zwischen Konstanz und Veränderung | 1103 |
| 1. Weiterentwicklung als Aufgabe | 1103 |
| 2. Gebot der Einheitlichkeit des Verwaltungsverfahrens als Prüfstein | 1104 |
| 3. Keine Zeit für „große Würfe“ | 1105 |
| Wolfgang Roth: Grundsatzrevision bei ausgelaufenem Unionsrecht | 1108 |
| I. Keine Grundsatzrevision zur Klärung ausgelaufenen oder auslaufenden Rechts | 1108 |
| 1. Begriff der grundsätzlichen Bedeutung | 1108 |
| 2. Grundsätzlich keine grundsätzliche Bedeutung ausgelaufenen oder auslaufenden Rechts | 1109 |
| 3. Ausnahmsweise grundsätzliche Bedeutung ausgelaufenen oder auslaufenden Rechts | 1109 |
| II. Fortschreibung durch das Bundesverwaltungsgericht: Keine Grundsatzrevision zur Klärung ausgelaufenen oder auslaufenden Unionsrechts | 1111 |
| III. Konsequenzen für die Grundsatzberufung | 1113 |
| IV. Grundsatzrevision zur Vorlage ausgelaufenen oder auslaufenden Unionsrechts an den Europäischen Gerichtshof | 1113 |
| 1. Vorlagepflicht letztinstanzlich entscheidender Gerichte | 1114 |
| 2. Grundsatzrevision zur Ermöglichung der Vorlage | 1115 |
| V. Bundesverfassungsgerichtliche Kontrolle einer Vorlagepflichtverletzung durch Nichtzulassung der Revision | 1120 |
| 1. Verfassungsgerichtlicher Kontrollmaßstab | 1120 |
| 2. Offensichtlicher Verstoß gegen Art. 267 Abs. 3 AEUV bei Nichtvorlage wegen Auslaufens des Unionsrechts | 1120 |
| VI. Ergebnis | 1122 |
| Bernd Schieferdecker: Kontingentierung von Nutzungsmöglichkeiten im Baurecht – insbesondere für Einzelhandelsbetriebe | 1124 |
| I. Einleitung | 1124 |
| II. Nutzungskontingentierung in den typisierten Baugebieten (§§ 2–9 BauNVO) | 1125 |
| 1. Gebietsbezogenes Nutzungskontingent | 1125 |
| a) Verfassungsrechtliche und europarechtliche Vorfragen | 1125 |
| b) Keine gesetzliche Ermächtigung in § 9 Abs. 1 BauGB | 1127 |
| c) Keine gesetzliche Ermächtigung in § 1 Abs. 5ff. BauGB | 1127 |
| d) Keine gesetzliche Ermächtigung in §§ 16ff. BauNVO | 1128 |
| e) Gesetzliche Ermächtigung in § 9 Abs. 2 BauGB | 1129 |
| aa) Besondere Fälle | 1129 |
| bb) Bestimmte im Bebauungsplan festgesetzte bauliche Nutzungen und Anlagen | 1129 |
| cc) Eintritt bestimmter Umstände als Bedingung | 1130 |
| dd) Einfluss der Planbetroffenen auf den Bedingungseintritt? | 1132 |
| ee) Abwägung | 1133 |
| f) Ergebnis | 1133 |
| 2. Nutzungskontingentierung im Rahmen von Ausnahmeentscheidungen | 1134 |
| a) Unzulässigkeit auch der Kontingentierung ausnahmsweise zulassungsfähiger Nutzungen | 1134 |
| aa) Städtebauliche Rechtfertigung | 1134 |
| bb) § 31 Abs. 1 BauGB ist keine Rechtsgrundlage für die Bestimmung von Art und Umfang der zulässigen Ausnahmen | 1134 |
| cc) § 1 Abs. 5 und 9 BauGB erlauben keine Beschränkung des Umfangs der zulässigen Ausnahmen | 1135 |
| dd) § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO erlauben nicht die Festsetzung von Ermessensgrenzen | 1136 |
| b) Ausnahme ohne verbindliche Kontingentierung | 1137 |
| III. Nutzungskontingentierung in Sondergebieten | 1137 |
| 1. Gebietsbezogenes Nutzungskontingent | 1138 |
| 2. Nutzungskontingentierung bei Zulässigkeit nur eines einzigen Betriebs | 1139 |
| a) Anforderungen nach der Rechtsprechung | 1139 |
| aa) Irrelevanz der Eigentumsverhältnisse | 1140 |
| bb) Irrelevanz der derzeitigen oder beabsichtigten Nutzung | 1140 |
| cc) Ein Betrieb bei Agglomeration | 1141 |
| dd) Ausschluss mehrerer Betriebe durch Bebauungsplan | 1141 |
| b) Festsetzung von SO-Teilgebieten | 1141 |
| c) Kritik | 1142 |
| aa) Unterschiedliche Zulässigkeit je nach der Zahl der zulässigen Anlagen? | 1142 |
| bb) Beschränkung der Zahl zulässiger Anlagen ist keine vorhabenbezogene Festlegung | 1143 |
| cc) Prioritätskonflikt, Windhundrennen | 1143 |
| dd) Fazit | 1144 |
| 3. Festsetzung einer grundflächenabhängigen Verkaufsflächenquote | 1145 |
| IV. Zusammenfassung | 1145 |
| Eberhard Schmidt-Aßmann: In-camera-Verfahren | 1148 |
| I. Unterschiedliche Erscheinungsformen von in-camera-Verfahren | 1150 |
| 1. In-camera-Verfahren als Zwischenverfahren | 1150 |
| a) Das isolierte Zwischenverfahren des § 99 VwGO | 1151 |
| b) Das integrierte Zwischenverfahren des § 138 TKG | 1152 |
| c) Das versteckte in-camera-Verfahren des § 72 GWB | 1154 |
| 2. In-camera-Verfahren in der Hauptsache | 1156 |
| II. Verfassungsfragen des in-camera-Verfahrens | 1157 |
| 1. Generalangriff auf § 99 Abs. 2 VwGO | 1158 |
| 2. Einige retardierende Zwischenüberlegungen | 1159 |
| a) Geheimnisschutz als wirksamer Schutz | 1160 |
| b) Rechtliches Gehör | 1162 |
| c) Drohpotential des EU-Rechts? | 1164 |
| 3. Für ein gesetzliches Kern-Schalen-Konzept im Recht der in-camera-Verfahren | 1165 |
| Matthias Schmidt-Preuß: Die Konfliktschlichtungsformel | 1168 |
| I. Der Stellenwert des subjektiven öffentlichen Rechts | 1168 |
| II. Die bipolare Begrenztheit der Schutznormtheorie | 1168 |
| 1. Die Schutznormtheorie als eingliedrige Interessenschutzformel | 1168 |
| 2. Die Vermutung der Freiheit als limitierender Faktor: von Bühler zu Bachof | 1169 |
| III. Multipolare Konfliktlagen | 1170 |
| 1. Multipolarität und das anspruchsbegründende sowie -maßstabsbildende Horizontalverhältnis | 1170 |
| 2. Multipolarität in der Rspr. des BVerfG | 1171 |
| a) TK-rechtliche Entgeltregulierung und Geheimnisschutz | 1171 |
| b) Der Schutz des Versicherten in der kapitalbildenden Lebensversicherung | 1173 |
| IV. Multipolarität und Grundrechte | 1175 |
| 1. Die Konfliktschlichtungsprärogative des Gesetzgebers | 1175 |
| 2. Multipolare Grundrechtskollision | 1175 |
| V. Multipolare Eckwerte | 1176 |
| 1. Die fünf multipolaren Grundkonstellationen | 1176 |
| 2. Kehrseitigkeit und Wechselbezüglichkeit | 1177 |
| VI. Die Konfliktschlichtungsformel | 1178 |
| VII. Dignität der Freiheit oder Mechanik des Gesetzesvollzugs | 1179 |
| 1. Der Inhalt des subjektiven öffentlichen Rechts | 1179 |
| 2. Klagemöglichkeiten ohne Rechte | 1180 |
| 3. Raum für weitere Ausnahmen | 1180 |
| VIII. Vorgaben des EU-Rechts? | 1181 |
| 1. Konsistenz mit EU-Recht | 1181 |
| 2. Nicht umgesetzte Richtlinien | 1182 |
| IX. Die Verbandsklage im Umweltsektor | 1184 |
| 1. Der Ausnahmefall kollektiven Rechtsschutzes | 1184 |
| a) Die naturschutzrechtliche Verbandsklage | 1184 |
| b) Die Verbandsklage nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz | 1184 |
| 2. Das Trianel-Urteil des EuGH vom 12.5.2011 | 1185 |
| a) Interessentenklage oder Rechtsverletzungs-Modell | 1185 |
| b) Keine Folgerungen für die Einzelrechtsposition | 1186 |
| X. Ausblick | 1186 |
| Friedrich E. Schnapp: Der trialistische Behördenbegriff | 1188 |
| I. Einführung | 1188 |
| II. Juristische Person und Behörde im Verwaltungsaufbau | 1189 |
| 1. Vorüberlegungen zur Rechtsfähigkeit | 1189 |
| 2. Organisationsrechtlicher Numerus clausus? | 1192 |
| 3. Organ und Behörde | 1193 |
| III. Der funktionale Behördenbegriff | 1196 |
| IV. Der prozessuale Behördenbegriff | 1201 |
| V. Fazit | 1205 |
| Friedrich Schoch: Entbehrlichkeit des Vorverfahrens nach der VwGO kraft Richterrechts | 1208 |
| I. Das Widerspruchsverfahren zwischen Funktionsauftrag und Kritik | 1208 |
| 1. Das Widerspruchsverfahren als Sachentscheidungsvoraussetzung | 1208 |
| 2. Sukzessive gesetzliche Abschaffung des Widerspruchsverfahrens | 1209 |
| II. Richterrechtliche Ausnahmen vom Vorverfahren | 1210 |
| 1. Grundlagen | 1211 |
| 2. Fallgruppen | 1211 |
| III. Kritik des Schrifttums | 1213 |
| 1. Konzept des § 68 VwGO | 1213 |
| 2. Konkretisierung der Prinzipien | 1214 |
| a) Rügelose Einlassung auf die Klage | 1215 |
| b) Voraussichtliche Erfolglosigkeit des Widerspruchs | 1216 |
| IV. Verteidigung des Richterrechts durch das BVerwG | 1216 |
| 1. Der Fall | 1217 |
| 2. Argumentation des BVerwG und Kritik | 1218 |
| a) Gesetzeswortlaut | 1218 |
| b) Entstehungsgeschichte | 1219 |
| c) Gesetzessystematik | 1219 |
| d) Gesetzeszweck | 1220 |
| 3. Anwendung des Richterrechts auf den Fall | 1221 |
| a) Aufsichtsbehördliche Weisung | 1221 |
| b) Verbindliche Anordnung der Sachentscheidung | 1222 |
| V. Fazit: Herrschaft der Richter über das Vorverfahren | 1223 |
| Christoph Sennekamp: Ausgewählte Fragen des Rechtsschutzes gegen Veränderungssperre und Zurückstellung | 1226 |
| I. Rechtsschutz gegen die Veränderungssperre | 1226 |
| 1. Der Streit um die Normgeltung | 1226 |
| a) Statthaftigkeit des Normenkontrollantrags (§ 47 VwGO) | 1228 |
| b) Statthafte Klageart | 1229 |
| 2. Der Streit um das Außer-Kraft-Setzen | 1230 |
| a) Wirkung des Außer-Kraft-Setzens | 1230 |
| b) Verwaltungsprozessuale Umsetzung | 1232 |
| II. Rechtsschutz gegen die Zurückstellung | 1234 |
| 1. Zurückstellung als Verwaltungsakt | 1235 |
| 2. Rechtsbehelfsfähigkeit der Zurückstellung (§ 44a VwGO) | 1236 |
| 3. „Isolierte“ Anfechtbarkeit der Zurückstellung? | 1237 |
| III. Schluss | 1240 |
| Jong Hyun Seok: Die Enteignung zugunsten des privaten Unternehmers in Korea | 1242 |
| Geleitwort | 1242 |
| I. Einleitung | 1243 |
| 1. Problemstellung | 1243 |
| 2. Der Begriff der Unternehmerstadt | 1244 |
| II. Hintergründe der Einführung der Unternehmerstadt | 1244 |
| 1. Beschleunigung der unternehmerischen Investitionen und Stärkung der Konkurrenzfähigkeit des Staates | 1245 |
| 2. Beitrag zur harmonisierten Staatsentwicklung durch die Verstärkung der Renovationsfähigkeiten auf der kommunalen Ebene | 1245 |
| III. Gesetzliche Grundlagen für die Enteignung | 1246 |
| 1. Art. 23 Abs. 3 Koreanische Verfassung | 1246 |
| 2. Das Enteignungs- und Entschädigungsgesetz | 1248 |
| a) Die Verwirklichung öffentlicher Interessen als Enteignungsvorausetzung | 1248 |
| b) Staatliche Anerkennung eines Vorhabens als Vorhaben im öffentlichen Interesse | 1249 |
| IV. Ausnahmeregelung zur Enteignung des Vorhabensträgers zugunsten Privater | 1250 |
| 1. Vorbemerkung | 1250 |
| 2. Typ I der Sondergesetze für die Enteignung zugunsten der Privaten | 1250 |
| 3. Typ II der Sondergesetze für die Enteignung zugunsten der Privaten | 1251 |
| 4. Typ III der Sondergesetze für die Enteignung zugunsten der Privaten | 1253 |
| a) Entwicklungsgebiet der Unternehmerstadt | 1253 |
| aa) Vorschlag zur Festsetzung als Entwicklungsgebiet | 1253 |
| bb) Festsetzung des Bauministers | 1254 |
| b) Rechtswirkung der Festsetzung | 1254 |
| c) Festsetzung des Vorhabensträgers | 1255 |
| c) Billigung des Entwicklungsplans | 1255 |
| 5. Billigung des Durchführungsplans | 1256 |
| a) Billigungsverfahren | 1256 |
| b) Die Rechtswirkung der Billigung | 1257 |
| 6. Würdigung | 1257 |
| V. Die Lehrmeinung zur Frage der Enteignung zugunsten der Privaten | 1257 |
| VI. Schlusswort | 1259 |
| Helge Sodan: Das Merkmal der Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art in § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO | 1260 |
| I. Einleitung | 1260 |
| II. Allgemeines zum Merkmal der nichtverfassungsrechtlichen Streitigkeit | 1261 |
| III. Die unterschiedlichen Interpretationsansätze | 1263 |
| 1. Formelle Abgrenzung | 1263 |
| 2. Materielle Abgrenzungstheorien | 1266 |
| a) Doppelte Verfassungsunmittelbarkeit | 1266 |
| b) Materielle Subjektstheorie | 1269 |
| 3. „Gemischte“ Theorien | 1272 |
| a) Abgestufte Prüfung | 1272 |
| b) Schenkes Ansatz | 1273 |
| Udo Steiner: Zum Stand des verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzes in Deutschland | 1278 |
| I. Vom Notrechtsschutz der Nachkriegszeit zum Rechtsschutzstaat der Gegenwart | 1278 |
| 1. Der Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg | 1278 |
| 2. Aufbau und Abbau des Verwaltungsrechtsschutzes | 1278 |
| II. Verwaltungsverfahren als vorgelagerter Rechtsschutz | 1279 |
| 1. Funktionsverlust des Verwaltungsverfahrens | 1279 |
| 2. Das Fehlerfolgenkonzept des Gesetzgebers | 1281 |
| 3. Weitere Schritte zur rechtlichen Stabilisierung von Verwaltungsentscheidungen | 1282 |
| 4. Perspektiven | 1283 |
| III. Die Gegenwartslage des verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzes | 1284 |
| 1. Das Rollenverständnis der Verwaltungsgerichtsbarkeit | 1284 |
| 2. Strukturfragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit | 1286 |
| IV. Grundgesetzliche Vorgaben für einen effektiven Rechtsschutz | 1288 |
| 1. Justizgewährung und Justizgrundrechte | 1288 |
| 2. Rechtsschutzgarantie und Suspensiveffekt | 1289 |
| 3. Rechtsschutzorientierte Interpretation der Prozessordnung | 1290 |
| V. Versuch einer Bilanz | 1291 |
| Rolf Stober, Zur Entwicklung des Wirtschaftsüberwachungsrechts | 1292 |
| I. Zum Engagement des Jubilars im Schnittfeld zwischen Verwaltungs- und Wirtschaftsrecht | 1292 |
| II. Wirtschaftsüberwachung als Korrektiv von Verkehrsfreiheiten und Wirtschaftsgrundrechten | 1292 |
| III. Wirtschaftsüberwachung als Gewährleistungs- und Regulierungsüberwachung | 1293 |
| IV. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Wirtschaftsüberwachung | 1294 |
| V. Wirtschaftsüberwachung versus Wirtschaftsaufsicht ? | 1294 |
| VI. Wirtschaftsüberwachung im Binnenmarkt | 1296 |
| VII. Gefahrenabwehr, Gefahrenvorsorge, Risiko- und Marktüberwachung | 1297 |
| 1. Gefahrenbewältigung im Präventionsstaat | 1297 |
| 2. Gefahrenabwehr und Risikomanagement | 1297 |
| VIII. Schutzgüter der Wirtschaftsüberwachung | 1298 |
| 1. Einzelne Rechtsgüterschutztypen | 1298 |
| 2. Verbraucherschutzrecht als Wirtschaftsüberwachungsrecht | 1299 |
| IX. Ausgewählte Instrumente der Wirtschaftsüberwachung | 1299 |
| X. Staatliche Wirtschaftsüberwachung und unternehmerische Eigenverantwortung | 1300 |
| 1. Wirtschaftsüberwachung und Kooperationsprinzip | 1300 |
| 2. Erledigung von Wirtschaftsüberwachungsaufgaben durch Private | 1301 |
| a) Einschaltung Privater, Aufgabenprivatisierung und Zertifizierung | 1301 |
| b) Zur DIN-Normierung von Dienstleistungen | 1302 |
| 3. Unternehmerische Eigenüberwachung und Selbstbeschränkung | 1303 |
| a) Eigenüberwachung als Wettbewerbs-, Marketing- und Umweltfaktor | 1303 |
| b) Selbstzertifizierung | 1304 |
| c) Selbstbeschränkungsabkommen | 1304 |
| XI. Internationalisierung der Wirtschaftsüberwachung | 1304 |
| Rainer Wahl: Wie entsteht ein neues Rechtsgebiet: Das Beispiel des Informationsrechts | 1306 |
| I. Wie entsteht ein neues Rechtsgebiet? | 1306 |
| 1. Aufgabenabhängigkeit neuer Rechtsgebiete im Öffentlichen Recht | 1306 |
| 2. Der Beginn eines neuen Rechtsgebiets – Um-Interpretation vorhandener Rechtsmaterien und Einordnung unter ein umfassenderes Konzept | 1307 |
| 3. Ein Rechtsgebiet – die Interdependenz dreier Reflexions-Ebenen: die drei Ebenen des Informationsrechts | 1311 |
| 4. Exkurs: Interdependenz dreier Reflexions-Ebenen allgemein im (Öffentlichen) Recht | 1312 |
| 5. Die Abfolge neuer Rechtsgebiete in den letzten Jahrzehnten | 1313 |
| II. Erste Ebene: das positive Recht und seine dogmatisch-systematische Durchdringung | 1313 |
| 1. Die Abgrenzung des Rechtsgebiets | 1313 |
| 2. Grundbegriffe und Bausteine | 1315 |
| 3. Aufgaben der Dogmatik auf dieser ersten Ebene | 1316 |
| 4. Einige Beobachtungen über Neues am Informationsrecht | 1317 |
| III. Die mittlere Ebene der Reflexion: Prinzipien, neue Institute und neue Systemgedanken | 1318 |
| 1. Notwendigkeit von Umorientierungen | 1318 |
| 2. Regelungskonzepte | 1319 |
| 3. Systembildende Konzepte und Institute | 1319 |
| IV. Die gesellschafts- und staatstheoretische Ebene | 1322 |
| 1. Überlegungen zur dritten Ebene im Informationsrecht | 1322 |
| 2. Der innere Zusammenhang zwischen den verschiedenen drei Ebenen der Reflexion | 1324 |
| Jan Ziekow: Zur Zulässigkeit der Klage eines Bundeslandes gegen die Festlegung von Flugrouten | 1326 |
| I. Verfahren der Flugroutenfestlegung | 1327 |
| II. Statthaftigkeit der Feststellungsklage und Bestehen des Feststellungsinteresses | 1330 |
| III. Bestehen der Klagebefugnis | 1331 |
| 1. Klagen natürlicher und privater juristischer Personen | 1331 |
| a) Natürliche Personen | 1331 |
| aa) Berufung auf eine Schutznorm | 1331 |
| bb) Geltendmachung einer möglichen Rechtsverletzung | 1334 |
| 2. Klagen kommunaler Gebietskörperschaften | 1337 |
| 3. Klagemöglichkeiten eines Bundeslandes | 1339 |
| a) Klage des Landes selbst | 1339 |
| b) Klage eines Betriebes oder Unternehmens, an dem das Land beteiligt ist | 1341 |
| aa) Juristische Personen des öffentlichen Rechts | 1341 |
| bb) Juristische Personen des Privatrechts | 1342 |
| IV. Zusammenfassung | 1343 |
| Egon Lorenz: Über Festschriften | 1348 |
| I. Meine schwierige Lage | 1348 |
| II. Die Ablenkung: Ein Plädoyer gegen Festschriften | 1348 |
| III. Die Würdigung des Plädoyers | 1349 |
| 1. Allgemeines | 1349 |
| 2. Zu einigen Einzelheiten des Plädoyers | 1352 |
| a) Die Überschrift | 1352 |
| b) Vom Entsorgen und Verhindern von Büchern | 1352 |
| c) Eine glücklicherweise (für sich) gefundene Lösung | 1354 |
| 3. Ergebnis | 1355 |
| Schriftenverzeichnis | 1356 |
| I. Monographien | 1356 |
| II. Beiträge in Sammelwerken | 1357 |
| III. Aufsätze | 1361 |
| IV. Buchbesprechungen | 1368 |
| Autorenverzeichnis | 1372 |