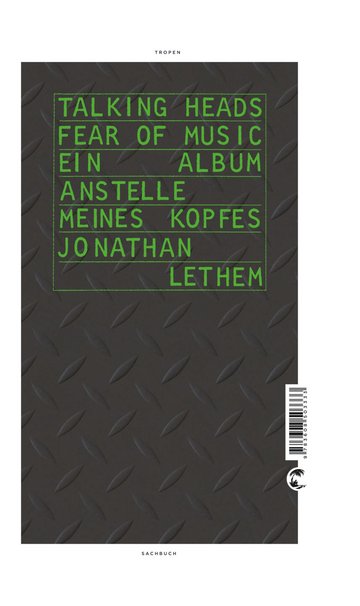I ZIMBRA
Der sich windende Ausnahmezustand, den »I Zimbra« darstellt, hat bereits Höchstgeschwindigkeit erreicht, bevor man sich darauf einstellen kann. Es ist eine Übertragung aus Morsezeichen und stroboskopisch-geschrammelter Gitarre, die uns gleich in die Zukunft der Platte (dystopisch) und der Band (utopisch) katapultiert. In dieser Dopplung aber bleibt der Song im Wesentlichen teilnahmslos, diskret und unpersönlich – atopisch. »I Zimbra« greift Fear of Music weit voraus, obwohl er die Tür zur Platte öffnet, ihre Ouvertüre darstellt. Indem er unseren Körpern einen verführerischen Ausnahmezustand einschreibt, es gleichzeitig aber ablehnt, unseren Köpfen einen fassbaren Gegenstand zu nennen, impft uns der Song mit einer »Totvakzine«-Version von Fear of Music, die gleichzeitig Kraft gibt und krank macht. Es ist kein Verlass auf »I Zimbra«. Das Lied erzwingt die Aufmerksamkeit des Hörers, ohne sich damit aufzuhalten, ihn auch zu überzeugen. Die einst menschliche Band hat sich selbst mit einer Maschine verwechselt, die außerhalb von Raum, Zeit und Geist eine Operation durchzuführen hat. Oder ist sie mutiert und hat uns zurückgelassen? Niemand sagt es uns. »I Zimbra« macht sich uns zu Willen, wie sexuelles Verlangen oder die Angst selbst, die an einem Ort jenseits der Sprache stattfinden.
Und doch, uns verhöhnend, ist da Sprache, wenn auch eine sehr spezielle.
Gadget berry bomber clamored
Lazuli loony caloric cad jam
Ah! Bum berry glassily gland ride
He glassily tufty zebra …
Oder Ähnliches könnte die sehnsüchtige auditive Rechtschreibprüfung irgendeines Trottels ergeben – zumindest bis er durch das Textblatt korrigiert wird. Für alle, die es nach Sinn verlangt oder Hinweisen darauf, was man wohl von der Reise, die man mit dem Absenken der Nadel am Plattenspieler angetreten hat, erwarten kann, gibt es einen linken Haken Marke Dada vor die Kinnlade.
• • •
Das Gedächtnis, dem das Artwork im Rückblick einleuchtet, ist ein Lügner. Oder eine Lüge. Indem er Fachkenntnisse und Arkana abspult, spinnt der Kritiker ein Netz der Allwissenheit, das den Herstellenden einhüllt, eine lichtscheue Spinne. Und nun kommen Sie pfeifend den Gang im Buchladen entlang – »Hab ich ja immer gemocht, die Platte, bin gespannt, was er dazu zu sagen hat« –, um selbst im Netz des Wissens verstrickt zu werden. Und bevor Sie sich’s versehen, hat die Spinne Sie zu ihrem Doppelgänger gemacht, einem weiteren Vorsteher dieses Gespinstes aus Meinungen und Trivialitäten, die Sie auch als die eigenen vor sich hertragen dürfen. Oder vielleicht nicht dürfen, sondern müssen. Dazu gezwungen sind. Ist es Ihnen wichtig, sich zu erinnern, wie es war, »I Zimbra« zu hören, bevor ich, wie eine Kugel Eis, die in Erdnussstückchen gerollt wird, es über und über mit meinen Worten bedeckt (und innerlich gefüllt) habe? Dann suchen Sie besser schnell das Weite, Freund.
Wann erfuhr ich, dass Hugo Ball (1886 – 1927), in Deutschland geborener Dada-Poet und Verfasser von Manifesten, die Quelle dieser wie Krypto-Stammesgesänge intonierter Nonsens-Silben war, die bei »I Zimbra« als Text dienen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Was ich aber weiß, ist, dass ich von Beginn an ein penibler Leser von Credits war, ein Verwalter von Datenpartikeln. Dort auf dem Textblatt zu Fear of Music fand sich »H. Ball« als Ko-Komponist (neben D. Byrne und B. Eno) und es dauerte wahrscheinlich nicht lange, bis ich ihn entdeckt hatte. Aber trotzdem bin ich mir sicher: Es gab ein Davor. Denn ich erinnere mich schemenhaft daran, wie dieses Wissen mit meinem frühsten Misstrauen gegenüber der Verweigerungshaltung des Songs hinsichtlich jeglicher Sinnhaftigkeit kollidierte. Ich wollte partout nicht, dass diese Band aufhörte, Sinn zu stiften.
Der Junge in seinem Zimmer verlangt, dass wir bei diesem Geständnis noch einen Schritt weitergehen, die Gelegenheit nutzen und sagen, dass er, als er zum ersten Mal das Textblatt zu More Songs About Buildings and Food unter die Lupe nahm und die Namen »A. Green und M. Hodges« als Urheber seines Lieblingspunkrockhits des Jahres 1978 entdeckte, das Pochen peinlicher Berührtheit unter einem rasch gebastelten Stanniolhütchen der Bescheidwisserei verbarg: Ach so, na sicher, »Take Me to the River« war ein alter R & B- oder Gospelsong, alles klar. Was für eine coole Geste seitens seiner Helden! Zu dieser Zeit nahm der Junge an, der Song stamme aus den Fünfzigern oder frühen Sechzigern und sei von den Talking Heads aufgepeppt worden. Der Junge erinnert sich mit absoluter Klarheit daran, wie er sich gefragt hatte, ob er wohl jemals mehr über »A. Green und M. Hodges« erfahren würde, als die Tatsache, dass sie diesen Song geschrieben hatten.
Dann aber, läppische sieben Jahre (und siebentausend Revolutionen in Sachen Gefühle und Geschmack) später, saß dieser Junge – nicht mehr wirklich ein Junge, aber noch genug, um ihn so nennen zu können – mit seiner College-Freundin auf einer Matratze und spielte ihr ausgewählte Aufnahmen aus seiner vollständigen Sammlung originaler Al-Green-Hi-Records-Platten vor. Um damit zu prahlen, wie viel er schon wusste, gab er zwischen den Aufnahmen exakt diese Geschichte seiner Unschuld weiter: Dass er einst auf ein Talking-Heads-Textblatt gestarrt und sich gefragt hatte, ob er je wissen würde, wer Al Green war. Zu dem Zeitpunkt empfand der Junge seine einstige Verbundenheit mit den Talking Heads als etwas Peinliches, hochgradig Unreifes, als Überrest peinlicher Anfänge. Inzwischen hatte er das Gefühl, seine Weltläufigkeit basiere auf seiner Verehrung des Werks von Al Green. Hätte man dem Zwanzigjährigen verkündet, er würde ein Vierteljahrhundert später ein Buch über die Talking Heads schreiben, statt eines über Al Green, er hätte wohl skeptisch die Augenbraue hochgezogen.
Was ich damit sagen will, ist, wie richtig und falsch man gleichzeitig liegen kann. Und dass die »Information« immer nur so viel wert ist wie das, was die Ohren bereits wissen. Oder sogar weniger. Wie viele andere auch, dachte ich, als ich es zum ersten Mal hörte – denn ich bin ja der Junge in diesem Zimmer –, »I Zimbra« klinge afrikanisch. Aber nicht, wie ich schnell hinterschieben will, im Sinne afrikanischer Musik, wie ich sie heute kenne und verehre, denn ich hatte keine Ahnung, wie afrikanische Musik klingt. Eher, beeinflusst von den Conga-Trommeln des Tracks, klang der Gesang für mich wie fingierter Stammes-Singsang in irgendeiner afrikanischen Sprache, Kisuaheli oder Zulu, oder, noch schlimmer, einer ausgedachten Uga-Uga-Sprache, einer intellektuellen Kunsthochschulversion des kannibalischen Gegrunzes und Gestöhnes in »Stranded in the Jungle« von The Cadets.
So sehr mich die Ähnlichkeit auch peinlich berührte und beunruhigte, so hätte ich diese Beunruhigung doch viele Jahre lang nicht in Worte fassen können. Es war zu persönlich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ein Missfallen gegenüber weißen Jungs, die so taten, als seien sie schwarz, mein Leben bestimmt, meine Konflikte auf dem Schulhof, musikalischer Art oder andere, und das war genau der Grund dafür, warum ich mich mit so jubilierender Begeisterung auf Punk- oder New-Wave-Bands ohne Blueshintergrund gestürzt hatte. Die Bestimmung der Talking Heads war es, der Inbegriff meiner Möglichkeiten zu sein, ein Coolsein zu konstruieren, das weg »von der Straße« und in Richtung literarischer Dinge führte, aber trotzdem cool war. Meinethalben mussten sie nicht Richtung Afrika schauen, mit oder ohne Anführungszeichen.
Später erfuhr ich, dass die Band Fear of Music als Versuch konzipiert hatte, die Distanz zwischen Punk und Disco zu verringern. Für mich allerdings war es zu dem Zeitpunkt das Beste, davon noch nichts gehört zu haben, und dass meine auditiven Abwehrmechanismen gut genug funktionierten und verhinderten, dass ich es hörte. Ich brauchte die Talking Heads als Punkband, nicht als Funkband. In »I Zimbra« allerdings musste ich, ohne es verhindern zu können – so wie jeder andere es tat oder spätestens in der Rückschau auf Remain in Light und Speaking in Tongues tun würde –, die homöopathische Tinktur, die minimale, effektiv transformative Dosis allen Funks hören, der da noch kommen sollte.
In dieser weißen Band würden einmal Schwarze mitspielen.
Taten es vielleicht schon.
Aber damit nehmen wir viel, viel zu viel vorweg, insbesondere was den Jungen in seinem Zimmer betrifft.
Brian Eno, bis zu diesem Zeitpunkt der einzige anerkannte Eindringling in das »offizielle Quartett«, war Engländer und kahl und spielte weder Schlagzeug noch Bass, sondern Keyboard oder saß streberhaft hinter einer Konsole. Erzählt mir nichts von trojanischen Pferden!
In dieses Durcheinander plumpste der Schlüssel: Hugo Ball. Zu sehen, dass dem toten Dada-Poeten ein Teil der Urheberschaft von »I Zimbra« zugesprochen wurde, half mir, meine Sorgen bezüglich des Drifts ins Afrikanische etwas zu zerstreuen, aber nur ein wenig. Meine Ohren meldeten mir noch immer etwas Beunruhigendes, analysierten noch immer ängstlich diesen Vorboten der Zukunft der Band (die natürlich aus einer Reihe von Kollaborationen mit lebenden schwarzen Musikern bestehen sollte, nicht toten Dada-Poeten).
Was aber bedeutete er? Neugierige...