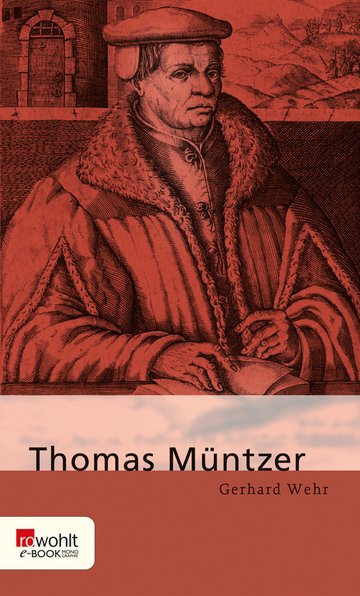Reformation von unten
Vieles haben die kleinen Leute, die Hungrigen, die Gebundenen, die Entrechteten, die «Bettler um Geist» den Satten, den Etablierten, den vermeintlich Freien voraus: den Durchblick durch die allzu engen Horizonte, das Verlangen, aufzubrechen, um selbst Unmögliches zu erreichen, eine Hoffnung, die mehr ist als ein abstraktes Prinzip, Hoffnung als eine Gewissheit und als Triebkraft auf dem Richtweg nach vorne.
Das bekamen die Sklavenhalter Altägyptens zu spüren, als die Söhne Jakob-Israels ihren Stammesgott als den Gott des Exodus, des Aufbruchs und des Voranschreitens begriffen und als sie sich auf den Weg machten. Im Namen dieses Gottes wurde der Kleinbauer und Schafzüchter Arnos von Tekoa zum Propheten wider die Unterdrücker und Ausbeuter, wider die Opferpriester und Verwalter eines veräußerlichten, geistig ausgehöhlten Kultus. Und der Rabbi Jesus von Nazareth, «der Zöllner und der Sünder Geselle» – all denen ein Dorn im Auge, die seit eh und je Heiliges wie ein Gewerbe treiben –, nährte die unauslöschliche Sehnsucht in den Herzen seiner Nachfolger, als er sie inbrünstig beten lehrte: Dein Reich komme! Das musste viele beunruhigen, ja den «ganzen Weltkreis erregen» (Apostelgeschichte 17, 6).
Thomas Müntzer ist einer von ihnen, ein tief Erregter, Erregender, Beunruhigender, einer, der für die Vergessenen, immer wieder Eingeschüchterten eingetreten ist; der sich nicht gescheut hat, im Blick auf den Anbruch des Reiches im Zeitalter der Reformation zum Anwalt der Revolution zu werden. Ernst Bloch hat recht: «Mit Zeus, Jupiter, Marduk, Ptah, gar Vitzliputzli hätte Thomas Münzer das nicht geschafft, was er mit dem Auszug aus Ägypten und dem gar nicht so sanften Jesus zu läuten anfing.»[1] Um Müntzer und um jene zu verstehen, für die er den Mund auftat und sein Leben riskierte, muss man das 15., 16. Jahrhundert als zwei Jahrhunderte großer religiöser und gesellschaftlicher Unruhe zu verstehen suchen.
Wann und wo fing das an? Es ist schwierig, einen Punkt zu bezeichnen, von dem aus die Entwicklung ihren Lauf genommen hat, die zu Thomas Müntzer und über ihn hinaus führte. Der Ruf nach einer umfassenden «Reformation an Haupt und Gliedern» ging im 15. und 16. Jahrhundert durch die gesamte Christenheit. Gewiss ist das religiöse Moment dieser Forderung nicht zu verkennen. Es war zunächst in erster Linie die Kirche, bei der die Reform anzusetzen hatte. Die Einheitskultur des Spätmittelalters ist aber schwerlich in eine geistliche und in eine weltliche Sphäre aufzuspalten. Richtig ist daher auch, dass das Verlangen nach einer grundlegenden Reformation Kirche und Welt, den religiösen und den gesellschaftlichen Bereich umfasste. Reformation wollen und Reformation auch tatsächlich betreiben war aber offenbar zweierlei, bedeutete doch gerade die reformatorische Tat massive Kritik an den alteingesetzten Institutionen, an der so gut wie unangreifbaren Kirche und den oft fragwürdigen Praktiken ihrer Führungsschicht. Nicht wenigen ist es übel bekommen, die folgerichtig die Konsequenzen aus dem allgemeinen Wunsch nach einer Veränderung aller Dinge gezogen haben. Die Ketzergeschichte, vornehmlich des ausgehenden Mittelalters, kann mit Belegmaterial aufwarten.
Am 4. Mai 1415 fällte das in Konstanz tagende «Reform»-Konzil der römischen Kirche sein Urteil über 45 Sätze des englischen Theologen John Wyclif, der ähnlich wie Petrus Waldus, der Kaufmann aus Lyon, und später der Italiener Girolamo Savonarola zu den Vorreformatoren gezählt wird. Wyclifs Theologie, die der Selbstentfremdung der katholischen Kirche zu Leibe ging, hatte in Böhmen ebenso entschiedene Parteigänger wie Gegner gefunden. Am 6. Juli 1415 stand der Tscheche Jan Hus, Theologieprofessor und Prediger in Prag, in Konstanz auf dem Scheiterhaufen, weil er sich nicht nur zu Wyclifs Thesen bekannt hatte, sondern einer Reform der Kirche den Weg bereiten wollte. «Das Konzil hatte über ihn triumphiert. Aber nur dem äußeren Schein nach war er unterlegen», schreibt Renate Riemeck in ihrer bemerkenswerten Hus-Biographie.[2] Ein Schrei der Entrüstung ging durch Böhmen. In der hussitischen Bewegung der Utraquisten und der radikalen Taboriten brach sich der reformerische und der revolutionäre Wille Bahn. Mit Feuer und Schwert verkündeten die Taboriten ihre Botschaft vom Anbruch des Jüngsten Gerichts, als dessen Vollstrecker sie sich fühlten. Während die Gemäßigten (Kalixtiner) für den Laienkelch bei der Austeilung des Abendmahls, für eine communio sub utraque specie, für eine Kommunion unter beiderlei Gestalt (Brot und Wein), eintraten, verfolgten die Radikalen nicht zuletzt sozialrevolutionäre Ziele.
Was von Böhmen aus in den übrigen mitteleuropäischen Umkreis hinein ausstrahlte, entsprach im 15. Jahrhundert der allgemeinen Erwartung großer Dinge. Die große Verderbnis in der Kirche, bei Klerikern und Mönchen, war ebenso wenig zu übersehen wie der Egoismus der Grundherren und Adeligen. Volksprediger wie Geiler von Kaysersberg und Satiriker von der Art eines Sebastian Brant («Das Narrenschiff») haben je auf ihre Weise die Zeitlage mit scharfem Wort und mit spitzer Feder kritisiert. «Der Himmel selbst ist käuflich geworden!», so lautete eine der bitteren Anklagen. Nikolaus von Kues, der spätere große Kardinal, schrieb noch als unbekannter Theologe und Teilnehmer beim Baseler Konzil sein Buch «De concordantia catholica», in dem er die «Verunstaltungen und Gefahren» in Kirche und Reich als eine «tödliche Krankheit» charakterisierte. Aber die Konzile von Pisa und Konstanz (1409–18) bzw. von Basel und Ferrara-Florenz (1431–49) gaben keine Antwort auf die brennenden Fragen der Zeit. Die zur politischen Führung Berufenen wussten keinen Ausweg, um die Bedrängnis der Geringen, das heißt der kleinen Bauern und der unbemittelten Handwerker und Kleinbürger, zu beseitigen. Vor allem fehlte es an dem nötigen Mut zu einer Veränderung der Gesellschaft, die dem im aufblühenden Humanismus sich herausgestaltenden Bild vom autonomen Menschen entsprochen hätte.
Wie groß die Hoffnung auf die Neuwerdung aller Dinge war, drückt auch die politisch-kirchenpolitische Programmschrift eines Ungenannten aus, die unter der Bezeichnung «Reformatio Sigismundi» um das Jahr 1439 in Umlauf kam und bis ins 16. Jahrhundert hinein mehrere Auflagen erlebte. «Die hohen Häupter sind nicht zu mahnen, wann sie das Unrecht innehaben mit Gewalt», heißt es da. «Aller Gebrechen Grund aber liegt in zwei Stücken: an der Simonie, das ist der Hang zum Wucher bei der Geistlichkeit und bei den Weltlichen am Hang zum Geiz.» Damit ist das Grundübel auf eine kapitalistische Gesinnung zurückgeführt. Die Reformatio, die als ein Traum des Kaisers Sigismund vorgestellt wird, zielt auf Umgestaltung der sozialen und politischen Ordnung hin, eine Umgestaltung, die beim «Haus des Herrn», bei der Kirche also, beginnen müsse. Das Papsttum, die Bischöfe, Kirchengemeinden, Klöster und geistlichen Orden sind in die reformatorischen Maßnahmen einzubeziehen. «Soll man aber kommen zu göttlicher Ordnung, so muß es geschehen durch Gottes und durch das weltliche Schwert. Man soll es brauchen in rechten Nöten um Gottes und des Glaubens willen und um Gerechtigkeit.» Voraussetzung für die Neuwerdung ist das richtige Verständnis der sieben Sakramente. Es unterliegt keinem Zweifel, dass einige Gesichtspunkte der Reformation Luthers durch die «Reformatio Sigismundi» bereits vorweggenommen erscheinen, zumal das Prinzip eines allgemeinen Priestertums aller Gläubigen zur Sprache kommt.
Hauptziel des ungenannten Verfassers wie das anderer Kritiker seiner Zeit ist die Herstellung einer gerechten und vollkommenen Weltordnung, in der das alte, das überkommene Recht zurückgewonnen werden soll, die iustitia dei (Gerechtigkeit Gottes) im Gegensatz zu dem späteren, vor allem von den Bauern nicht verstandenen Römischen Recht, dessen sich die Unterdrücker bedienten. Eine Unterscheidung von «göttlichem» und «natürlichem» Recht, wie sie etwa in Luthers Zwei-Reiche-Lehre begegnet, kennt die «Reformatio Sigismundi» nicht. Alles Recht, alle Rechtsprechung habe letztlich von dem Kaiser auszugehen. Und da sich die Schrift gleichzeitig mit der ländlichen Bevölkerung beschäftigt, gilt es, die Interessen des kleinen Mannes, des Bauern, des Handwerkers und Tagelöhners zu schützen. An der Änderung der Dinge wird ein geweissagter, hier und andernorts oftmals anvisierter «Kaiser Friedrich» beteiligt sein. Bald ist der erhoffte Reformator ein «oberster Pfarrer», der über die Autorität verfügt, um selbst den Papst einzusetzen und abzuberufen, ein «starker Mann» also, vor dem die Machthaber und Gewaltigen dieser Zeit nicht bestehen können. Was Kaiser Sigismund über die nach ihm benannte Reformatio träumt, erschaut drei Jahrzehnte danach einer aus dem Volk, Hans Böhm, Hirt im fränkischen Taubergrund, genannt der Pfeifer (oder Pauker) von Niklashausen.
«Zum ersten untersteht er sich, ohne Unterlaß vor dem Volk zu predigen und zu sagen, so wie im folgenden geschrieben steht: Wie ihm die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, erschienen sein soll und ihm offenbart habe den Zorn Gottes wider das Menschengeschlecht und insbesondere wider die Priesterschaft. Daß Gott daher habe strafen wollen und Wein und Korn auf den Kreuztag hätten sollen erfroren sein, das aber habe er abgewandt durch sein Gebet. Wie im Taubertal ebenso große, vollkommene Gnade sein soll und noch mehr als zu Rom oder sonstwo. Welcher Mensch ins Taubertal kommt, der erlange alle vollkommene Gnade, und wenn er sterbe, so fahre er vom Mund (aus dem die Seele entfleucht) auf zum Himmel.» Aber nicht nur dies berichtet einer der Informanten,...