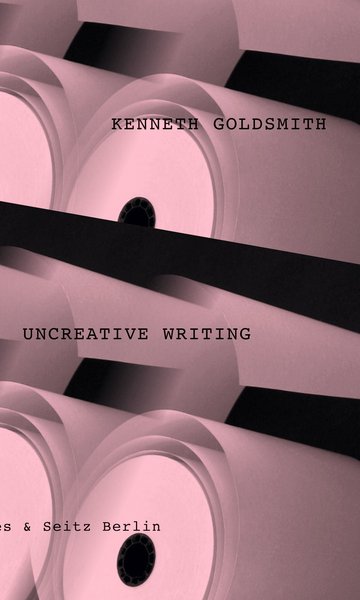1
Die Rache des Textes
Im Musée d’Orsay gibt es einen Saal, den ich den »Raum der Möglichkeiten« nenne. Das Museum ist einigermaßen chronologisch strukturiert und schlängelt sich fröhlich durchs neunzehnte Jahrhundert, bis man auf einmal in einen Saal gelangt, in dem eine Reihe malerischer Reaktionen zur Erfindung der Kamera zu sehen sind – etwa eine Handvoll von Vorschlägen, wie sich die Malerei dazu verhalten könnte. Einer unter ihnen, der mir im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Trompe-l’Œil-Lösung, in der eine Figur buchstäblich ihre Hände aus dem Rahmen hinaus in den Raum des Betrachters streckt. Ein anderer integriert dreidimensionale Gegenstände in die Leinwand. Alles großartige Anläufe, aber wie wir alle wissen, trug der Impressionismus – und damit die Moderne – den Sieg davon. Heute steht das Schreiben an einem ebensolchen Scheideweg.
Mit dem Aufstieg des Internets hat das Schreiben seine Fotografie gefunden. Damit meine ich, dass es sich in einer ähnlichen Situation befindet wie die Malerei zum Zeitpunkt der Erfindung der Fotografie – einer Technologie, die so sehr viel besser darin ist, die Wirklichkeit zu kopieren, dass die Malerei, um zu überleben, ihren Ansatz radikal verändern musste. Weil es der Fotografie um Tiefenschärfe ging, war die Malerei gezwungen, weicher zu werden, wie es schließlich im Impressionismus geschah. Zwischen den Künsten gab es eine vollkommen analoge Korrespondenz, weil unter der Oberfläche der Malerei, der Fotografie oder des Films nirgends auch nur ein Hauch von Sprache weht. Stattdessen war es ein direktes Abbildungsverhältnis, das die Bühne für eine piktoriale Revolution bereitete.
Heute befinden wir uns mitten in einer Revolution der Literatur, die von digitalen Medien ausgeht. 1974 konnte Peter Bürger noch behaupten: »Mit dem Aufkommen der Fotografie und der damit gegebenen Möglichkeit der exakten Wiedergabe von Wirklichkeit auf mechanischem Wege verkümmert die Abbildfunktion in der bildenden Kunst. Die Grenzen dieses Erklärungsmodells werden jedoch deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es sich nicht auf die Literatur übertragen läßt; denn es gibt im Bereich der Literatur keine technische Neuerung, die eine vergleichbare Wirkung hervorgebracht hätte wie die Fotografie in der bildenden Kunst.«1 Genau dieser Fall ist nun aber eingetreten.
Wenn die Malerei auf die Fotografie mit der Flucht in die Abstraktion reagierte, ist es unwahrscheinlich, dass das Schreiben in Bezug auf das Internet das Gleiche tun wird. Vielmehr scheint es, als müsse die Reaktion des Schreibens – das sich eher an der Fotografie als an der Malerei orientiert – mimetisch oder replikativ sein, Verbreitungsmethoden betreffen, während es gleichzeitig neue Empfangs- und Leseplattformen vorschlägt. Es ist gut möglich, dass Wörter nicht ausschließlich geschrieben werden, damit man sie liest, sondern damit man sie teilt, bewegt und manipuliert – manchmal von Menschen, meistens aber von Maschinen, was die außergewöhnliche Chance bietet, die Frage zu überdenken, was Schreiben ist und wie man die Rolle des Autors definieren kann. Während traditionelle Vorstellungen des Schreibens primär auf »Originalität« und »Kreativität« bezogen sind, fördert die digitale Umgebung neue Fähigkeiten, die »Manipulation« und »Management« der Unmengen an bereits bestehendem Text und sich stetig vermehrenden Sprache betreffen. Während Schriftsteller heute herausgefordert sind, sich Wortwucherungen »entgegenzustellen« und um Aufmerksamkeit zu buhlen, können sie sich diese Wucherungen auf unerwartete Weise zunutze machen, um Werke zu schaffen, die ebenso viel Ausdruck und Sinn besitzen wie solche, die auf eine traditionellere Weise entstanden sind.
Ich sitze im Flugzeug auf dem Weg zurück von Europa nach New York und starre träge auf die Karte, die unseren Reisefortschritt auf einem in die Sitzlehne vor mir eingelassenen Bildschirm zeichnet. Die glatte topografische Weltkarte ist zweidimensional und zeigt die ganze Erde, eine Hälfte im Dunkel, die andere hell, mit uns als einem kleinen weißen Flugzeug, das gen Westen zieht. Der Monitor schaltet regelmäßig von den grafischen Karten auf eine Liste blauen Textes um, die unsere Entfernung vom Ziel, die Zeit, die Fluggeschwindigkeit, die Außentemperatur und so weiter anzeigt, alles in einer eleganten serifenlosen Schriftart. Es ist entspannend und stimmungsvoll, dem Flugzeug zuzusehen, wie es sich seinen Weg bahnt, während ozeanische Platten und exotische Namen kleiner Städte an der nordatlantischen Küste vorbeiziehen – Carbonear, Gander, Glace Bay.
Als wir uns der Neufundlandbank nähern, flimmert mit einem Mal mein Bildschirm und wird schwarz. Für eine Weile ändert sich nichts, bis er wieder anspringt, diesmal in einer unscheinbaren weißen Systemschrift auf schwarzem Grund: Der Computer startet neu und statt all der hübschen Grafiken sieht man DOS-Zeilen, die anzeigen, dass der Computer hochfährt. Für ganze fünf Minuten sehe ich dabei zu, wie sich in der Befehlszeile Systembeschreibungen entspinnen, Schriften geladen und Grafikpakete entpackt werden. Schließlich wird der Bildschirm wieder blau und ein Fortschrittsbalken erscheint zusammen mit einer Sanduhr, während die Grafikschnittstelle lädt und gerade, als wir Land sichten, die Karte wiederkehrt.
Was wir für Grafik, Ton und Bewegung auf den Bildschirmen unserer Welt halten, ist in Wirklichkeit nur ein dünner Firnis, unter dem meilenweit nichts als Sprache herrscht. Gelegentlich, so wie auf meinem Flug, reißt dieser Firnis auf und, als würde einem der Blick unter die Motorhaube gestattet, sehen wir, dass unsere digitale Welt – unsere Bilder, unsere Filme und Videos, unsere Töne und Wörter, überhaupt unsere Information – sprachlich verfasst ist. Und all diese binären Informationen – Musik, Videos, Fotos – sind aus Sprache gemacht, einer riesenhaften Menge alphanumerischen Codes. Man sieht das, wenn man etwa eine E-Mail mit einem JPG-Anhang erhält, der versehentlich nicht als Bild, sondern als Code dargestellt wird, der nicht aufzuhören scheint. Er besteht aus nichts als Wörtern (wenn auch nicht auf eine Weise, die wir verstehen könnten): Das Rohmaterial, das das Schreiben angetrieben hat, seit es feste Form gewann, ist nun dasselbe, aus dem alle Medienarten geschaffen werden.
Abb. 1.1. DOS-Bildschirm im Flugzeug
Abgesehen von seiner Funktionalität besitzt ein Code auch einen literarischen Wert. Wenn wir den Code »rahmen« und ihn mit den Mitteln der Literaturwissenschaft lesen, werden wir sehen, dass die letzten hundert Jahre modernen und postmodernen Schreibens den künstlerischen Wert scheinbar willkürlicher Buchstabenarrangements gezeigt haben.
Hier sind drei Zeilen einer JPG-Datei, die in einem Texteditor geöffnet wurde:
^?Îj€≈ÔI∂fl¥d4˙‡À,†ΩÑÎóajËqsõëY”Δ″/å)1Í.§ÏÄ@˙’∫JCG Onaå$ë¶æQÍ″5ô’5å
p#n>=ÃWmÃflÓàüú*Êœi”›_$îÛμ}Tß‹æ´’[“Ò*ä≠ˇ
Í=äÖΩ;Í”≠Õ¢ø¥}è&£S˙˙Æπ›ëÉk©1=/Á″/”˙ûöÈ>∞ad_ïÉúö˙€Ì—éÆΔ’aø6aÿ-
Natürlich wird ein Close Reading dieses Textes nur sehr wenig zutage fördern, weder auf semantischer noch auf narrativer Ebene. Stattdessen enthüllt ein konventioneller Blick auf dieses Stück eine Nonsensansammlung von Buchstaben und Symbolen – eben einen Code, der entziffert und dann erst verständlich werden könnte.
Aber was passiert, wenn der Sinn nicht als das Wichtigste im Vordergrund steht? Wenn wir dem Text andere Fragen stellen müssen? Es folgen drei Zeilen aus dem Gedicht Lift Off von Charles Bernstein aus dem Jahr 1979:
HH/ ie,s obVrsxr;atjrn dugh seineocpcy i iibalfmgmMw er,, me“ius ieigorcy¢jeuvine+pee.)a/nat” ihl“n,s ortnsihcldseløøpitemoBruce-oOiwvewaa39osoanfJ++,r«P2
Ganz bewusst alle literarischen Tropen und die Vermittlung menschlicher Gefühle auslassend entscheidet sich Bernstein hier dafür, die Vorgänge einer Maschine und nicht Empfindungen zu betonen. Tatsächlich besteht dieser Text genau darin, was sein Titel besagt: Er ist eine Transkription all dessen, was das Korrekturband einer manuellen Schreibmaschine »abgehoben« hat. Bernsteins Gedicht ist in gewisser Weise ein Code, der sich als Gedicht ausgibt: Eine gewissenhafte Lektüre würde Wortbruchstücke sichtbar werden lassen und hin und...