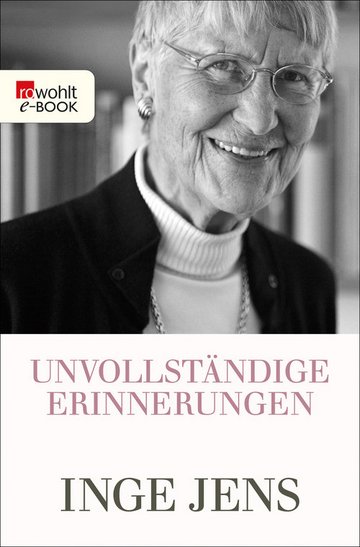Kapitel 1
Kindheit und Jugend
Ich wurde 1927 als ältestes von vier Geschwistern in Hamburg geboren. Mein Elternhaus war vonseiten der Mutter her eher großbürgerlich bestimmt – es wird erzählt, dass meine Großmutter «Dienstboten», wie man damals sagte, entließ, weil sie den Namen Bismarck nicht mit «ck» schrieben. Väterlicherseits dominierte die Tradition hamburgischer Überseekaufleute: Zum Geburtstag des Großvaters erschienen die Enkel in original chinesischen Gewändern, um zu gratulieren. Das und der Geburtsort meines Vaters – «geboren in Singapore» buchstabierte bei meiner Heirat der Tübinger Standesbeamte – vermittelte den Kindern gelegentlich die Ahnung von der Existenz anderer Welten.
Im Allgemeinen aber ging es handfest-prosaisch zu; mein Vater, von Beruf Chemiker, sorgte dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wuchsen, indem er, wenn er uns – zumal am helllichten Tag – mit einem Buch in der Hand sitzen sah, daran erinnerte, dass es in Haus und Garten noch viele nützliche Dinge zu erledigen gäbe.
Meine Kindheit und Jugend fallen zum überwiegenden Teil in die Zeit des Nationalsozialismus, meine Schulzeit ist vom Anfang bis zum Ende identisch mit ihr. Sie begann 1933 und hätte planmäßig 1945 mit dem Abitur enden sollen. Der Krieg sorgte dafür, dass sie es nicht tat, ich, im Gegenteil, nach vielen Unterbrechungen im Winter 1946 noch einmal zu lernen begann, um, wie immer es gehen mochte, jedenfalls formaliter die Studienzulassung zu erlangen.
Dennoch: Wenn ich zurückdenke, überwiegen die freundlichen Erinnerungen. Zumindest die ersten zwölf, vierzehn Jahre meines Lebens waren unbeschwert und glücklich, geborgen im Kreis einer großen Familie. Meine Schwester Renate war eineinhalb, mein Bruder Carsten fünf Jahre jünger als ich. Die Kleinste, Gesa, 1936 geboren, galt als «Nachkömmling», der sich im Laufe der Jahre allerdings eine zentrale Stellung in der Familie zu erobern wusste. Aber so unterschiedlich wir vier Geschwister auch waren und so verschieden unsere Erinnerungen ans Elternhaus auch sein mögen: Im Urteil über unsere Kindheit sind wir uns einig.
Warum es so ist? Ich denke, wir kamen uns gegenseitig nicht ins Gehege. Es gab genug Platz für alle, und das «Vertragt euch!» meiner Mutter habe ich als absolut zu respektierendes Gebot noch heute im Ohr. Ihr pädagogisches Talent war beachtlich, ihr unreflektiertes «Augenmaß» bemerkenswert. Ich kann mich nicht erinnern, je «nachhaltig» ungerecht behandelt worden zu sein. Natürlich gab es Fehlurteile, aber sie wurden korrigiert oder, wenn erforderlich, durch Erklärungen begründet und damit aufgehoben.
Als ich etwas älter war, faszinierte mich der Bildungsgang meiner Mutter: Sie hatte auf Betreiben meines Großvaters, eines Frauenarztes in Köln, das Humanistische Gymnasium besucht – besuchen müssen, denn der Vater bestand auf einer gleichwertigen und das hieß zunächst offenbar auch «gleichartigen» Ausbildung für seine vier Kinder. Die zwei Mädchen sollten dereinst keine geringeren Chancen als die zwei Buben haben: kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs eine immerhin bemerkenswerte Einstellung, die meine Großmutter teilte. Auch sie war eine hochgebildete, sprachgewandte und belesene Frau. Ich habe sie noch gut gekannt und gern zugehört, wenn sie von ihrer Jugend erzählte, in der sie in einem kleinen Kreis ähnlich Privilegierter von den Dozenten der Bonner Universität unterrichtet und sogar einmal nach Berlin geführt wurde, um den gerade aufgestellten Pergamon-Altar zu sehen. Etwas später ging sie dann in die Schweiz, um sich mit Hilfe exklusiver Internate in die französische und italienische Sprach- und Kulturwelt einführen zu lassen. Englisch zu sprechen hatte sie bereits bei ihrem eigens aus Großbritannien ins Bonner Haus geholten Kindermädchen gelernt.
Meiner Mutter imponierte diese Welt nur bedingt. Sie hatte nach dem Abitur auf Wunsch ihres Vaters zwei oder drei Semester Volkswirtschaft studiert, ehe sie endlich ihren Traum verwirklichen und eine der Reiffensteiner Frauenfachschulen besuchen durfte. Hätte sie nicht mit zweiundzwanzig Jahren den Mann geheiratet, den sie bereits seit zwei Jahren von einem Stiftungsfest der Tübinger Studentenverbindung meines Großvaters her kannte, wäre sie Lehrerin an einer solchen (oder einer ähnlich ausgerichteten) Schule geworden.
Für mich indessen stand bald fest, dass ich die Begeisterung für ein solches Lebensziel niemals teilen würde. Auch wenn meine Interessen einstweilen noch wenig zielgerichtet waren und ich mich ziemlich lange eher tastend als entschlossen bewegte, wusste ich: das mit Sicherheit nicht.
Aber was dann? Ich las gern – vermutlich unter Vernachlässigung aller «Pflichten», denn ich erinnere, dass sich meine Eltern gelegentlich bemühten, mich ein bisschen von meinen Büchern wegzubringen und «lebenstauglich» zu machen, was für meine Mutter – im Gegensatz zu meinem pragmatisch-naturwissenschaftlich orientierten Vater – allerdings, wenn auch in Maßen, Zeit fürs Lesen einschloss.
So bekam ich ganz selbstverständlich zu Weihnachten und zum Geburtstag «meine», das heißt die von mir gewünschten Bücher – aber eben auch fast immer nur die. «Weiterführendes» erinnere ich nicht. Dafür gab es den elterlichen Bücherschrank, der aber außer mit Volksausgaben der gängigen Klassiker und einigen nordischen Buchgemeinschaftsromanen nicht eben üppig ausgestattet war. Doch für den Anfang genügte er vollauf, zumal ich in der Auswahl meiner Bücher keinerlei Restriktionen unterworfen war. Irgendwann entdeckte ich die sophokleischen Dramen. Und ich sehe mich auch noch mit angehaltenem Atem die «Orestie» lesen. Mehr «aus Versehen» denn vorsätzlich. Ich wusste nicht, was mir da in die Hand gefallen war. Ich weiß nur noch, dass mein Tagesplan in Unordnung geriet, weil ich erst viel zu spät merkte, dass ich ja eigentlich hätte Schularbeiten machen sollen, vielleicht sogar wollen. Wenn es nicht gerade ums Vokabellernen ging, hatte ich im Allgemeinen nichts gegen Schularbeiten.
Ich saß – auch das weiß ich noch –, den Kopf zwischen meinen auf die herausklappbare Platte gestützten Armen, an meinem eigenen verschließbaren Schreibtisch, den ich 1937 zu Weihnachten bekommen hatte. Es war wie ein Ritterschlag gewesen. Er besaß oben zwei Bücherborde hinter Schiebescheiben, dann den verschließbaren Schreibbereich und unten zwei oder drei Borde für Schulsachen, Atlanten, vielleicht auch weitere Bücher. Ich habe diesen Schreibtisch später in unsere erste gemeinsame «Wohnung» in Tübingen auf dem Schlossberg mitgenommen und unter anderem meine Doktorarbeit an ihm geschrieben. Er hatte eine Innenbeleuchtung und konnte so in der etwas dunkleren Ecke des Zimmers stehen. Wenn ich mich recht erinnere, hat er sogar den Umzug in unsere erste richtige Wohnung mitgemacht.
Den Schreibtisch bekam ich, weil «die Großen» – also Renate und ich – im neuen Haus in der Wandsbeker Marienstraße, das meine Eltern kurz zuvor gekauft hatten, jede ein eigenes Zimmer bekamen. In der alten Wohnung – gleichfalls in Wandsbek –, in der wir zur Miete gewohnt hatten, teilten wir ein mittelgroßes Schlafzimmer unterm Dach. Das Leben am Tage spielte sich einen Stock tiefer im Kinderzimmer ab, wo wir auch unsere Schularbeiten erledigten, Ostereier färbten oder mit viel Hingabe die obligatorischen Weihnachtsgeschenke bastelten. Das Wohnzimmer war tabu. Dort empfing meine Mutter «Besuch» (was auch für die Kinder meistens aufregend, da etwas nicht Alltägliches war). Dort stand aber auch der Weihnachtsbaum. Diese Lebensraum-Einteilung blieb im eigenen Haus erhalten. Aber dort gab es zwei Etagen und ein Dachzimmer, das Renate bewohnte. Ich lebte einen Stock tiefer, direkt unter ihr, im einzigen Zimmer, das einen kleinen Balkon hatte. Ich war sehr stolz. Die beiden «Kleinen», Carsten und Gesa, wohnten und schliefen in dem sehr großen, hellen Zimmer neben mir, das tagsüber für uns alle – bei Bedarf also auch für Renate und mich – als Kinderzimmer diente.
Beide Wandsbeker Wohnungen, die Villenetage in der Claudiusstraße und das eigene Haus zwischen Marienanlage und dem Bahnhof an der Strecke nach Lübeck, verfügten über einen großen Garten, dem sich mein Vater mit Leidenschaft widmete. Die Weitläufigkeit der Areale hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass immer für alle Platz war und die Interessen niemals kollidieren mussten. Zudem boten die zentralen Rasenflächen eine wunderbare Plattform für Kreis- und Schulspiele oder gar schauspielerische Darbietungen, von der Möglichkeit, von hier aus auch «Kriegen» (schwäbisch: «Fangeles») oder «Versteck» zu spielen, mal ganz zu schweigen. In beiden Gärten gab es viele Bäume, aber auch Nischen, in die man sich allein oder zu mehreren – Nachbarskinder oder Schulfreunde waren stets willkommen – zurückziehen konnte.
Von heute aus gesehen habe ich den Eindruck, dass die Verschiedenartigkeit von uns vieren für meine Eltern kein Problem gewesen ist. Es fiel ihnen offensichtlich nicht besonders schwer, jedem von uns seine eigene «Rolle» zuzugestehen und die Unterschiedlichkeit der Begabungen als etwas Natürliches und Nützliches zu akzentuieren: Inge ist so, Renate so, Carsten nochmal anders, und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Es gab allerdings auch klar formulierte moralische Gebote und Standards, die wir – als Voraussetzungen für diese Großzügigkeiten und Freiheiten – lernen mussten zu respektieren. Aber dann konnte jedes Kind innerhalb der Familienhierarchie seine eigene, von den anderen ganz selbstverständlich akzeptierte und in das Ganze integrierte «Rolle» leben.
Ich war für...