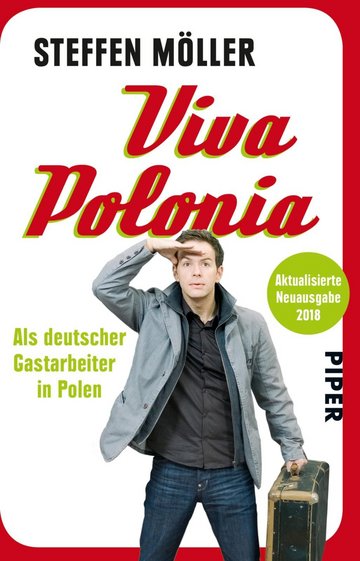Meine Hobbys
Als Kind habe ich eine Zeit lang Briefmarken gesammelt. Obwohl ich die Sache eher halbherzig betrieb, verdanke ich dem damaligen Hobby doch meine erste Begegnung mit Polen. An den wenigen polnischen Marken, die ich ergattern konnte, faszinierte mich nämlich der Aufdruck »Poczta Polska«, zu deutsch: Polnische Post. Der Stabreim ging mir so ein, dass ich stundenlang (und mit falscher Aussprache) vor mich hin sagen konnte: »Potsta polska, potsta polska …«.
Kurze Zeit später stellte ich schon die erste allgemeingültige Behauptung über »die« Polen auf. Es war Anfang der Achtzigerjahre, und ich sah im Fernsehen, wie Wojtek Fibak Tennis spielte und Lech Wałęsa Werften besetzte.
»Alle Polen tragen Schnurrbärte«.
Schon bald musste ich den Satz differenzieren. Der böse General Jaruzelski, der 1981 das Kriegsrecht ausrief, trug nämlich leider keinen Schnurrbart.
Ich reformulierte meine These so: »Alle guten Polen tragen einen Schnurrbart.« Doch auch diese neue Aussage schrie förmlich nach einer weiteren Verfeinerung, da ja auch Papst Johannes Paul II., der so gut Deutsch sprach, keinen Schnurrbart trug.
Ich grübelte lange und fand schließlich eine Lösung:
»Päpste zählen nicht.«
Im vorliegenden Buch mache ich eigentlich genau das Gleiche. Ich stelle Behauptungen über Polen und die Polen auf, deren Grundlage sehr subjektive Beobachtungen sind, aus denen ich höchst allgemeingültig klingende Schlüsse ziehe.
Darf man das?
Keine Ahnung, aber es ist mein aktuelles Hobby. Als Rechtfertigung darf ich höchstens anführen, dass ich ein großer Fan des Landes bin, mehrere Sprachkurse besucht habe und sogar den schwierigsten polnischen Zungenbrecher fehlerfrei herunterbeten kann.
Ach so, und dann lebe ich natürlich seit mehr als zwanzig Jahren in Polen. Zuerst war ich Deutschlehrer an einem Warschauer Gymnasium, danach Sprachlektor an der Warschauer Uni und Schauspieler in einer Telenovela. Heute bin ich Kabarettist und toure kreuz und quer durch das ganze Land. Ich habe die Polen im Zug und im Auto, im Aufzug und auf der Rolltreppe, bei Hochzeiten oder im Urlaub beobachtet, von Rzeszów bis Szczecin, von Augustów bis Bielsko-Biała; ich habe polnische Trinklieder, Flüche, Kultfilmdialoge und Kinderabzählreime auswendig gelernt.
Und wie es Hobby-Ethnologen häufig zu gehen pflegt, bin ich nicht bloß Beobachter geblieben, sondern habe mich meinem Forschungsgegenstand teilweise angeglichen. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mich selbst schon wie ein Pole verhalte. Ich bin furchtbar abergläubisch geworden, kann dafür aber phantastisch tanzen. Ich interessiere mich brennend für die Geschichte des Mittelalters, besonders für die Schlacht bei Tannenberg 1410, und habe für die Verlierer von damals, die steifen Deutschen, nur noch ein verächtliches Grinsen übrig. Die haben keine Ahnung von Improvisation und müssen sogar einen harmlosen Grillabend schon Wochen im Voraus planen!
Zugegeben: Meine Polonisierung hakt noch da und dort. Irgendwie kann ich mich nicht zum charmanten Handkuss durchringen, und noch nie im Leben habe ich den Nationalsport der Polen betrieben, das Pilzesammeln. Auch fällt es mir schwer, dem polnischen Kultfilm Rejs etwas Komisches abzugewinnen. Und stets und überall fehlt mir unser deutsches Graubrot. Aber das Schöne an Polen ist ja, dass es auch noch für die nächsten tausend Jahre Deutschlands Nachbar sein wird. Da bleibt noch genug Zeit zur weiteren Angleichung.
Nach etwa acht Jahren hatte ich eine kleine Krise. Polen erschien mir bereits viel zu verwestlicht. Ich reiste weiter nach Osten, nach Moskau, Omsk, Nowosibirsk und ins Altaigebirge. Schon nach wenigen Wochen war ich wieder in Warschau. Russland, so erwies sich, war doch etwas ganz anderes, nämlich purer Osten, so wie Paris der pure Westen ist. Und ich wusste nun, was ich an Polen so schätze, nämlich die Tatsache, dass es im Spannungsfeld zwischen Osten und Westen liegt. In solchen Spannungsfeldern, so hörte ich in irgendeiner Flughafen-Lounge raunen, trifft man nicht nur die schönsten Frauen, nein, es kommt auch zu einzigartigen Mentalitätsmischungen. Die Polen mit ihrem absurden Humor und ihrer natürlichen Warmherzigkeit sind ein gutes Beispiel dafür.
Und damit das Wort »Spannungsfeld« nicht so abstrakt bleibt, empfehle ich jedem, am Berliner Hauptbahnhof in den nächsten Eurocity nach Warschau zu steigen. Jeden Tag fahren von dort aus vier Züge gen Osten, die Fahrt dauert sechs Stunden. Vom Speisewagen aus lassen sich die polnischen Spannungsfelder im Breitwandformat bewundern. Vielleicht sitze ich ja auch gerade da und murmle vor mich hin: »Poczta Polska, poczta polska, poczta polska« (heute immerhin schon mit korrekter Aussprache: Potschta polska, potschta polska …). Wer mir dann dieses Buch vor die Nase hält, bekommt von mir einen Krupnik spendiert, einen süßen Kräuterschnaps. Versprochen und na zdrowie!
Wer hätte gedacht, dass der kleine Briefmarkensammler eines Tages direkt neben einem Briefkasten der Poczta Polska telefonieren wird?
Italien
Nie hätte ich gedacht, dass es mich eines Tages nach Polen verschlagen würde. Was weiß ein Wuppertaler schon von Polen? Kaffeefahrten nach Holland – kein Problem. Aber Polen? Das liegt ja noch hinter Berlin!
Es wurde denn auch ein sehr verschlungener Weg zu meinem ersten Kontakt mit leibhaftigen Polen. Er fand – in Italien statt.
Nach dem Zivildienst zog ich nach Berlin um. Das war nicht besonders originell. Man schrieb das Jahr 1990, alle Zwanzigjährigen strömten in die Noch-nicht-Hauptstadt. Ich begann, an der Freien Universität Philosophie und Theologie zu studieren. Sehr bald meldete ich mich für einen Italienischkurs an. Berlin erreicht zu haben schien mir für einen Wuppertaler schon eine akzeptable Leistung – aber nun musste es doch irgendwie weitergehen, in noch exotischere Gefilde. Das konnte nur Italien sein, das schönste Land der Welt.
Ein Jahr lang lernte ich also eifrig Italienisch. Meine Lehrerin, die kleine Elisabetta aus Genua, die einen melancholischen Berliner Philosophen geheiratet hatte, war hocherfreut über meinen Enthusiasmus.
»Stefano, du bist so offen. Man merkt gleich, dass du aus der Provinz kommst. So einer wie du gehört nach Italien. Da wirst du dich wohlfühlen!«
Ich glaubte ihr und fuhr nach Florenz. Dort stellte ich aber zu meinem Kummer fest, dass die Italiener zwar tatsächlich sehr offen und nett sind – für meinereiner allerdings ein bisschen zu sehr. Deutlich bekam ich das bei einem Konzert im berühmten Florentiner Duomo zu spüren. Ein ergreifendes Requiem wurde gespielt, ich lauschte versunken der Musik. Neben mir saß ein wohlerzogener junger Philosophiestudent, mit dem ich vor dem Konzert ein paar Worte gewechselt hatte. Als der letzte Ton sanft verklungen war und ich melancholisch dem Ende alles menschlichen Daseins nachsann, erhob sich um mich herum ein Orkan. Die Leute schrien wie in der Fankurve eines Fußballstadions »Bravi, bravi! Da capo!«. Alle im Gotteshaus versammelten Italiener gerieten außer Rand und Band. Aber das Schlimmste war: Sogar meinen Kollegen von der philosophischen Fakultät riss es vom Holzstuhl hoch.
»Da capo!«, heulte er frenetisch, als hätte Epikur nicht die Ataraxia, den Gleichmut, als höchstes Ideal gepriesen. In diesem Moment wurde mir klar, dass ein extrovertierter Deutscher aus der Provinz nicht einmal an das Temperament eines italienischen Philosophiestudenten heranreicht. Nein, ich hatte keine Zukunft in diesem Land. Schon am nächsten Tag wollte ich durch die Alpen zurück nach Deutschland trampen.
Zunächst aber musste ich zum Campingplatz am Stadtrand von Florenz zurück. Um in dieser dunklen Stunde meines Lebens irgendwie Gesellschaft zu haben – ich hatte immerhin ein ganzes Jahr mit der falschen Sprache verplempert –, setzte ich mich zu einer Deutschen und ihrem amerikanischen Freund ans Lagerfeuer. Das Mädchen hieß Sabine und kam aus Hamburg. Während ihr Lover mich mit Hemingway und »Wem die Stunde schlägt« nervte, beobachtete sie mich angestrengt.
»Ist was?«, fragte ich sie nach einer Weile.
»Du erinnerst mich ganz stark an jemanden, den ich kenne.«
Plötzlich, als wir gerade Cornedbeef aus der Dose pulten, tippte Sabine sich an die Stirn. »Ich weiß! Du erinnerst mich an den Ex-Freund meiner Schwester. Boah, war das ein Arsch!«
Ich ließ die Dose sinken, wünschte den beiden noch einen schönen Abend und beschloss, mich in mein Zelt zurückzuziehen. Auf dem Weg dorthin kam ich an einer Gruppe junger Leute vorbei, die ebenfalls an einem prasselnden Lagerfeuer saßen. Einige grillten Würstchen, andere sangen, jemand spielte dazu Gitarre. Die Szenerie wirkte weder deutsch noch italienisch. Einem spontanen Impuls folgend, setzte ich mich dazu, einzig hoffend, dass mich an diesem Abend niemand mehr ansprechen würde. Eine Weile lang ging alles gut. Von der Sprache verstand ich kein einziges Wort; hatte nicht einmal Ahnung, ob es sich um eine skandinavische oder eher slawische handelte. Nur ein einziges Wort kam mir bekannt vor, das sich oft wiederholte: »tak«. Während ich noch rätselte, was es bedeuten könnte, bemerkte mich eines der Mädchen, eine sehr attraktive Blondine.
»Do you want a sausage?«
Ich war verwirrt. Ein Würstchen – einem wildfremden Menschen angeboten? Sabine hätte so etwas nie im Leben gemacht.
»Yes …«
Sie gab mir eine frisch gegrillte Wurst, daraufhin nahm ich meinen restlichen Mut zusammen und fragte sie, woher die Gruppe käme.
»From Cracow, Poland.«
Sie seien Kunstgeschichtsstudenten.
»I see! Poland!«...