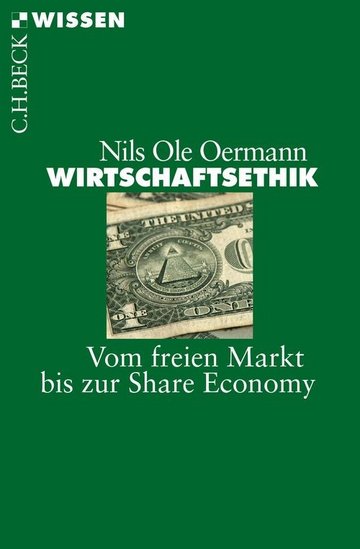«Der Intellektuelle hat niemals eine freundliche
Haltung gegenüber dem Markt eingenommen:
Für ihn war der Markt immer ein Ort für
grobe Menschen und unedle Motive.»
George J. Stigler
2. Markt, Reichtum und Gerechtigkeit:
Eine kurze Ideengeschichte
In Exemplistan gibt es eine Staatsbahn und ein staatliches Schienennetz. Die private Eisenbahngesellschaft Kesseldruck beantragt eine Betriebserlaubnis für eine Regionallinie. Die Genehmigungsbehörde erteilt die Erlaubnis mit der Auflage, die Kesseldruck AG müsse sich jährlich zu 5 Prozent an den Erhaltungskosten des staatlichen Schienennetzes beteiligen. Später teilt die Staatsbahn ihrer neuen Konkurrentin mit, sie werde weder Tickets der Kesseldruck AG verkaufen noch deren Werbung in den staatlichen Bahnhöfen dulden und erst recht nicht ihre Fernzüge mit der Kesseldruck-Regionallinie harmonisieren. Auch dürften die Lokführer der Kesseldruck nicht in die als besonders streitbar geltende staatliche Lokführergewerkschaft Exemplistans eintreten. Angenommen, alles das wäre legal – wäre es in einer Marktwirtschaft legitim, die sich «frei» nennt?
Kann man in diesem Fall noch von freiem Wettbewerb auf freien Märkten sprechen? Darf ein Staat, der sich zu einer «freien Marktwirtschaft» bekennt, aktiv und lenkend in Märkte eingreifen oder gar selbst unternehmerisch tätig werden? Wenn ja, warum und wann? Woher stammt überhaupt die Idee, dass Märkte «frei» sein sollen? Wer fundamentale Fragen, wie sie dieser Fall aufwirft, angemessen beantworten will, sollte sich zunächst mit der Ideengeschichte der Marktwirtschaft beschäftigen. Ökonomie als Wissenschaft betritt mit Adam Smith’ Werk Wealth of Nations die akademische Bühne. Dieser hatte zunächst als Moralphilosoph eine eigene Theory of Moral Sentiments verfasst, mit der er auch die Grundlage ökonomischen Handelns ethisch fundierte. Dagegen ist Ökonomie als «Handel und Wandel» und sind Märkte, auf denen Güter und Dienstleistungen gehandelt werden, fast so alt wie die Menschheit. Eine erste systematische Beschreibung der oikonomia und ihres Zwecks gibt schon der Platon-Schüler Aristoteles, für den ein Markt nicht mehr ist als ein Handelsort (Markt, von lat. mercari, als Ort, an dem man Handel treibt), der seine ethisch-politische Bedeutung aus der Tatsache zieht, dass dieses Marktgeschehen ethisch und politisch bedeutsam ist. Dank des Marktes kann die kleinste wie gesellschaftlich wichtigste Einheit einer polis, die Familie, ihre materiellen Bedürfnisse befriedigen. Damals geschieht das noch lokal oder regional und ohne intensive Arbeitsteilung. Die Haushaltungen sind autarker, weil sie vieles selber herstellen, und sie ertauschen damit, was ihnen noch fehlt. Der Markt hilft aber nicht allein den Familien, sondern zugleich dem Gemeinwesen, auf das die Familien und jeder Einzelne ausgerichtet sind. Denn der Mensch gilt für Philosophen wie Aristoteles als ein soziales Wesen (zoon politikon) und ist darum willens und in der Lage, Ordnungen zu schaffen und sich diesen Ordnungen als freier Bürger freiwillig zu unterwerfen.
Gerade in ökonomischen Fragen der Familie als der kleineren Einheit billigt Aristoteles in Einklang mit der damaligen Realität des Wirtschaftens subsidiär mehr autonomen Einfluss als den Institutionen der polis zu, weil die Bedeutung des Marktes und freier und informierter Marktakteure klar hervortritt, auch wenn Aristoteles Frauen und Sklaven nicht als Freie betrachtete. Außerdem erscheinen seine Ansichten zum Verhältnis von Markt- zu Geldwirtschaft fast 2500 Jahre später hochaktuell, ohne dass der griechische Philosoph je etwas von global agierenden Geldhäusern gehört hätte: In der Politik kontrastiert er die Haushaltskunst, die Ökonomie, mit der Erwerbskunst, der Chrematistik, und erläutert das Wesen des Reichtums, der «nichts [ist] als eine Vielheit von Werkzeugen für die Haus- und Staatsverwaltung» (Aristoteles 1998, Buch I, 1256b). Geld hat für ihn keinen Eigenwert, sondern macht lediglich alle Güter kommensurabel. Reichtum gilt für ihn darum nur als den Interessen der Sippschaften und ihrer polis dienendes Mittel und nicht als Zweck an sich selbst. Hier hat auch die aristotelische These von der Unfruchtbarkeit des Geldes ihren Ursprung; sie sollte bis hinaus über das Mittelalter, vermittelt durch das kanonische Zinsverbot, erhebliche ökonomische wie soziale Auswirkungen haben.
Die «Unsichtbare Hand»
Dass die jahrhundertelang stagnierende Wirtschaftsentwicklung in Westeuropa nicht erst im Zusammenhang mit der Reformation oder als Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges zu sehen ist, bevor das ökonomische Wachstum dann mit der Industrialisierung massiv anstieg, ist eindrücklich ablesbar an der Maddison-Kurve:
Der Entwicklungsökonom Angus Maddison illustriert damit, dass es von Aristoteles’ Zeit bis zum industrialisierten 19. Jahrhundert keine signifikanten ökonomischen Wachstumsraten gab. Diese setzten erst als Folge der aufkommenden Dampfkraft, Elektrifizierung und anderer technischer Fortschritte ein, auch wenn das Wachstum durch zwei Weltkriege und die Ölkrise des Jahres 1973 vorübergehend unterbrochen wurde. Dies hilft zu erklären, warum die Ökonomie ihre Zeit erst mit der beginnenden Industrialisierung gekommen sah: Vorher gab es für die Masse der Bevölkerung wenig Wirtschaftswachstum zu verteilen. Über die Gründe für das Funktionieren wie das Versagen von schnell wachsenden Märkten, über den Nutzen von transnationalem Warenaustausch und komplexer Arbeitsteilung dachte mit Adam Smith darum vielleicht erst dann jemand systematisch nach, als sich ihm und seinen Zeitgenossen die mit steigendem Wachstum einhergehenden ökonomischen und ethischen Dilemmata akut stellten. 150 Jahre später sollte der Nationalökonom Max Weber rückschauend zu erklären versuchen, warum ausgerechnet von protestantisch-calvinistischen Regionen aus – Holland, Südwestdeutschland, Schottland bis in die neue Welt nach Neuengland – der «Geist des Kapitalismus» seinen weltweiten Siegeszug antrat und die von Maddison diagnostizierte wirtschaftliche Stagnation nachhaltig zu beenden vermochte.
Bis ins 18. Jahrhundert war Ökonomie keine eigene wissenschaftliche Disziplin, sondern wurde als Teil der Philosophie und/oder Theologie betrieben. Die beschriebene ökonomische Reformation setzte mit Adam Smith ein, und mit Recht erklärten ihn Karl Marx und Friedrich Engels bei aller Kritik an seinen liberalen Prämissen zum «nationalökonomischen Luther» (Marx 1982, S. 383). Smith’ Hauptwerk Wealth of Nations wurde 1776, im Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, veröffentlicht. Der in Oxford ausgebildete Moralphilosoph aus Glasgow bietet in diesem Werk, das viel zitiert und wie seine mindestens genau so wichtige Ethik Theory of Moral Sentiments selten im Original gelesen wird, einen Fundus an Aussagen, die die Beziehung von Wirtschaft und Ethik sowie die besondere Bedeutung Letzterer für die moderne Ökonomie bestimmen helfen.
Um Adam Smith besser einordnen zu können, sollte man auch die so polemische wie populäre Bienenfabel (1705) des Dichters und Sozialtheoretikers Bernard de Mandeville berücksichtigen, hatte dieser doch der Idee der Notwendigkeit eines ungezügelten Marktliberalismus zu enormer publizistischer Popularität verholfen: «Stolz, Luxus und Betrügerei muss sein, damit ein Volks gedeih.» (de Mandeville 1724, S. 92) Ganz unplatonisch ist Mandeville der Meinung, dass die Gesellschaft nicht von Tugenden, sondern vielmehr von ihren Lastern zusammengehalten werde. Allerdings unterscheiden sich Mandeville und Smith beim Menschenbild an entscheidender Stelle diametral: Das Eigennutzinteresse des Menschen bejahte auch Smith als legitimen wie ökonomisch entscheidenden Faktor, weil Märkte durch ausgelebtes Eigeninteresse und nicht durch Altruismus existierten und prosperierten. Aber keinesfalls sollte Smith als Ahnherr eines Homo-oeconomicus-Modells des ausschließlich eigennutzinteressiert handelnden Marktteilnehmers verstanden werden, der Habgier nationalökonomisch zu einer «privilegierten Leidenschaft» aufgewertet hätte (Binswanger 1998, S. 47). Bei der Darstellung dieses Modells ist zu beachten, dass auch in der modernen Volkswirtschaftslehre der Homo oeconomicus als eigennutzinteressiert und nicht als eigeninteressiert zu gelten hat. Denn der eigene Nutzen kann auch von Interessenerfüllung anderer abhängen. So hängt der Nutzen von Eltern auch an dem ihrer Kinder, da Eltern auch am Wohlergehen ihrer Kinder interessiert sein werden. Genauso kann in der Nutzenfunktion die Armut anderer Menschen negativ eingehen, wodurch sich Sozialpolitik und Umverteilung modellieren lassen.
Der Moralphilosoph Smith ist jedenfalls der Überzeugung, dass die meisten Menschen nicht arbeiten, um aus Egoismus und als Selbstzweck Reichtümer anzuhäufen, sondern um aus Selbstliebe für ihr eigenes gutes Auskommen zu sorgen....