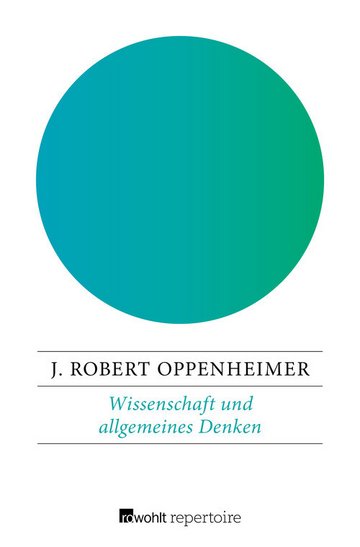II. Wissen als Werkzeug: Rutherfords Welt
Schon der Begriff Kultur und Tradition vermittelt die Vorstellung, daß das menschliche Leben einen kumulativen Charakter hat. Die Vergangenheit liegt der Gegenwart zugrunde, bedingt und beeinflußt sie, begrenzt sie in einer und bereichert sie in anderer Weise. Wir verstehen Shakespeare besser, wenn wir Chaucer, Milton besser, wenn wir Shakespeare gelesen haben. Wir würdigen Trevelyan mehr, wenn wir Thukydides kennen. Wir haben eher ein Auge für Cézanne, wenn Vermeer uns bekannt ist, und begreifen Locke viel leichter, wenn wir Aristoteles, den Evangelisten Matthäus eher, wenn wir das Buch Hiob in uns aufgenommen haben. Tatsächlich jedoch gehen wir an das Neuere nur selten mit der Kenntnis des Älteren heran; aber so gewiß Hiob Licht auf Matthäus wirft, so gewiß wirft Matthäus auch Licht auf Hiob. Wir können einen Großteil von dem, was heute geschrieben wird, verstehen, ohne im einzelnen zu wissen, was in der Vergangenheit geschrieben worden ist. Wir können einen Großteil von dem, was Shakespeare sagen will und sagt, begreifen und begreifen es auch, ohne etwas von den Männern vor ihm zu wissen, die sein Empfinden beeinflußt und geformt haben.
Der kumulative Charakter der Wissenschaft ist von ganz anderer Art und viel größerer Bedeutung. Er ist eine der Ursachen, weshalb es so sehr schwierig ist, Dinge der Wissenschaft zu verstehen, in denen man nicht weitgehend Fachmann ist – jener Wissenschaft, von der HOBBEs schrieb: ‹Sie ist von solcher Art, daß niemand sie verstehen kann, außer wer sie in hohem Maße erlangt hat.›
Hierfür gibt es zumindest zwei Gründe. Der eine liegt im Zusammenhang späterer Entdeckungen mit früheren, der zweite im Gebrauch, der von früheren Erkenntnissen als Mittel zur Erlangung weiterer gemacht wird. Wenn wir der Natur eine neue Erkenntnis abringen, wird dadurch nicht aufgehoben, was wir vorher wußten, wir überschreiten vielmehr die Grenzen bisherigen Wissens und betreten Neuland, und das können wir oft nur unter voller Ausnutzung des bisherigen Wissens. Die Arbeiten von HUYGENS und FRESNEL über die Wellennatur des Lichts sind heute so wichtig wie je, obwohl wir wissen, daß das Licht auch Eigenschaften hat, die außerhalb des Rahmens ihrer Untersuchungen und Erfahrung blieben, Eigenschaften, die im atomaren Bereich entscheidend sind. NEWTONs Gravitationsgesetz und seine Mechanik gelten für riesige Gebiete des physikalischen Geschehens und verlieren dadurch nichts von ihrem Wert, daß sie in anderen, noch unermeßlicheren Gebieten den umfassenderen Gesetzen EINSTEINs weichen müssen. Die Theorie von der Wertigkeit, die in der Chemie eine große Rolle spielt, ist durch das Eindringen in das Verhalten der Elektronen und Atomkerne bei chemischen Umsetzungen erklärt, erhellt und bis zu einem gewissen Grade erweitert worden. Aber sie ist damit nicht überholt und wird vermutlich weiter von Nutzen sein, solange sich der Mensch für Chemie interessiert. Die einmal gesicherten Erkenntnisse und die Gesetze, in denen sie zum Ausdruck kommen, bleiben bestehen, wie weit auch die Wissenschaft fortschreitet; sie werden verfeinert und in neue Zusammenhänge eingefügt, aber niemals wieder aufgegeben oder umgestoßen.
Doch das ist nur die eine Seite der Sache. Hinzu kommt als immer wiederkehrendes Ereignis beim Fortschritt der Wissenschaft, daß das, was gestern Gegenstand des Studiums war, als solches die Wißbegier fesselnd, heute etwas Selbstverständliches ist, das man versteht, dessen man sicher ist, etwas Bekanntes und Vertrautes – ein Werkzeug zu weiterer Forschung und Erkenntnis. Manchmal ist das Werkzeug, das zur Erweiterung unserer Erfahrung benutzt wird, etwas Naturgegebenes, an dem der Forscher kaum etwas ändern kann und das nur wenig in seiner Hand liegt. So gebrauchen wir bekanntlich Kalkspatkristalle, um einen Lichtstrahl in zwei polarisierte Strahlen zu zerlegen. So ist die kosmische Strahlung, wie wir wissen, zugleich ein Gegenstand der Forschung und ein Werkzeug von bisher nicht gekannter Macht, um die Eigenschaften und Umwandlungen der Urmaterie auf der Erde und im Laboratorium zu untersuchen. Manchmal verkörpert sich vorhandenes Wissen aber auch nicht in etwas Naturgegebenem, sondern in einer Erfindung, ja in ganzen Erfindungspyramiden, in neuen technischen Verfahren.
Es gibt eine ganze Reihe bekannter und wichtiger technischer Neuerungen aus der Zeit des letzten Weltkrieges, die für den Physiker und den Biologen zu neuen Werkzeugen seiner Forschung geworden sind. Es seien nur zwei genannt: Das Radar-Verfahren, d.h. das Erzeugen, Richten und Nachweisen ultrakurzer elektromagnetischer Wellen, spielte eine hervorragende Rolle in der ‹Schlacht um Großbritannien›. Seither ist es ein machtvolles Mittel zur Untersuchung atomarer, molekularer, ja sogar nuklearer Probleme geworden, das zu subtilen Entdeckungen über die Gesetze der Wechselwirkung von Elektronen, Protonen und Neutronen geführt hat.
Der Kernreaktor seinerseits verkörpert in seinem technischen Aufbau ein sehr junges Wissen von den Spaltungsvorgängen im Uran und vom Verhalten der Neutronen beim Zusammenstoß mit Atomkernen. Er ist heute aber bereits ein hochwichtiges Werkzeug der Forschung, dessen gesteuerte und genau bekannte Strahlung uns Aufschluß gibt über Dinge, die uns bisher so gut wie unzugänglich waren. Künstlich radioaktive Substanzen, die in großer Menge in Kernreaktoren erzeugt werden, ermöglichen es uns, den Weg bestimmter Elemente bei chemischen und biologischen Vorgängen zu verfolgen. Besonders in der Biologie dürften sie eine Erweiterung unserer Untersuchungsmöglichkeiten und Methoden bedeuten, die derjenigen durch das Mikroskop vergleichbar ist.
Es ist natürlich eine starke Vereinfachung, wenn man sagt, daß neue Methoden, die sich auf neuentdeckte natürliche Erscheinungen gründen, ganz und gar als selbstverständlich und gesichert hingenommen werden; aber mehr oder weniger trifft das zu. Sie werden zu einem Teil des Forschers, wie ein Werkzeug ein Teil des Handwerkers ist, so wie der Bleistift in der Hand des Schriftstellers aufhört, etwas für sich zu sein, und fast zu einem Teil des Schriftstellers wird, ja, so wie das Pferd unter einem guten Reiter nicht mehr das Haustier ist, für das gesorgt werden muß, sondern mit ihm zu einem Ganzen verwächst. So werden auch neue Erkenntnisse und Erfindungen zu einem Teil des Wissenschaftlers, eröffnen ihm neue Möglichkeiten der Wahrnehmung, neue Möglichkeiten der Betätigung.
Das gilt natürlich mit einer gewissen Einschränkung. Kein Forscher nimmt sein Gerät als so selbstverständlich hin, daß er nicht nachprüft, ob es seine Aufgabe auch erfüllt; aber welche Aufgabe es erfüllen soll, ist für ihn im allgemeinen etwas Feststehendes, das keiner weiteren Prüfung bedarf. Das gilt meist auch, wenn es sich eher um eine technische Erfindung als um eine wirkliche Erkenntnis handelt. So hat die photographische Platte der Wissenschaft jahrzehntelang als Hilfsmittel gedient, obwohl man ihr Verhalten nur zu einem geringen Teil verstand. Jedes Gerät kann einmal ausfallen, und im Laboratorium kommt das oft vor. Das Pferd muß beschlagen, gefüttert, gesattelt und gezäumt werden, bevor es mit dem Reiter eins werden kann. Und doch gebrauchen wir, was wir besitzen, um weiterzugelangen. Ein ständiges Zweifeln an der Richtigkeit einmal gewonnener Erkenntnisse ist nicht Art der Wissenschaft. Wenn EINSTEIN sich nicht die Frage stellte: ‹Was ist eine Uhr?›, sondern: ‹Wie synchronisiert man Uhren über weite Entfernungen mit großer Genauigkeit?›, so spricht daraus keine wissenschaftliche Skepsis. Vielmehr wird dadurch beleuchtet, wie der kritische Verstand vorgeht, um Unstimmigkeiten, regelwidrige und verwirrende Dinge, die durch Experimente von größerer Genauigkeit und neuer Anordnung aufgedeckt worden sind, in einer neuen Synthese aufzuheben.
All das deutet darauf hin, daß die Wissenschaft in einem ganz besonderen Sinne kumulativ ist. Wir können nicht wirklich verstehen, was ein neues Experiment bedeutet, wenn wir nicht wissen, welches die Werkzeuge und die Erkenntnisse sind, die seine Anlage voraussetzt. Das ist einer der Gründe, weshalb der Vegetationspunkt der Wissenschaft (der Ort, wo sich Neues erschließt) wohl im allgemeinen so unzugänglich ist. Was sie feststellt, wird in Begriffen und Gesetzen ausgedrückt, die von der Vergangenheit geprägt sind. Darum verbringt ihr Jünger so lange Jahre damit, sich das Wissen und die Methoden anzueignen, die er später als tätiger Wissenschaftler als gegeben voraussetzt und gebraucht; darum ist das Betreten dieses langen Tunnels, an dessen Ende erst das Licht der Erkenntnis schimmert, für den Laien, sei er Künstler, Gelehrter oder Mann der Praxis, so entmutigend.
Für die Verwandlung eines Gegenstandes der Forschung in ein Werkzeug der Forschung ist RUTHERFORDs Alphateilchen ein klassisches Beispiel. Wir wollen seiner Spur eine Weile folgen. Denn sie führt uns mitten ins Herz der Atomphysik. Das Alphateilchen, das von vielen natürlich radioaktiven Elementen ausgesandt wird und mit dem Atomkern des Heliums identisch ist, war in der Tat für RUTHERFORD und seine Schule ein einzigartiger Schlüssel zur Welt der Atome. RUTHERFORDs erste Arbeiten hatten hauptsächlich der Beschreibung der wunderbaren Geschichte der radioaktiven Familien gegolten, die mit der selbsttätigen Umwandlung der schweren Elemente Uran und Thorium beginnt. Zu dieser Geschichte gehört die Feststellung der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den verschiedenen radioaktiven Elementen, die der Reihe nach durch Zerfall entstehen und sich wieder weiter umwandeln.
Außerdem...