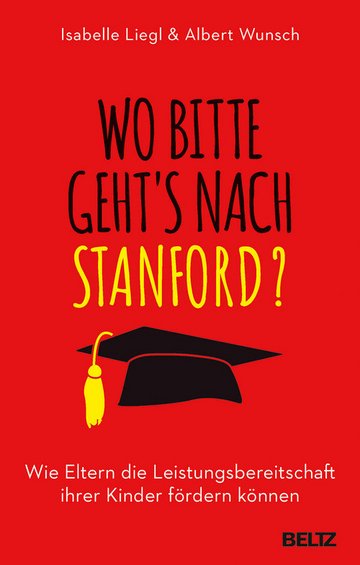Vorwort von Isabelle Liegl
Gerade einen Tag ist es her, dass wir aus Chicago zurückgekommen sind. Vier Tage waren wir in der Windy City, die für eine Stadt mit vielen Hochhäusern besonders schön ist. Nicht zu groß und nicht zu klein, gelegen an einem himmelblauen Riesensee, von ausnehmend schöner Architektur, mit ungewöhnlich vielen und berühmten Skulpturen auf großen Plätzen, interessanten und kreativen Restaurants und last but not least einem der schönsten Kunstmuseen der Welt, dem Art Institute of Chicago, sowie einer hervorragend besetzten Oper.
Für uns aber ist und war ein Ort der beste aller Orte in Chicago, die University of Chicago, an der unser jüngerer Sohn Frederic studiert. Eine Universität wie aus dem Bilderbuch, mit weinberankten Gebäuden im neogotischen Stil, einer alten Bibliothek, die an Harry Potter erinnert, und einer enormen modernen Bibliothek unter einem imposanten eiförmigen Glasdach. Auf dem Weg zu topmodernen Forschungszentren begegnen wir einer Menge internationaler Studenten und Studentinnen und erleben die dem Mittleren Westen eigene Liebenswürdigkeit, wie man sie nur noch selten auf der Welt findet.
Neben vielen kleinen Cafés gibt es einen wunderschönen Hauptplatz, der von Besuchern aus unzähligen Ländern nur so wimmelt. Gruppen von Touristen betrachten andächtig die Inschriften auf den Gebäuden und hoffen, einen Nobelpreisträger zu entdecken – und sie sprechen von der Zukunft ihrer Kinder. In der University of Chicago finden Sie laut The Economist die beste Business School der Welt, genannt Booth, an der weltweit die meisten Nobelpreisträger in Economics lehren.
Unser älterer Sohn studiert an der Stanford University, ebenfalls in den USA an der Westküste in der Nähe von San Francisco gelegen. Die Universität Stanford liegt im sogenannten Silicon Valley und ist so groß, dass man zumindest ein Fahrrad braucht, um sich auf dem Campus zu bewegen.
Es gibt unzählige neue Gebäude, gestiftet von bekannten Firmengründern und berühmten Unternehmen, Palmen säumen die Hauptavenuen, der Konzertsaal wurde in zwei Jahren gebaut und würde die Münchner glücklich machen. Es gibt ein hervorragendes Krankenhaus auf dem Campus, genauso wie ein großes und schönes Einkaufszentrum. Was jedoch besonders auffällt, ist die sportliche und fröhliche Atmosphäre um uns herum. Alle fahren auf Fahrrädern und Skateboards, sausen gut gelaunt auf Rollschuhen von Gebäude zu Gebäude oder über Plätze, die mit beeindruckenden Skulpturen geschmückt sind. Alles ist grün, voller Blumen und sehr gepflegt. Das Klima ist angenehm, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Auf dem Hauptplatz spielt ein bärtiger, langhaariger Physikprofessor täglich Saxofon. Eine Gruppe junger Frauen protestiert gegen Diskriminierung, eine andere Gruppe übt einen Tanz ein. Das Football-Stadion ist fast so groß wie die Allianz Arena in München, und die Fitnesszentren übertreffen alles, was man sich nur vorstellen kann. Stanford-Studenten gewinnen bei den Olympischen Spielen im Schnitt 16 Medaillen, und wenn sie als eigenes Land antreten könnten, wären sie die Fünftbesten der Welt.
Beide Universitäten – die University of Chicago und die Stanford University – gehören zu den Top-Universitäten der Welt.
Sie werden sich nun vielleicht denken: Da ist offenbar eine extrem ehrgeizige Mutter bei ihren verwöhnten Sprösslingen zu Besuch gewesen, die die letzten Jahre damit verbracht hat, ihre Kinder auf Höchstleistungen zu drillen. Doch so einfach ist es nicht – vor allem ist es falsch. Unsere Kinder sind ambitioniert – oder wie soll ich es sagen? Ehrgeizig. Dieses Wort hat im Deutschen einen eher negativen Klang, denn Geiz ist keine Tugend, er ist verwandt mit dem Neid. Und der ist allenfalls eine Untugend.
Für mich ist der Werdegang meiner Kinder eher ein Beweis dafür, wie es gehen kann, wenn manche Phasen im Leben ein bisschen anders gestaltet sind, sei es generell während der Kindheit oder speziell in Kindergarten und Schule und dann vor allem in der wichtigen Zeit vor dem Schulabschluss. Aber was heißt hier anders?
Anders heißt, Erziehungsideale oder Sichtweisen zu haben, die sich durchaus von traditionellen oder auch vermeintlich deutschen unterscheiden. Anders ist, wenn durch die Erziehung der Vergleich von Deutschland mit Ländern wie England, Frankreich und den USA erst auffällig wird. Wenn ich mich streng nach hierzulande üblichen und von der Mehrheit für gut befundenen Erziehungsregeln richte, dann kann ein Vergleich gar nicht erst entstehen, denn mein Fokus ist nur nach »innen« gerichtet. Der Blick nach »draußen« aber findet oftmals nicht oder nur sehr eingeschränkt statt, mit vielen Vorbehalten, falschen Informationen und bei uns auch gern mit viel Kritik. Anders ist, wenn als Ziel der Erziehung nicht die Konformität oder die möglichst optimale Anpassung an das vorhandene System angestrebt wird, sondern wenn das Ziel in einer Fülle von Möglichkeiten besteht, unter denen man eine informierte Entscheidung treffen kann, die den persönlichen Talenten und Vorstellungen gerecht wird. Und dabei geht es nicht um äußerliche Entscheidungsfaktoren wie Land, Leute, Sprache oder was »man« für das Beste hält, sondern es geht um Erkenntnisse, die die Kinder und Jugendlichen selbst erfahren haben: Wer bin ich? Was kann ich? Wo kann ich mich verbessern und wie schaffe ich das?
Wir haben zu Hause Wert darauf gelegt, dass unsere Kinder bereits früh gejobbt und sich sozial engagiert haben. Sie haben von beiden Elternteilen gelernt, dass es im Leben nichts geschenkt gibt und dass es sich aus vielen Gründen lohnt, etwas zu leisten – nicht zuletzt deshalb, weil der schönste Erfolg ein verdienter Erfolg ist.
Es ist ein Modell, das sich letztlich aufs ganze Leben übertragen lässt. Und es ist eines, das in der Erziehung oft zu kurz kommt. Da wird gern der leichte Weg genommen, sei es wegen mangelnden Interesses, sei es, weil alles andere zu anstrengend ist oder weil wir oft genug nicht wissen, was richtig und was falsch ist, was unsere Kinder weiterbringt und was sie stresst, oder weil wir schlichtweg nicht wahrnehmen, was gut oder eben nicht so gut läuft. Gern wird die Verantwortung auch ab einem gewissen Alter abgegeben – und das Internat übernimmt den Job.
Doch so leicht darf man es sich nicht machen. Tatsächlich steckt in unseren Kindern alles drin – man muss es nur herauslocken. Viele Kinder könnten so viel besser reüssieren, wenn man sie nur frühzeitig mit ihren Fähigkeiten bekannt gemacht hätte.
Wir haben von unseren Kindern nichts Unmögliches verlangt. Aber wir haben sie auch nicht unterfordert. Wir haben sie gefördert und gefordert, und ich kann sicher sagen, es sind glückliche junge Menschen aus ihnen geworden. Und das sicher nicht trotz gewisser Forderungen, die wir an sie gestellt haben, sondern zu einem Gutteil auch wegen dieser Forderungen. Wir haben sie aufgefordert, sich nicht mit weniger zufriedenzugeben, als sie leisten und schaffen können. Wir haben sie aufgefordert, sich Ziele zu setzen und diese Ziele auch mit Leidenschaft zu verfolgen. Ein chinesisches Sprichwort rät, sich einen Beruf zu suchen, den man liebt, denn dann muss man nie wieder arbeiten! Diese Vorstellung gefällt mir.
Das Wesentliche aber, was wir aus Stanford und Chicago zurück nach München mitgebracht haben, ist der Eindruck, dass wir bis jetzt entgegen aller Unkenrufe, die lange nicht verstummen wollten, wohl alles richtig gemacht haben – soweit man so etwas behaupten kann. Unsere Kinder erhalten eine unglaublich gute Ausbildung an zwei der besten Universitäten der Welt. Dazu gehört ein Kosmos, in dem Intelligenz, Kreativität und Zukunft brillieren. Es gibt herausragende Forscher und beeindruckende Professoren, die weltweit Anerkennung genießen. Eine der besten Stammzellenforscherinnen der Welt lebt und arbeitet in Stanford – sie war in ihrem früheren Leben Bibliothekarin. Die Studenten und Studentinnen sind beeindruckend interessant, offen und motiviert, und der Campus, auf dem sie leben und arbeiten, ist nicht nur schön, sondern bietet einfach alles, was man sich als Eltern für seine Kinder erträumen kann.
Und das fühlt sich wirklich gut an. Nicht weil wir uns persönlich bestätigt fühlen, sondern weil wir uns schlichtweg keine Sorgen zu machen brauchen. Unsere Söhne können mit Hilfe ihrer Universitäten durchstarten, nicht nur in puncto Praktika oder Jobs, sondern auch im Anschluss daran. Diese Sicherheit kommt nicht von allein und mühelos oder weil unsere Söhne Genies sind. Denn das sind sie sicherlich nicht. Sie kommt durch harte Arbeit zur richtigen Zeit. Sie kommt von einer durchdachten Bewerbungsstrategie dank langer und...