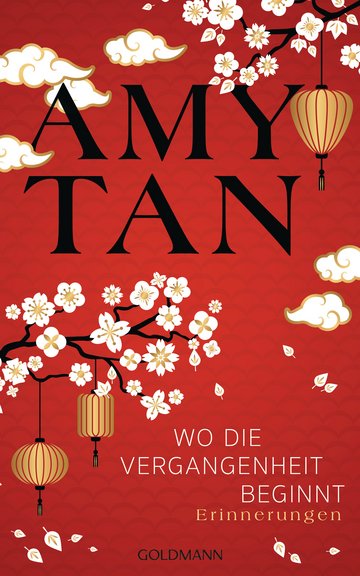KAPITEL EINS
Eine überbordende Fantasie
Von frühester Kindheit an war ich überzeugt, ganz besonders viel Fantasie zu besitzen. Diese Einschätzung stammte gar nicht von mir selbst. Mehrere Leute hatten mir gesagt, ich hätte eine künstlerische Vorstellungsgabe, weil ich eine Katze malen konnte, die aussah wie eine Katze, und ein Pferd, das aussah wie ein Pferd. Sie lobten mich, weil ich ein Haus mit einer Tür malte, das im Größenverhältnis zu den Menschen passte, die daneben standen. Sie bewunderten den Baum neben dem Haus, seinen dicken Stamm und die kleineren Äste mit den winzigen grünen Blättern. Sie fanden es kreativ, dass ich noch einen Vogel in den Baum gesetzt hatte. Die Leute bestaunten kopfschüttelnd meine Zeichnungen und sagten, ich hätte ein großartiges Vorstellungsvermögen.
Zu Anfang fragte ich mich, warum andere nicht konnten, was mir ganz einfach zufiel. Man musste doch nur zeichnen, was man mit den eigenen Augen sah, sei es eine echte Katze oder eine Katze auf einem Foto, und wenn man es ein paar Mal gezeichnet hatte, dann war es ein Leichtes, es aus dem Gedächtnis zu tun. Mit zwölf konnte ich so gut zeichnen, dass mich mein Klavierlehrer im Austausch für meine Klavierstunden bat, seiner achtjährigen Tochter Malunterricht zu geben. Wahrscheinlich gab ich dem Mädchen Tipps wie: Die Augen solltest du in die Mitte malen und die Nase dazwischen, nicht auf die Stirn, so wie du es hier gemacht hast. Zeichne es einfach so, wie es ist.
Später merkte ich, dass ein gutes Auge nicht dasselbe ist wie gutes Vorstellungsvermögen. Mein Kunstlehrer auf der Highschool, selbst ein Künstler, schrieb in mein Abschlusszeugnis: »Bewundernswerte zeichnerische Fähigkeiten, aber es mangelt ihr an Fantasie oder Schwung. Beides ist nötig, um eine tiefere kreative Ebene zu erreichen.« Dieser Kommentar kränkte mich damals zutiefst. Er sagte nicht, ich solle meine Fantasie stärker zum Ausdruck bringen. Er sagte einfach, es mangle mir an Fantasie – an Fantasie und an Tiefe.
Nach meinem letzten Jahr an der Highschool lagen meine künstlerischen Neigungen brach, gelegentlich zeichnete oder kritzelte ich etwas. Hätte ich weitergemacht, ich hätte mich sicher nicht in Richtung abstrakte Kunst weiterentwickelt, das weiß ich. Noch heute stellt mich die abstrakte Kunst häufig vor ein Rätsel – diese drei Meter hohen Bilder mit einem winzigen Farbklecks oder Kringeln darauf. In Museen stecken mein Mann und ich gern die Köpfe zusammen und reden im Spaß wie zwei Kulturbanausen: »Das soll Kunst sein?« Ich erinnere mich heute, dass wir an mehreren Nachmittagen im Unterricht ein Bild malen sollten, das nur aus bunten Formen bestand. Was auch immer ich versuchte, wahrscheinlich hat meinen Kunstlehrer das nur in seiner Meinung bestätigt, dass es mir an Fantasie und Tiefe mangelte, zumindest hinsichtlich der Komplexität von abstrakter Kunst. Und das war genau die Kunst, die er machte, wie ich mich jetzt entsinne.
Erst kürzlich habe ich wieder mit dem Zeichnen begonnen, als ich bei einem Naturzeichenkurs mitmachte, der einmal im Monat stattfand. Dabei ging es genauso um die naturgetreue Darstellung wie um das Zeichnen unter freiem Himmel. Ich begann damit, Vögel zu zeichnen. Wieder höre ich dieselben Komplimente von Freunden und Familienmitgliedern: dass ich ein gutes Auge hätte. Ich kann einen Vogel zeichnen, der aussieht wie ein Vogel. Doch heute erkenne ich, dass meine Fähigkeiten hier aufhören. Ich kann ein Abbild zeichnen, aber es fällt mir nicht leicht, einen Hintergrund zu gestalten, der komplexer ist als ein Zweig mit ein paar Blättern. Ich kann keinen neuen Kontext hinzufügen – umstürzende Gebäude oder schmelzende Polkappen – oder irgendetwas anderes, das der figürlichen Darstellung einen ideellen Wert beimengen würde, zum Beispiel die Erderwärmung mit den Augen eines Raben gesehen. Wie sich herausstellte, verfügten alle Teilnehmer des Kurses über ein gutes Auge, und einige waren besonders begabt und dazu noch fantasievoll. Unser Lehrer, ein naturalistischer Künstler und Autor, erzählte uns, jeder könne zeichnen lernen, eine Ansicht, die ich seither von zahlreichen Künstlern gehört habe. Man kann sich Techniken aneignen – zum Beispiel, wie man die Gestalt des Motivs ausblendet, wie man sich den negativen Raum um ein Motiv zunutze macht, um seine Form zu erkennen, wie man mit Schraffierungen die anatomische Struktur von Vögeln, Amphibien und großen Säugetieren darstellt. Man kann mit einer Mischung aus Wasserfarben, Gouachen und Graphit spielen. Mit Kladde und Bleistift kommt man wunderbar über die Runden, man kann aber auch seinen künstlerischen Bedürfnissen gerecht werden, indem man seine Ersparnisse ausgibt für Druckbleistifte, Papierwischer, Gelschreiber, ein Set mit zwölf weichen und harten Bleistiften, hochwertige Aquarellstifte, dann noch hochwertigere Aquarellstifte, ein Prägewerkzeug, Aquarellpinsel, Aquarellpinsel mit eingebautem Wasserbehälter, Skizzenhefte und dann richtig gute Skizzenhefte, Ferngläser mit Zoom- und Makrofunktion, ein Spektiv, eine Feldforschungstasche für die Zeichenutensilien sowie einen Klapphocker, um stundenlang im Freien zu sitzen. Man muss täglich üben, bis manche Fertigkeiten sitzen – zum Beispiel perspektivische Verkürzungen und Schatten im Verhältnis zum Lichteinfall. Die Form des ganzen Tiers muss stimmen, bevor man ein Auge zeichnen kann. Aber ich kann nicht anders – ich zeichne das Auge gerne frühzeitig und korrigiere es später. Ich mag es, wenn mich der Vogel skeptisch beäugt, während ich ihn vollende.
Ich habe jetzt täglich gezeichnet, und mir ist klar geworden, warum ich nicht für die bildende Kunst geschaffen bin. Es hat damit zu tun, was nicht passiert, wenn ich zeichne. Noch nie stellte sich bei mir die Erkenntnis ein, verbunden mit einem plötzlichen Schaudern, dass meine Zeichnung ein Porträt meines Wesens abbildet. Wenn ich Aquarellfarben mische, dann nicht mit Gedanken über den sich stetig ändernden Mischmasch aus Ansichten, Verwirrung und Ängsten. Wenn ich schraffiere, dann nicht mit Gedanken an den Tod und seinen wachsenden Schatten, während die versicherungsstatistische Zahl der mir noch verbleibenden Jahre immer kleiner wird. Wenn ich einen Vogel schräg von der Seite betrachte und nicht im Profil, denke ich nicht an irrtümliche Ansichten, die ich einmal hatte. Mit mehr Übung werde ich das Auge eines Vogels oder seine Füße besser zeichnen können, aber ich kann nicht üben, unerwartet Einsicht in meine Seele zu bekommen. All diese Gedanken – die sich nicht einstellen, wenn ich zeichne –, kamen mir jedoch stets beim Schreiben. Sie stellten sich bei den allerersten Kurzgeschichten ein, die ich mit fünfunddreißig verfasste. Damals wie heute sind das regelrechte Erkenntnisse – schmerzhaft, beglückend, verändernd und nachhaltig. Beim Schreiben erkenne ich mich selbst.
Das Zeichnen wird mir weiterhin und immer mehr eine angenehme Tätigkeit sein. Mir gefällt, dass es Übung und Geduld erfordert. Ich mag die sinnliche Erfahrung, wenn Graphit über Papier gleitet. Vor zwei Tagen machte ich die aufregende Entdeckung, dass Aquarellfarben nicht einfach flache Pigmentflatscher sind. Sie lassen Marmorierungen, Schattierungen und andere interessante Effekte entstehen, die Textur und Tiefe andeuten. Ich bin entzückt über das Endergebnis. Ist es ein gutes Abbild? Wirkt es lebendig? Ich amüsierte mich über meinen kindlichen Stolz, als eine Followerin auf Facebook mein erstes Aquarell von einem Blässhuhn kommentierte, einem Vogel mit weißem Schnabel und schwarzem Körper: Sie haben sein Wesen gut erfasst. Sie wusste, es war ein Blässhuhn.
Ich habe auch Ähnlichkeiten zwischen dem Zeichnen der Natur und dem Schreiben gefunden. Ich muss dazu neugierig sein, aufmerksam und wissbegierig. Ich muss mir permanent darüber Gedanken machen, was ich sehe, und die üblichen Annahmen ad acta legen. Ich habe mir schon immer gerne über alles Mögliche Gedanken gemacht, schon bevor ich wusste, dass ich Schriftstellerin bin. So ist es auch heute noch. Als ich zum Beispiel in Südafrika auf Robben Island war, bemerkte ich vier schwarze Austernfischer mit orangeroten Augen. Sie steckten gleichzeitig die Schnäbel in den Sand, sahen uns an, dann steckten sie sie wieder hinein – alles mit der Präzision der Showtanzgruppe Radio City Rockettes, nur das es Vögel waren. Was war da los? Ich ließ mir die diversen Möglichkeiten durch den Kopf gehen. Manche waren recht weit hergeholt – ein instinktives »Gleich und gleich gesellt sich gern« oder dass sie, indem sie sich synchron bewegten, wichtige Veränderungen in ihrer Umgebung wahrnahmen, zum Beispiel einen Fischadler oder einen Haufen gaffender Touristen mit klickenden Kameras. Oder sie waren von einem Parasiten oder einem Virus befallen, der eine Art Zombievogelsyndrom hervorrief, ganz ähnlich wie die Zombieameisen, die ich in Papua gesehen hatte: Aus deren Gehirn wächst ein schäumender parasitischer Pilz, der sie zuvor dazu gebracht hat, möglichst hoch auf eine Pflanze zu klettern. Die Sporen bringen schließlich eine neue Generation von Zombieameisen hervor. Werde ich das nächste Mal Zeuge von so einem synchronisierten Verhalten, dann werde ich mich wieder dasselbe fragen und mir neue mögliche Gründe dafür einfallen lassen. Wenn ich Zeichnungen von der Natur anfertige, versuche ich darzustellen, was ich sehe, was einer bestimmten Vogelart und ihrem Verhalten entspricht. Meine Beobachtungen und Fragen haben damit zu tun, was faktisch richtig sein könnte, und um das herauszufinden, müsste ich auf jeden Fall einen Ornithologen fragen. Aber wenn ich Literatur schreibe, dann entspricht die Wahrheit, die ich suche,...