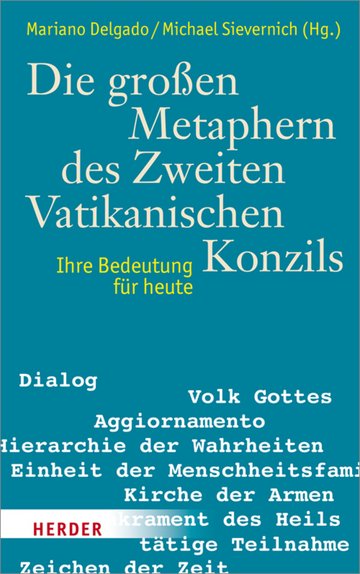Zur Rezeption und Interpretation des Konzils der Metaphern
Mariano Delgado / Michael Sievernich
Das Zweite Vatikanische Konzil gilt als das bedeutsamste religiöse Ereignis des 20. Jahrhunderts. Mit ihm hat die katholische Kirche eine enorme – in der Religionsgeschichte beispiellose – Anstrengung unternommen, ihre Identität und ihre Sendung unter den Bedingungen der Moderne zu definieren und zu erklären. Religionssoziologen wie Franz-Xaver Kaufmann betonen die Singularität des Konzils: „Keine andere Weltreligion hat eine vergleichbare kollektive Auseinandersetzung mit der Moderne auch nur versucht, geschweige denn ein vergleichbar eindrückliches Ergebnis erzielt“.1 Das will aber auch heissen: Keine andere Religionsgemeinschaft hat sich einem solchen fundamentalen Wandel ausgesetzt.
1. Phasen der Rezeption
Die Unterscheidung von drei Phasen in der bisherigen Rezeption dürfte in der Konzilsforschung konsensfähig sein. Die Phase des Überschwangs war geprägt durch eine kritische Absetzbewegung von der so genannten „pianischen“ Epoche. Einigen erschien das Konzil als „ein absoluter Neubeginn; sie verloren aus dem Blick, dass das Konzil in einer Kontinuität steht und dieselbe auch wollte“2.
Es ist nicht leicht zu sagen, wann die Phase der Enttäuschung begann. Wahrscheinlich zwischen 1968 und 1971, als einige namhafte Theologen sich gegen die Absetzbewegung der ersten Phase und das Verständnis des Konzils als Neubeginn in der Kirchengeschichte positionierten. Die Gründung der Internationalen Katholischen Zeitschrift Communio 1971 gehört zu den markantesten Ereignissen dieser Zeit. Der Leitartikel von Hans Urs von Balthasar im ersten Heft derselben gibt Auskunft über die Kehre und die Bemühung um Kontinuität, die für diese Phase prägend ist. Diese Zeit ist auch markiert durch wiederholte Schreiben des Lehramtes gegen Tendenzen in der Konzilsrezeption, die Gefahr liefen, das Kind mit dem Bade auszuschütten: angefangen mit dem Apostolischen Schreiben Pauls VI. Über die Versöhnung in der Kirche (1974), das ein Mahnwort über die Notwendigkeit und Grenzen des Pluralismus in der Kirche ist, während das Apostolische Schreiben Evangelii nuntiandi (1975) sich gegen den missionarischen Defätismus wehrt und das Apostolische Schreiben Catechesi tradendae (1979), das auch eine Folge des Pontifikats Pauls VI. ist und auf die Krise der Glaubensweitergabe aufmerksam macht.
Es folgt eine dritte Phase, die mit der außerordentlichen Bischofssynode von 1985 eröffnet wurde. Die Synode stellte hermeneutische Regeln zu einer „vertieften Rezeption des Konzils“ auf (s. u.) und lud ein, „das Zweite Vatikanische Konzil besser und vollständiger kennenzulernen, es eingehender und tiefer zu studieren, die Einheit aller Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen weiter zu durchdringen und ihre Schätze zu heben“. Sie erinnerte auch daran, dass das Konzil ja gerade deshalb einberufen wurde, „eine Erneuerung der Kirche besonders im Hinblick auf die Verkündigung in einer veränderten Welt zu ermöglichen“.3 Seitdem ist die Konzilsrezeption durch eine intensive Konzilsforschung und ein wissenschaftliches Ringen um die Interpretation des Konzils gekennzeichnet, aber auch durch ein eher defensiv eingestelltes römisches Lehramt, wie die Instruktionen über die Theologie der Befreiung (1984, 1986) und über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester (1997) oder die Erklärung Dominus Iesus über die Einzigkeit der Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche (2000) zeigen.
Man kann in dieser dritten Phase, in der wir uns befinden, auch von einer Gefahr der Rezeptionsverweigerung sprechen. Dies betrifft nicht nur diejenigen, die entweder beim ultramontanen Kirchen- und Traditionsverständnis bleiben möchten oder ein Drittes Vatikanisches Konzil fordern, weil das 2. Vaticanum ihnen zu weit oder nicht weit genug gegangen ist. Es betrifft auch die Haltung der römischen Kurie. Rezeptionsverweigerung von oben wäre kein Novum in der Kirchengeschichte: am 1. November 1610 wurde Karl Borromäus, der in seinem Mailänder Bistum für eine beispielhafte Umsetzung der Trienter Reformdekrete gesorgt hatte (Visitationen, Hebung des theologischen und sittlichen Niveaus des Klerus, rege synodale Tätigkeit, Verkörperung des neuen Bischofsideals als „pastor“, der dem Beispiel des guten Hirten nacheifert, und nicht als „dominus“, der seine Schafe unterdrückt und von deren Wolle lebt), heilig gesprochen. Doch darauf folgte in Rom nicht ein Jahrhundert der Umsetzung der Trienter Kirchenreform, sondern eher eines, in dem die Übel des Renaissance-Papsttums, das Höfische und der Nepotismus, weitere Höhepunkte erlebten.
2. Verschiedene Interpretationen
Das singuläre Ereignis, die diversen Dokumente und die weltweite Wirkungsgeschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils fordern ein halbes Jahrhundert post festum zu einer Interpretation heraus, die der Inspiration Johannes XXIII. und der Intention der Konzilsväter gerecht wird, aber auch der Kirche in Gegenwart und Zukunft dienlich ist. Die Deutungen sind pluraler Art und gehen teilweise weit auseinander. Das Spektrum beginnt auf der einen Seite bei der providentiellen Sicht des Konzils als eines Ereignisses des Heiligen Geistes. Sie hebt darauf ab, dass die Kirche schon vor dem einschneidenden Kulturwandel der 60er und 70er Jahre durch Beratung und Abstimmung in einer konziliaren Versammlung zum Konsens und zu Kategorien für ein neues Selbstverständnis und für eine neue Zeitgenossenschaft gefunden hat. Auf der anderen Seite verliert sich das Spektrum in einer partiell negativen oder total ablehnenden Sicht des Konzils, die bestimmte Dokumente in ihrer Geltung herunterstufen möchte oder konziliare Entscheidungen wie die zu den nichtchristlichen Religionen oder zur Religionsfreiheit nicht anzuerkennen bereit ist.
Zwischen diesen Positionen gibt es zahlreiche weitere Einstellungen zum Konzil, die jedoch meistens von einer positiven Grundstimmung geprägt sind und auf eine weitere, intensivierte Rezeption drängen, damit die Kirche als Volk Gottes „für das ganze Menschengeschlecht die stärkste Keimzelle (germen) der Einheit, der Hoffnung und des Heils“ werde (LG 9). Die mehrheitlich positive Grundsicht wird oftmals von der Hoffnung auf weitere Reformschritte begleitet; sie hofft darauf, dass die Kirche „unter dem Wirken des Heiligen Geistes nicht aufhöre, sich selbst zu erneuern“ (LG 9). Die Erwartungen an das Konzil sind nach wie vor sehr groß und erfordern ein verstärktes Studium der Dokumente und ihre weitere Rezeption im zeitgenössischen Kontext. Vor allem setzt sich die Einsicht durch, dass die Reformschritte nicht erst dort beginnen, wo die großen Institutionen und deren Verantwortliche ins Spiel kommen, sondern dass die abgestufte Verantwortung im Sinn des Konzils schon bei den einzelnen Gläubigen und ihrem glaubwürdigen Zeugnis in säkularen Zeiten beginnt.
Dass es bei grundsätzlicher Akzeptanz und Wertschätzung des Konzils durchaus unterschiedliche Interpretationen geben kann, liegt auf der Hand. Denn die sechzehn Dokumente bieten ein breites Spektrum von Thematiken, die sich einerseits mit der Kirche und ihren inneren Vollzügen befassen und andererseits mit ihren Bezügen nach außen, sei es zur „Welt von heute“, zu den Religionen oder zum Atheismus. Sicher sind die Einzelthemen im Gesamt der Konzilsaussagen zu interpretieren, doch wecken sie unterschiedliches Interesse, sei es bei Kirchenmitgliedern oder bei Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Zudem spielen bei der Interpretation die jeweilige Perspektive und der kontextuelle Standort eine entscheidende Rolle. Wie Frauen und Männer unterschiedliche Sichtweisen einnehmen, so auch Nordamerikaner und Südamerikaner, chinesische und afrikanische Pfarrangehörige, deutsche Bischöfe und ihre brasilianischen Kollegen, spanische und indische Theologen, deutsche Gemeindereferentinnen und ozeanische Katechetinnen. Diese Pluralität der Sichtweisen bringt Perspektiven auf dasselbe Konzil hervor, welche die Kirche als Weltkirche bereichern.
3. Hermeneutische Regeln
Freilich bedürfen das Konzil und seine Dokumente einer Hermeneutik, die sowohl den mehrheitlich verabschiedeten Texten als auch den zeitgenössischen Kontexten gerecht wird. Für eine solche Auslegung haben sich hermeneutische Regeln herausgebildet, wie sie allgemein auch für andere normative Textcorpora gelten, von den biblischen Schriften, über Konzilsentscheidungen bis hin zum Kodex des kanonischen Rechts. Regeln der Konzilsinterpretation hat die außerordentliche Bischofssynode von 1985 in ihrem Schlussdokument4 formuliert, wenn auch nicht in systematischer Form begründet. Solche Kriterien sind für eine vertiefte Rezeption des Konzils von Belang, um zu angemessenen Interpretationen zu gelangen. Die damals entwickelten Kriterien bedürfen der je neuen Anwendung, aber auch der weiteren Entwicklung. So lautet eine erste Auslegungsregel, dass jedes einzelne Dokument in Verbindung mit den anderen gesehen werden müsse, um den „Gesamtsinn“ der untereinander verflochtenen Konzilsaussagen darzustellen; dabei bilden die vier großen Konstitutionen des Konzils (SC, DV, LG, GS) zusammen den Verständnisschlüssel für die anderen Dokumente. Der zweiten Regel zufolge darf man den pastoralen Charakter der Dokumente nicht von ihrer lehrmäßigen Kraft trennen, besteht doch der pastorale Charakter darin, die Lehre auf die jeweilige Gegenwart zu beziehen und dort verstehbar zur Geltung zu bringen. Weiterhin dürfe man, so die dritte Regel, nicht Geist und Buchstabe des Konzils gegeneinander ausspielen; bilden sie doch eine zu bewahrende...