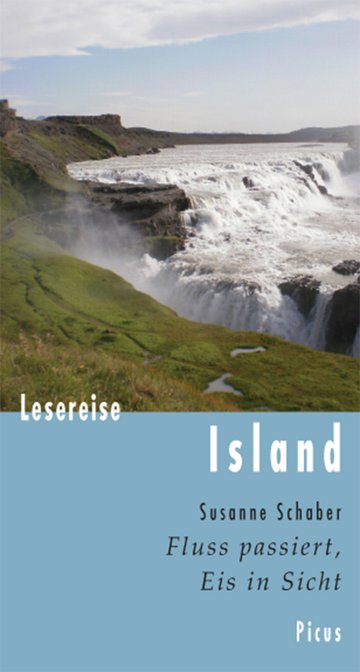Der Eldfell grollt, poltert und pfaucht
Alltag im Schatten der Vulkane: Die Westmännerinseln
Immer wieder der Eldfell. Als ob man an ihm nicht vorbeikäme. Von allen Seiten schiebt er sich ins Bild, ein kratzbürstiger Berg, über und über mit rotbraunen Steinen bedeckt. Mehrere Wege ziehen hinauf zum Gipfelgrat mit seinem Gewirr an scharfkantigen Lavabrocken. Hier oben, an einem der höchsten Punkte der Insel Heimaey, möchte man nicht im Nebel stecken, das könnte gefährlich werden. Und überhaupt: Dem Eldfell ist nicht zu trauen, das weiß man auf den Westmännerinseln. Wenn er zu pfauchen und poltern beginnt, muss man laufen, um sich schnellstens in Sicherheit zu bringen.
»Eigentlich mag ich nicht mehr über den Eldfell sprechen«, meint Helga Hallbergsdóttir. »Und wenn ich es nicht müsste, würde ich es auch nicht mehr tun.« Wenn es nach ihr ginge, würde sie den Eldfell ignorieren und die Erinnerung an die verstörenden Bilder ein für alle Mal wegpacken. Aber der Alltag im Volkskundemuseum von Heimaey will es anders. Zweimal täglich setzt Helga die Volcano-Show in Gang. Die vielfach preisgekrönte Dokumentation mit dem Titel »Days of Destruction« feiert den Eldfell als Vulkan des Grauens. Sein Ausbruch am 23. Jänner 1973 war eine der aufsehenerregendsten Naturkatastrophen, die Island im vergangenen Jahrhundert erlebt hat. Fünf Monate lang versuchten drei-, manchmal auch vierhundert Männer gegen den Lavastrom anzukämpfen und zumindest einen Teil der Insel zu retten. Erlebnisse, an die man nicht gerne zurückdenkt. Wieso also ständig darüber reden? Weil die Touristen kommen, und mit ihnen das Staunen und die Fragen.
Die Westmännerinseln liegen auf einem submarinen Vulkansystem vor der Südküste Islands: fünfzehn Eilande, durch eine Vielzahl von Eruptionen aus dem Meer gehoben. Steile Riffe, felsige Abstürze und schwarze Basalthöhlen bieten Nistplätze für Basstölpel, Sturmschwalben und Tordalken. Ein paar prall grüne Hügel, ab und zu die Hütten von Jägern, die den Papageientauchern nachstellten, ehe sie das Jagdverbot in die Heimlichkeit trieb. Eier und Fleisch gibt es nur mehr unter der Hand.
Heimaey ist die einzige ganzjährig bewohnte Insel des Archipels. Ein Stück Klein-Island: das Flugfeld mitten auf der Weide, das propere Städtchen Vestmannaeyjar mit seinem Hafen, der Fischfabrik, ein paar Hotels, Privatpensionen und Cafés, dem Rathaus, dem Kino, den Kirchen, zwei Museen. Wenn die Fähren anlegen, fluten die Touristen über den Kai, die meisten in festen Schuhen und regendichten Outdoor-Jacken. Zweihundert Meter ist der Eldfell hoch, nicht schwer zu besteigen. Den ganzen Tag über sieht man Wanderer nach oben stapfen. Der Feuerberg, wie der Vulkan in der deutschen Übersetzung heißt, gilt als Hauptattraktion von Heimaey. In den Läden liegen die Bildbände und DVDs, in den Lokalen hängen die Fotos der verwüsteten Insel neben den Vitrinen mit dem Blaubeerkuchen und den Schinkensandwiches. Die Katastrophe bringt Geld. Sie spaltet aber auch die Gemeinschaft.
Auf Heimaey hat man immer schon im Schatten der Vulkane gelebt und sich in deren Launen geschickt. Und so bleibt man entspannt, als Seeleute am Morgen des 14. November 1963 starken Schwefelgeruch wahrnehmen und bemerken, dass das Meer etwas wärmer ist als sonst. Wenig später steigen erste Rauchsäulen auf. Ein brennendes Boot? Die Asche, die nun in den Himmel schießt, alarmiert Geologen und Küstenwache. Kurz darauf steht der Befund: Ein submariner Vulkan ist eruptiert. Schon in der darauffolgenden Nacht sind dreißig Kilometer südlich von Heimaey die Umrisse einer Erhebung zu erkennen. Sie bekommt einen Namen, Surtsey, eine Hommage an den Feuerriesen Surt aus der nordischen Mythologie. Mehr als drei Jahre lang beobachtet man, wie der Vulkan braust und birst und schließlich das zweitgrößte Eiland der Westmännerinseln zurücklässt. Ein fruchtbares Experimentierfeld für Biologen und nur für sie zu betreten. Fortan observieren sie, wie sich auf einem Stück Ödland Leben ansiedelt: Moose und Flechten, der gemeine Regenwurm, hundertdreißig Arten von Fliegen.
Auf Heimaey fühlt man sich auch weiterhin sicher. Der Helgafell ist zuletzt vor gut viertausend Jahren ausgebrochen. Der ist längst gezähmt, glaubt man. Als am 22. Jänner 1973 etliche leichte Beben gemessen werden, blickt man neuerlich in den Süden: Nichts Besonderes, auf Surtsey ist es wieder einmal unruhig, so die Vermutung. Ein paar Stunden später, kurz vor zwei Uhr in der Nacht, ist im Westen Heimaeys ein Donnern zu hören. Eine anderthalb Kilometer lange Feuerspalte tut sich auf und jagt grelle Lichtfontänen in die Dunkelheit. Als die dreizehnjährige Kristín Jóhannsdóttir aus dem Fenster schaut, glaubt sie, dass Bomben einschlagen.
Der Kalte Krieg ist in jener Zeit für viele Isländer eine Bedrohung. Kristín fürchtet sich nicht, sie freut sich auf ein paar schulfreie Tage. Weiter kann sie im Moment nicht planen. Die Sirenen heulen auf, die Nachricht von einem Vulkanausbruch läuft von Mund zu Mund. Kristíns Mutter packt ihre Kinder und hastet zum Hafen. Die Bewohner von Heimaey haben Glück: In jener Nacht liegen alle Boote vor Anker, zuvor war das Meer zu stürmisch, die Fischer haben die Ausfahrten abgebrochen. Binnen drei Stunden hat man mehr als fünftausend Menschen evakuiert und mit Schiffen auf die gegenüberliegende Küste transportiert. Alte und bettlägerige Patienten werden kurzerhand ausgeflogen.
Zurück bleiben jene unerschrockenen Männer, die dem Vulkan die Stirn bieten. Sie beginnen, Wertsachen in Sicherheit zu bringen und sich auf die Verteidigung ihres Hab und Guts vorzubereiten. Schnell schon hat sich ein Krater gebildet, kurz darauf treten giftige Gase aus. Der Wind treibt sie Richtung Hafen, zusammen mit der Asche, die sich auf die Stadt legt. Als dann am fünften Tag größere Mengen an Lava austreten, ist die Verzweiflung groß: Häuser geraten in Brand, die Aschemengen nehmen bedrohliche Ausmaße an. Nun müssen Dächer freigeschaufelt und Fenster und Türen zugenagelt werden, um die Einsturz- und Brandgefahr zu bannen.
Wirklich aufhalten lässt sich das Drama nicht. Immer mehr Lava ergießt sich ins Wasser, die Insel wächst ostwärts ins Meer und gewinnt an Fläche. Das Grollen des Eldfell, wie man den feuerspeienden Berg inzwischen getauft hat, will nicht aufhören. Als dann der französische Vulkanologe Haroun Tazieff eine weitere Eruption im Herzen Heimaeys prophezeit und empfiehlt, die Stadt Vestmannaeyjar schleunigst aufzugeben, werden Stimmen laut, die zur Umsicht mahnen: Wäre es nicht besser, die Hilfskräfte abzuziehen, um keine Todesopfer zu riskieren?
Aber die Menschen von den Westmännerinseln winken ab und arbeiten unbeirrt weiter. Sie seien draufgängerisch, mutig und kühn, hieß es immer schon, aufsässige Eigenbrötler, die sich oft genug absetzen wollten von den politischen Entscheidungen des isländischen Parlaments. Rund um Heimaey erwirtschaften 2,5 Prozent der Bevölkerung elf Prozent der isländischen Exportrate für Fisch. Dafür fühlt man sich zu wenig geschätzt. Frühere Unabhängigkeitsbemühungen sind im Sand verlaufen, der Unmut ist geblieben.
Die Fischgründe vor der Südküste Islands sind seit jeher berühmt. Schon vor der dauerhaften Besiedlung Heimays, so vermutet man, legten Seeleute von den Britischen Inseln in den Buchten an, um dort zu fischen: die Vestmenn, wie man sie nannte, weil sie aus dem Westen heransegelten. Verlässliche Quellen erzählen von zwei irischen Sklaven, die ihren Herrn getötet und sich auf die Westmännerinseln geflüchtet hatten, ehe man sie dort stellte. Heimaey ist seit dem 9. Jahrhundert bewohnt. Kabeljau, Seelachs, Schwärme von Heringen und Lodden machten den Ort zu einem wichtigen Stützpunkt britischer und norddeutscher Handelsgesellschaften. Später führten Piratenüberfälle und die harte Hand der Dänen, die den Fischfang reglementierten, zu seinem Niedergang. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als man mit den neuen Schleppnetzen reiche Beute einfuhr, erholte sich Heimaey. Im Jänner 1973 lebten hier knapp fünftausenddreihundert Menschen, fast alle vom Fisch.
Als der Eldfell zu wüten beginnt, kommen die meisten Flüchtlinge in Reykjavík unter. Auch Kristín und ihre Mutter haben dort Verwandte. »Wir haben uns da nicht sehr wohlgefühlt«, erinnert sie sich. »Angewiesen auf fremde Hilfe, auf Spenden. Das war uns peinlich. Und dazu die Angst, die Heimat zu verlieren.« An eine Rückkehr nach Heimaey ist vorerst nicht zu denken, man stellt sich darauf ein, länger bleiben zu müssen: neue Schule, neue Freunde. Gleichzeitig sorgt man sich um den Vater und alle, die es mit dem Eldfell aufgenommen haben. Bislang ist nur ein Toter zu beklagen, nun hofft man, dass es dabei bleibt. Doch gegen Ende März droht eine weitere Katastrophe: Auf Fernsehbildern beobachten die Isländer, wie der Lavastrom Richtung Hafen vorrückt. Das Szenario, das man nun...