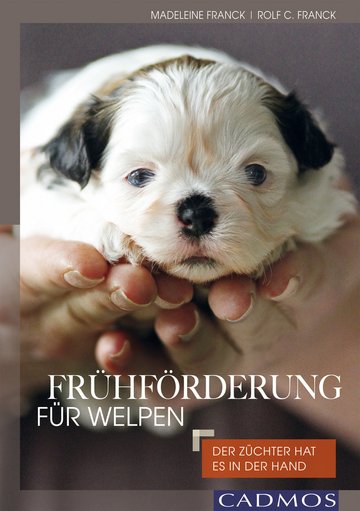WURFPLANUNG
und Trächtigkeit
Gesundheit sollte bei der Zuchtplanung immer Priorität haben – Selektion auf übertriebene Ausprägung bestimmter Merkmale verändert nicht nur das Aussehen einer Rasse, sondern bringt auch neue Gesundheitsrisiken mit sich. Foto: Shutterstock
Verantwortungsvolle Hundezucht ist keine einfache Aufgabe, soviel ist klar. Hat man jedoch den Anspruch, nur mit perfekten Hunden zu züchten, wird man niemals einen Wurf machen. Jede Wurfplanung wird an irgendeiner Stelle Kompromisse verlangen, denn ein Züchter muss einfach zu viele Kriterien unter einen Hut bringen. Gesundheitliche Aspekte wird er dabei leichter im Auge behalten können als optische oder Wesensmerkmale, da Erstere meist durch diverse Gentests und über Generationen erhobene Gesundheitsdaten objektiver messbar sind. Was nützt es, den subjektiv schönsten Hund zu züchten, wenn er gesundheitliche Probleme hat, zum Beispiel nicht richtig atmen kann oder in seinen Bewegungen eingeschränkt ist? Was bringt die Selektion auf die besten Arbeitseigenschaften, wenn die aus einer solchen Verpaarung hervorgehenden Welpen niemals arbeiten können, weil sie kaputte Hüften oder unheilbare Augenkrankheiten haben?
Die oberste Priorität sollte es also immer sein, gesunde Hunde zu züchten. Doch was ist mit dem Rest?
Einschätzung genetischer Anlagen
Wenn es darum gehen soll einen „Traumhund“ zu züchten, was bedeutet dies für die Auswahl der Zuchthunde bezüglich ihrer Persönlichkeitsmerkmale? Wenn wir uns nervenstarke Welpen wünschen, darf man dann nur noch mit besonders ausgeglichenen Rassevertretern züchten?
Die Entwicklung mancher Arbeitsrassen zeigt einen eher traurigen Verlauf: Sie spalten sich immer mehr in Arbeitslinien und
Showlinien, wobei Letztere sich nicht nur optisch vom ursprünglichen Erscheinungsbild der Rasse entfernen, sondern sich bei ihnen auch Veränderungen der rassetypischen Wesensmerkmale beobachten lassen. Es kann nicht das Ziel sein, Soft-Varianten bestimmter Hunderassen zu züchten, nur damit unbedarfte Besitzer besser mit ihnen klarkommen.
Jedoch gerade wenn es um die tendenziell hohe Erregungsbereitschaft vieler Arbeitsrassen geht, lohnt sich ein durchaus differenzierter Blick. Kein Jäger, kein Schäfer, kein Hundesportler kann einen Hund gebrauchen, dem bei Erregung und ausgeprägtem Arbeitseifer die nötige Selbstkontrolle fehlt. Auch der Jäger möchte keinen Hund, der unkontrolliert hetzt und jagt, sondern einen, dessen Verhalten er steuern kann. Es sollte also züchterisch nie darum gehen, die Talente und Stärken einer bestimmten Rasse zu beschneiden, sondern darum, mögliche individuelle Schwächen auszugleichen. Wie viel davon tatsächlich genetisch bedingt ist, werden wir vielleicht nie genau wissen. Eine starke Bindung zum Menschen und die Bereitschaft zur Kooperation erleichtern die Ausbildung eines Arbeitshundes und ermöglichen dem Familienhundebesitzer, im Alltag die Entwicklung unerwünschter Verhaltenstendenzen rechtzeitig ausbremsen zu können. Und so sind es letztendlich doch die gleichen Qualitäten, die einen guten Arbeitshund und einen unkomplizierten Familienhund ausmachen.
Idealerweise hat der Züchter die Gelegenheit, möglichst viele Verwandte des potenziellen Zuchtpaares kennenzulernen. Foto: Shutterstock
Sam Gosling, Psychologieprofessor in Texas, hebt in einem Interview (2009) die Bedeutsamkeit von Persönlichkeitseigenschaften hervor, die nichts mit dem genetischen Potenzial spezieller Arbeitsfähigkeiten eines Hundes zu tun haben. Er sagt, dass er ursprünglich dachte, bei der Auswahl von geeigneten Bombensuchhunden müsse man Hunde mit besonders guter Nase selektieren. Heute weiß er, dass „die meisten Hunde meistens die meisten Bomben finden können“. Ob ein Hund dies jedoch im Einsatz unter Stressbedingungen kann, während um ihn herum eine Menschenmenge evakuiert wird, ein Hubschrauber landet und das Chaos ausbricht, hat rein gar nichts mit Nasenleistung zu tun.
WIE VIEL VERHALTEN WIRD VERERBT?
Die Frage nach der Erblichkeit von Verhaltenstendenzen beschäftigt Wissenschaftler schon seit knapp 150 Jahren. Dabei versucht die verhaltensgenetische und -biologische Forschung zu klären, wie stark Verhalten durch Gene beziehungsweise durch Umweltbedingungen beeinflusst wird.
Selbst wenn wir an dieser Stelle des Buchs unser Augenmerk auf den genetisch bedingten Anteil richten, so ist dabei zu beachten, dass höchst selten ein einzelnes Gen, sondern meist ganze Gruppen von Genen Einfluss auf Verhaltensstrukturen haben. Und ausschlaggebend für dieses Buch ist unsere Überzeugung, dass Umwelt, Erleben und Sozialisation sich fortwährend weiter darauf auswirken, wie aus dem genetische Potenzial eines Hundes seine Persönlichkeit und sein Verhalten entstehen.
Immanuel Birmelin (2014) beschreibt dazu ein Experiment von Norbert Sachser und seinen Mitarbeitern, Universität Münster, bei dem konkret der Einfluss der Sozialisation auf die gezeigte Ängstlichkeit bei genetisch gleichen Mäusen untersucht wurde. Die Forscher teilten ihre Mäusepopulation in zwei Gruppen und ließen eine davon in Standardkäfigen aufwachsen, wie sie in der Laborhaltung üblich sind. Die andere Gruppe bekam Erlebniskäfige mit Klettergerüsten, Spielzeug, Tunneln und so weiter. Bei einem anschließenden Verhaltenstest in einem Hochlabyrinth waren diese Mäuse deutlich mutiger und erkundungsfreudiger als die der ersten Gruppe. Schlussfolgernd kann man also davon ausgehen, dass bei ungefähr gleicher genetischer Anlage des Merkmals Ängstlichkeit die letztendliche Ausprägung stark durch Sozialisationsprozesse beeinflusst wird.
Immer wieder werden von verschiedenen Autoren konkrete Werte für die Erblichkeit bestimmter Verhaltens- beziehungsweise Persönlichkeitsdispositionen genannt. So scheint es, dass besonders die Veranlagung für Ängstlichkeit beziehungsweise Unerschrockenheit, Geselligkeit, Verspieltheit, Aktivität und Aggressivität relativ stabil vererbt wird. Es scheint ebenso ein Zusammenhang zwischen Erregungsbereitschaft und Ängstlichkeit zu bestehen, wogegen die genetische Bereitschaft zur Entwicklung aggressiven Verhaltens nicht mit Ängstlichkeit beziehungsweise Unerschrockenheit in Verbindung zu stehen scheint.
Ein klassisches Vorgehen, um den erblichen Anteil eines einzelnen Verhaltensmerkmals einzuschätzen, sind Selektionsexperimente. So wurde zum Beispiel die Ängstlichkeit von Mäusen in einem Versuchssetting anhand ihrer Fluchtbereitschaft bestimmt. Die besonders ängstlichen und die besonders mutigen Tiere wurden jeweils untereinander gekreuzt, und so wurde über mehrere Generationen hinweg ein ängstlicher und ein mutiger Inzuchtstamm gezüchtet, der sich signifikant von der ursprünglichen Kontrollgruppe unterschied. Selbst nach 30 Generationen selektiver Zucht war ersichtlich, dass die Abweichungen zwischen den beiden Gruppen immer noch weiter verstärkt werden konnten. Dies zeigt deutlich, dass an der Vererbung einer Verhaltenstendenz wie Ängstlichkeit zahlreiche Gene beteiligt sind, und wie schwierig die züchterische Beeinflussung werden wird, wenn gering ausgeprägte Ängstlichkeit nur eines von vielen Kriterien ist, die dem Züchter wichtig sind.
Noch komplexer wird das Thema, wenn man Erkenntnisse zur epigenetischen Vererbung mit einbezieht. Inwieweit beeinflussen Erfahrungen und erlernte Zusammenhänge nicht nur das Verhalten des einzelnen Tieres, sondern auch dessen DNS und lassen sich so weitervererben? Erst 2013 konnten Forscher nachweisen, dass sich klassisch konditionierte Angst bei Mäusen über Generationen vererben lässt. Dazu brachte man die Tiere durch Elektroschocks bei gleichzeitiger Präsentation eines Kirsch-Mandel-Dufts dazu, auf diesen Geruch eine konditionierte Angstreaktion zu entwickeln, die sich in Form von unwillkürlichem Muskelzittern zeigte. Unkonditionierte Mäuse haben keinerlei Grund, ausgerechnet auf diesen Geruch ängstlich zu reagieren, und zeigen demnach keine Reaktion, wenn sie Kirsch-Mandel-Duft riechen. Die Nachkommen der konditionierten Mäuse zitterten jedoch noch in der Enkelgeneration vor dem Geruch, ohne selbst jemals schlechte Erfahrungen damit gemacht zu haben.
Wie funktioniert epigenetische Vererbung? Noch sind längst nicht alle Wege bekannt, aber vereinfacht kann man sagen, dass Lernerfahrungen Spuren im Erbgut hinterlassen, indem sich Eiweiße an der Oberfläche der DNS anlagern. Die genetische Information wird dabei nicht verändert, aber erst diese Umwandlungsprozesse steuern, welche Bereiche der DNS ein- oder ausgeschaltet werden. Heute geht die Forschung also eher weg von der ursprünglichen Frage: „Anlage oder Umwelt?“. Vielmehr wird die Frage danach gestellt, wie Gene und Umwelt wechselseitig aufeinander wirken. Optimal wäre es sicherlich, wenn wir als Züchter nicht nur das Nervenkostüm eines einzelnen Welpen, sondern am besten gleich das der ganzen Zuchtlinie positiv beeinflussen könnten.
Auch Schwächen, die durch ungünstige Umstände entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.
Da bereits vorgeburtliche Einflüsse eine Rolle für den späteren Umgang mit Stress spielen, sollte das emotionale Wohlbefinden der trächtigen Hündin...