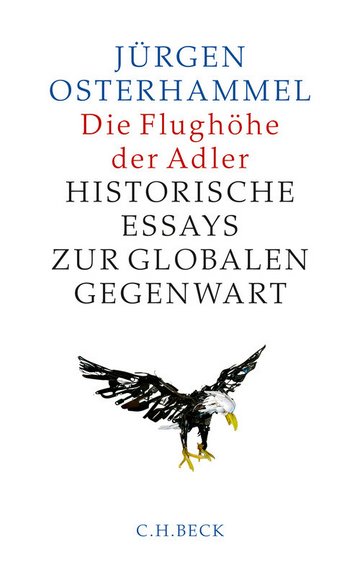Globalisierungen
Jeder redet von «der Globalisierung» und setzt stillschweigend voraus, es sei klar, was darunter zu verstehen ist. Eine unrealistische Annahme. In diesem Aufsatz wird keine weitere Definition angeboten. Es wird nur der keineswegs revolutionäre Vorschlag gemacht, das Wort «Globalisierung» ab und zu im Plural zu verwenden. Ein nicht ganz neuer Vorschlag, denn seit 2004 erscheint eine Zeitschrift mit dem Namen Globalizations. Kurz zuvor hatten Buchautoren begonnen, die Mehrzahl zu benutzen. Das deutsche «Globalisierungen» taucht seit der letzten Jahrhundertwende in einzelnen Buchtiteln auf, ohne sich bis heute breit durchgesetzt zu haben.[1] Was auf den ersten Blick nach stilistischer Eigenwilligkeit aus der postmodernen Wörterküche aussieht, macht indes einen großen Unterschied aus. Das Pluralsuffix «-s» oder «-en» verwandelt den einen umfassenden Weltprozess, der die gesamte Menschheit einschließt, in eine Vielzahl ähnlicher, aber unterschiedlicher Teilprozesse, die nach Ort und Zeit, nach Intensität und Reichweite differenziert werden können. Aus einer geschichtsmetaphysischen wird eine empirische Kategorie. Neben die «Vielzahl der Modernen» (multiple modernities) treten nun multiple globalizations, allerdings potenziell zahlreicher als die «Modernen», von denen es neben der klassischen westeuropäischen Variante nur eine kleine Zahl anderer Grundmodelle gibt.[2]
Durch den Plural wird der Begriff politisch entschärft: man muss sich nicht für oder gegen «die Globalisierung» bekennen. Dennoch wird er nicht werturteilsfrei neutralisiert. Es ist möglich, die Globalisierung des Drogenhandels abzulehnen und zugleich diejenige von gay rights zu begrüßen. Der Plural nimmt die Last des Totalen von unseren Schultern. Denn auch wenn die Soziologie heute oft von pluraler, mehrschichtiger oder multiskalarer Globalisierung spricht, sind dies nur genauere Bestimmungen des weiter dominanten Singulars. Der Plural macht vor allem uns Historikern das Leben leichter, die wir auch dann gewerbsmäßige Detailtüftler und Generalisierungsskeptiker bleiben, wenn wir großen Fragen nicht ausweichen. Die singulare (und singuläre) Megaglobalisierung hält sich weiterhin als Idee im Hintergrund, denn wer wollte ausschließen, dass sich in den Augen besonders synthesefähiger Betrachter die einzelnen Teilprozesse am Ende doch zum Puzzle eines großen Ganzen fügen? Doch der Plural «Globalisierungen» mildert einen Holismusdruck, unter den sich die zeitdiagnostische Diskussion ohne Not gesetzt hat.
Um diesen Aufsatz nicht in Predigt oder Plädoyer abdriften zu lassen, hole ich zunächst etwas weiter aus.[3] Wer sich mit mehr als einem Kontinent beschäftigt, wer als Europäer auch andere als europäische Sichtweisen und Erfahrungen zu ihrem Recht kommen lässt (also einen niemals ganz ausschaltbaren kognitiven Eurozentrismus einzudämmen bemüht ist), wer die Beziehungen zwischen jeweils Eigenem und Fremdem als hochgradig variabel betrachtet, wer die heutigen Überlebensprobleme der Menschheit als einen Horizont auch historischen Problematisierens ernst nimmt, wer also – kurz gesagt – eine professionelle Identität (und möglicherweise auch eine moralische Haltung) als «Globalhistoriker» entwickelt hat und kritisch zu stabilisieren sucht,[4] der kommt um die Frage des Verhältnisses zwischen Globalgeschichte und «Globalisierung» nicht herum. Diese Frage ist nicht bloß eine solche der Methode und damit der Wahl zwischen klar beschreibbaren Alternativen wissenschaftlichen Vorgehens. Sie ist komplizierter und damit vielleicht interessanter. Deshalb setze ich ziemlich grundsätzlich an.
Der Aufschwung von Weltgeschichte und ihre rasche Metamorphose zu Globalgeschichte gegen Ende des 20. Jahrhunderts waren eng mit einem neuen Rahmenkonzept der Sozialwissenschaften verbunden, dem der Globalisierung. Historiker und Sozialwissenschaftler reagierten auf dieselbe Generationserfahrung: den Eindruck, den Hunderte von Millionen Menschen in allen Weltregionen teilten, dass die Verflochtenheit des sozialen Lebens auf dem Planeten und die Beeinflussung der eigenen Lebenswelt durch Kräfte aus der Ferne ein neues Niveau der Intensität erreicht hätten. Die Welt schien in den 1990er Jahren ein «kleinerer» Ort zu sein als noch ein Vierteljahrhundert zuvor: das sprichwörtliche globale Dorf, in dem prinzipiell alle mit allen anderen kommunizieren können, oder auch die eine über die Kontinente verteilte Mega-City, wo sich urbane Kosmopoliten mit minimaler Akklimatisierung überall zurechtfinden: der Hilton-Effekt.
Aus diesem Befund zog man in den unterschiedlichen akademischen Disziplinen jeweils besondere Schlüsse. Die Vergangenheit war dabei nicht unbedingt von Interesse. Die frühen Theoretiker der Globalisierung in Soziologie, Politikwissenschaft und Ökonomie, die ihre wirkungsmächtigen Werke in den 1990er Jahren schrieben, verschmähten eine historische Perspektive. Das neue Konzept schien ideal geeignet zu sein, um charakteristische Merkmale der Gegenwartsgesellschaft auf den Punkt zu bringen, an erster Stelle die Erfahrung dynamischer Entgrenzung. Bald kam der Gedanke auf, «Globalisierung» sei eine Epochenbezeichnung: auf die «Moderne» folge endlich etwas Neues, das mehr sei als bloß deren Steigerungsform und auch nicht allein eine spätreif-kritische «Postmoderne»: Die Menschheit lebe nun «in der Globalisierung».
Historiker schienen zwar vorübergehend nicht mehr gebraucht zu werden, manche unter ihnen hielten aber den Kontakt zu den präsentistisch gestimmten Sozialwissenschaften aufrecht. Eine frühere Begegnung zwischen Weltgeschichte und einer historisch offenen Soziologie hatte bereits in den 1970er und 1980er Jahren unter den Auspizien der «Weltsystemtheorie» stattgefunden, deren Schöpfer, der US-amerikanische Afrikaspezialist und Entwicklungstheoretiker Immanuel Wallerstein, damals zu den berühmtesten Sozialwissenschaftlern der Welt gehörte. Durch seinen Dialog mit dem großen französischen Historiker Fernand Braudel erhielt er auch höhere historiographische Weihen.[5] Da Wallersteins Theorie jedoch recht schematisch gehalten und mit einer eigentümlichen Terminologie verbunden war, übernahmen sie nur wenige Historiker in der von Wallerstein und seinen Mistreitern verfochtenen orthodoxen Form.
Über «Globalisierung» zu reden verlangte kein solches theoretisches Glaubensbekenntnis und ließ mehr Spielraum für Individualität und Kreativität. Die Magie dieses Wortes lag darin, dass es früh auch einen außerwissenschaftlichen appeal gewann und in die Sprachen des Alltags und der Medien eindrang. «Globalisierung» war ein Geschenk für Welthistoriker, die es als winzige Minderheit innerhalb des Faches Geschichte zuvor schon gegeben hatte, die man aber als dilettantische und versponnene Sinn-Sucher und Quasi-Theologen abzutun geneigt war. Das Konzept erlaubte ihnen den Anschluss an ein neu entstehendes zentrales Debattenfeld der hoch respektierten Sozialwissenschaften. Es lieferte einem Fach, das stets von der Gefahr deskriptiver Vereinfachung und simpler Chronistik der Ereignisse bedroht war, eine neue Terminologie. Und es schuf die Voraussetzungen für die Entwicklung einer zeitgemäßen Variante der arg verstaubten Weltgeschichte (noch oftmals verstanden als «die Geschichte aller großen Völker und Kulturen» usw.) – eben global history. Freilich: diese story klingt zu schön, um wahr zu sein. In Wirklichkeit kühlte die Begeisterung vieler Historiker rasch ab. Statt ein neues Werkzeugbesteck blitzblank geliefert zu bekommen, sahen sie sich den Herausforderungen einer immer komplizierter und scholastischer werdenden Globalisierungstheorie ausgesetzt. Mit der Zeit verstanden sie auch, dass Globalgeschichte nicht eine direkte Projektion einer Globalisierungsperspektive auf die Vergangenheit sein könne. Sie verlangt ihre eigenen intellektuellen Grundlagen.
Ein sozialwissenschaftliches Konzept für Historiker
...