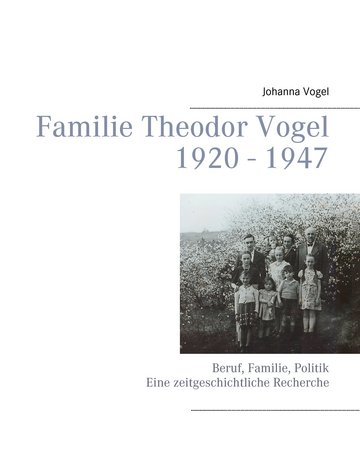Beruf und Familie während des Dritten Reiches
Eine Vorbemerkung:
Etwas süffisant referierte 1963 der Autor des Spiegel-Artikels über die „Freimaurer“, dass Dr. Theodor Vogel, der Großmeister der Vereinigten Großloge von Deutschland, die Nazizeit mit „blütenweißem politischem Schurz“ überstanden habe26. Diese Anspielung auf ein zentrales Kleidungsstück des freimaurerischen Rituals belegt deutlich, wie wenig glaubwürdig dem „Spiegel“ die Tatsache gewesen sein muss, dass Theodor Vogel aus der Nazizeit unbelastet herausgekommen war, obwohl damals sogar „Schnellzüge auf offener Strecke extra für ihn angehalten“ hätten. Woher wusste der Spiegel das? Gerüchte? Eigene Recherchen? Und wenn es so gewesen war, wie reimt sich das mit der Tatsache zusammen, dass Theodor Vogel in der frühen Nachkriegszeit als Freimaurer eine so herausragende Rolle spielen konnte?
Bekannt ist, dass die Freimaurerei im Dritten Reich ab 1935 nicht nur verboten worden war, sondern dass zahlreiche Freimaurer auch offen verfolgt worden sind. Da Theodor Vogel schon 1926 der Loge beigetreten war und bereits 1930 sogar zum „Meister“! aufgestiegen war, hätte er also eigentlich im Dritten Reich nicht reüssieren können sollen. Es ist nicht meine Aufgabe, diesem ungeklärten Aspekt freimaurerischer Geschichte nachzuforschen und zur Aufklärung eines offenkundigen Widerspruchs in der Biografie meines Vaters beizutragen, umso weniger, als ich der Freimaurerei ohnedies eher skeptischdistanziert gegenüber stehe. Ich lasse diese Diskrepanz also auf sich beruhen. Es genügt mir, zu wissen, Dass mein Vater, abgesehen vom Vorläuferclub des ADAC und von der NSV, der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, keiner nationalsozialistischen Organisation angehört hat.27 Aber wenn man bedenkt, dass er nicht nur unsere große Familie wohlbehalten durch das Dritte Reich gebracht hatte, sondern nachweislich auch mit kriegswichtigen Aufträgen ordentliches Geld verdient hatte, war dann diese weiße Weste wirklich glaubhaft? Fragen, die sich nicht einfach beiseite schieben lassen. Also mache ich mich an die Arbeit.
Die Aktenlage zu diesen und anderen Fragen im Zusammenhang mit seiner Rolle im Dritten Reich ist dünn. Vieles fiel dem Bombenkrieg anheim, sein Schweinfurter Büro z. B. wurde bei einem Fliegerangriff 1944 völlig zerstört. Anderes wurde bei Kriegsende auch wohl absichtlich vernichtet. Dies jedenfalls behauptet meine Schwester Barbara. Ihn selbst kann man nicht mehr befragen. Die Nachkommen können wenig Zweckdienliches dazu beitragen. Was bei seinen Kindern in Erinnerung geblieben ist, sind die Namen seiner verschiedenen Reiseziele und wenige im Gedächtnis haftende Informationen über den Zweck seiner Reisen. In Saarbrücken und anderswo war er zum Beispiel häufig unterwegs, um „Stollen“ zu bauen, Bauwerke, unter denen ein Kind wie ich sich eher ein abgerundetes, einem Brotlaib ähnliches Gebäude vorstellte als Bergwerksstollen. Dass es wichtig war, was er tat, dass Er wichtig war, ließ sich an vielen Indizien ablesen: ein eigenes Telefon mit der Nummer eins, ein eigenes Auto, im Krieg eine absolute Seltenheit, Besprechungen mit fremden Gesprächspartnern in seinem Arbeitszimmer, dem „Herrenzimmer“, wie dieser große, mit Büchern und Akten voll gestellte Raum immer genannt wurde. Und jeden Tag Post, viel, viel Post. Gerüchte über ihn, die im Dorf in Umlauf waren, und eine gewisse Distanz der Dörfler unserer Familie gegenüber, untermauerten diese Ahnung seiner Bedeutung.
Man muss sich seine Ausgangslage nach der Entlassung aus der Firma des Vaters einmal vor Augen stellen. Seine ersten Berufsjahre im freien Ingenieurberuf, also sein Einstieg ins eigentliche Berufsleben, fielen zeitlich zusammen mit dem Beginn des NS-Regimes, mit der Machtergreifung. Auch wenn mein Vater sicher kein Revolutionär gewesen ist und sich für Politik vermutlich nur am Rande interessiert hat, so hat er doch ebenso sicher den Aufstieg dieser Partei, die ja nicht unbekannt gewesen war, nur mit Unbehagen verfolgt. Was damals nach deren Triumph in Kopf und Herzen von Menschen vorgegangen sein mag, die diese Partei und ihren Führer aus tiefsten Herzen verabscheuten, ist ebenso Spekulation wie die Frage nach den Alternativen. Fakt war, der Nationalsozialismus hatte obsiegt. Man musste sich bis auf weiteres mit den neuen Gegebenheiten arrangieren. Noch lag das kommende Desaster im Dunkel, war es vorstellbar, dass diese „Bewegung“ bald wieder Vergangenheit sein würde. Was meine Eltern dazu damals gedacht haben, ist nicht überliefert. Sie hatten, so darf man vermuten, in jener Zeit vor allem mit sich selbst zu tun und mit der Versorgung und Sicherung ihrer wachsenden Kinderschar unter den vorläufig eher widrigen Umständen einer faktischen Arbeitslosigkeit und einer ungesicherten beruflichen Zukunftsperspektive des Ernährers.
Das Krisenjahr 1933, auch in Familie und Beruf
An dieser Stelle muss ich näher auf die familiäre Situation im Jahre 1933 eingehen. Am 28. September 1933 wurde das vierte Kind meiner Eltern geboren, ich, Johanna Gudrun Vogel. Während meine Mutter alle anderen Kinder zuhause entbunden hat, ging sie für meine Geburt in eine Privatklinik und verwehrte meinem Vater, sie bei der Entbindung zu begleiten. Es gab eine veritable, offenbar schon länger andauernde Ehekrise, deren genaue Gründe im Dunkeln liegen. In einem sehr persönlichen seitenlangen Brief an Else28 vom 30. September 1933 setzte sich Petrus mit den entstandenen Eheproblemen auseinander und bemühte sich, sein eigenes Fehlverhalten, das er nicht leugnen wollte, zu erklären. Die Situation war bedrohlich ernst, die Ehe in Gefahr. „Ich habe Angst, Dich zu verlieren“, so sein Resümee an einer Stelle. Er deutet sogar Suicidgedanken an. Die Krise muss tatsächlich äußerst ernst gewesen sein; denn der Konflikt anlässlich meiner Geburt hat sich nachhaltig auch auf meine Stellung in der Familie ausgewirkt.
Um welche Klinik es sich dabei gehandelt haben könnte, ist nicht überliefert. Jener Brief meines Vaters, in dem er mehrfach recht ominös von „diesem Haus“ spricht, das zu betreten er sich scheut, lässt mich aus dem Kontext heraus eher an so etwas wie ein „Frauenhaus“ denken, also eine Einrichtung, zu der in Bedrängnis geratene Frauen gehen können z. B. zu einer Entbindung o. ä. Durch reinen Zufall kam ich dahinter, dass es in Schweinfurt zu Beginn des 20. Jhdts. etwas dergleichen gegeben haben muss. Eine Hebamme namens Anna Rauscher betrieb nahe dem Zentrum der Stadt am Schillerplatz 5 im oberen Stockwerk eines großen Hauses eine Wöchnerinnenstation für in Not geratene Frauen29. Auch wenn jene Hebamme 1933 nicht mehr praktizierte, ist es doch durchaus denkbar, dass diese Entbindungsstation weiter geführt wurde, da es Bedarf dafür ja auch später immer gegeben haben wird. Dieses Haus lag unweit der damaligen Wohnung der Eltern. Es ist also nahe liegend anzunehmen, dass meine Mutter dort entbunden hat. Andeutungen in dem langen Brief von Petrus legen die Vermutung nahe, dass sie auch ihre beiden kleinen Töchter Bärbel und Ursel in dieses Haus mitgenommen hat, so Dass sich Petrus jetzt allein um „Wölfle“, den Ältesten kümmern musste, der weint und unruhig ist, also die Mutter vermisst..
Ich habe diesen mir überlieferten Aspekt unserer Familiengeschichte schon vor längerer Zeit einmal als Einstieg in unsere Familienbiografie formuliert, Beispiel einer wirkmächtigen Legendenbildung, die ich im Folgenden als Exkurs dokumentiere.
Exkurs: „Schon wieder ein Mädchen!
Am 28. September 1933 wurde ich, Johanna Gudrun Vogel, als viertes von neun Kindern des Dr. Ing. Theodor Vogel und seiner Ehefrau Else Anna, geb. Raasch, in Schweinfurt geboren. Gleichzeitig wurde ich damit das dritte von sechs Töchtern in Folge, was damals allerdings noch keiner wissen konnte. Trotzdem tobte mein Vater „schon wieder ein Mädchen!“, als er von meiner so nicht geplanten Ankunft – und das am helllichten Tag bei strahlendem Sonnenschein – erfuhr, stampfte mit den Füßen auf und verweigerte meiner Mutter, die mich im Schweinfurter Krankenhaus entbunden hatte, den Gratulationsbesuch am Wochenbett.
Tante Philine, eine Freundin meiner Eltern, erzählte mir diese Geschichte, als ich so etwa 14 Jahre alt war. Sie meinte, ich müsse das wissen. Fortan wusste ich es also.
Es hat die Beziehung zu meinem Vater, den wir alle liebten und bewunderten, nicht weiter getrübt. Eher schon erklärt es mir eine gewisse Distanz, die ich als Kind für meine Mutter manchmal empfand, obwohl sie es mir gegenüber an nichts fehlen ließ. Im Gegenteil. Ist sie wirklich meine Mutter? so fragte ich mich manchmal insgeheim, wobei ich es nicht für ausgeschlossen hielt, dass mich mein Vater ihr heimlich untergeschoben hatte. Es erklärt vielleicht auch dieses Gefühl der Unzugehörigkeit, das mich im Kreise meiner Geschwister als Kind oft beschlich. Manche Fotos aus früherer Zeit verraten diese Distanz.
Aber Distanz ist vielleicht nicht der schlechteste Ratgeber, wenn es darum geht, die Geschichte einer Familie zu rekonstruieren, in der aufgewachsen zu sein, ich bis heute als ein Privileg betrachte. Dass diese...