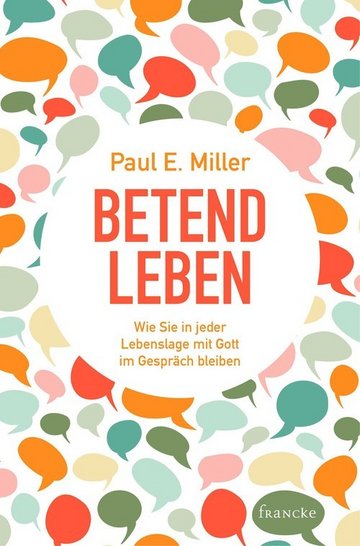1. „Wofür soll es denn gut sein?“
Ich fuhr mit fünf von unseren sechs Kindern für ein Wochenende zum Campen in die Berge von Pennsylvania. Meine Frau Jill blieb mit unserer acht Jahre alten Tochter Kim zu Hause. Nach einer katastrophalen Campingerfahrung im Sommer davor war Jill ganz froh, dass sie daheimbleiben konnte. Sie meinte, sie könne ja in der Fastenzeit auf das Campen verzichten.
Als ich vom Campingplatz zu unserem Auto ging, sah ich meine vierzehnjährige Tochter Ashley vor dem Van stehen; sie sah besorgt und aufgewühlt aus. Als ich sie fragte, was los sei, antwortete sie: „Ich habe meine Kontaktlinse verloren. Sie ist weg.“ Ich schaute mit ihr gemeinsam auf den Waldboden, der mit Laub und Zweigen bedeckt war. Es gab eine Million kleiner Ritzen, in die die Linse hineinfallen und verschwinden konnte.
„Ashley, beweg dich nicht“, sagte ich, „lass uns beten.“ Doch bevor ich mit dem Gebet beginnen konnte, brach sie in Tränen aus. „Wofür soll es denn gut sein? Ich habe für Kim gebetet, dass sie sprechen lernt, aber sie spricht nicht.“
Kim leidet unter Autismus und ist entwicklungsverzögert. Aufgrund ihrer schwach ausgeprägten Feinmotorik und Problemen mit der motorischen Abstimmung ist sie außerdem stumm. Nachdem sie fünf Jahre lang zur Sprachtherapie gegangen war, verließ sie eines Tages die Praxis des Therapeuten weinend vor Frustration. „Damit ist jetzt Schluss“, sagte Jill, und wir beendeten die Therapie.
Das Gebet war für Ashley mehr als nur eine leere Formel. Sie hatte Gott beim Wort genommen und ihn darum gebeten, dass Kim das Sprechen lernt. Doch nichts geschah. Kims Stummheit war das Zeugnis für einen schweigenden Gott. Das Gebet, so schien es, wirkte nicht.
Kaum jemand hat den Mut so wie Ashley, diese stille Skepsis und die geistliche Ermüdung zu äußern, die in uns entstehen, wenn ein von Herzen kommendes Gebet nicht erhört wird. Wir verstecken unsere Zweifel sogar vor uns selbst, weil wir nicht wie schlechte Christen klingen wollen. Warum sollten wir uns mit unseren Zweifeln auch noch blamieren? Also verschließen wir unser Herz.
Die leichtfertige Art, wie manche Leute über das Beten sprechen, verstärkt unsere Skepsis häufig noch. Wir beenden ein Gespräch mit den Worten: „Ich nehme dich in mein Gebet hinein.“ Wir besitzen ein ganzes Fachvokabular des Gebets, wie zum Beispiel „Ich bringe dich im Gebet vor Gott“ oder „Ich denke an dich im Gebet“. Viele, die solche Phrasen verwenden, beten am Ende doch nicht, und zu diesen Leuten gehören wir auch. Warum? Weil wir nicht davon überzeugt sind, dass Beten tatsächlich hilft.
Zweifel und Leichtfertigkeit sind aber nur ein Teil des Pro-blems. Die frustrierendste Erfahrung ist das Beten selbst. Wir halten ungefähr fünfzehn Sekunden durch und dann taucht aus dem Nichts die To-do-Liste des Tages vor unserem geistigen Auge auf, und wir geraten auf Nebengleise. Wir ertappen uns dabei und zwingen uns, wieder zum Gebet zurückzukehren. Doch bevor wir uns dessen bewusst sind, passiert es wieder. Statt zu beten, schweifen wir mit unseren Gedanken ab und machen uns Sorgen. Dann tauchen die Schuldgefühle auf. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Andere Christen haben nicht solche Schwierigkeiten beim Beten. Nach fünf Minuten geben wir auf und sagen: „Ich kann das einfach nicht. Ich kann genauso gut auch an die Arbeit gehen.“
Tatsächlich stimmt bei uns etwas nicht. Unser natürliches Bedürfnis zu beten kommt von der Schöpfung her. Wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Unsere Unfähigkeit zu beten kommt vom Sündenfall. Das Böse hat dieses Bild verzerrt. Wir wollen mit Gott sprechen, aber wir können es nicht. Unser Wunsch zu beten wird durch unsere schwer beschädigte Gebetsantenne behindert, und das führt zu einem ständigen Frust. Es ist, als hätten wir einen Schlaganfall erlitten.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass wir gar nicht so genau wissen, was eigentlich ein gutes Gebet ausmacht. Wir haben das vage Gefühl, dass wir uns am Anfang auf Gott konzentrieren sollten und nicht auf uns selbst. Also versuchen wir, unser Gebet mit der Anbetung Gottes zu beginnen. Das geht ungefähr eine Minute lang gut, aber es fühlt sich erzwungen an. Dann setzen die Schuldgefühle wieder ein. Wir fragen uns: Habe ich Gott genug angebetet? Habe ich es wirklich ehrlich gemeint?
In einem Anflug von spiritueller Begeisterung stellen wir eine Liste mit Gebetsanliegen auf, aber die Liste herunterzubeten wird eintönig, und es scheint sich nichts zu tun. Die Liste wird lang und beschwerlich; wir verlieren viele Anliegen aus dem Blick. Das Gebet scheint nichts als vergebliche Liebesmühe zu sein. Wenn jemand geheilt wird oder Hilfe erfährt, fragen wir uns, ob das nicht vielleicht sowieso passiert wäre. Und dann verlieren wir die Liste komplett aus dem Auge.
Das Gebet bringt ans Licht, wie selbstzentriert wir sind, und es legt unsere Zweifel offen. Für unseren Glauben war es leichter, nicht zu beten. Schon nach wenigen Minuten ist unser Gebet ein Chaos. Kaum sind wir über die Startlinie hinaus, brechen wir auch schon auf dem Seitenstreifen zusammen – zweifelnd, voller Schuldgefühle und hoffnungslos.
Der schwierigste Gebetsort auf der ganzen Welt
Die Länder der westlichen Kultur sind für das Gebet wahrscheinlich der schwierigste Ort auf der Welt. Wir sind so beschäftigt, dass es uns unangenehm ist, wenn wir unser Tempo verringern, um zu beten. Leistung wird bei uns hoch geschätzt. Das Gebet aber ist nichts anderes als ein Gespräch mit Gott. Es fühlt sich nutzlos an, so als ob wir unsere Zeit vergeuden. Alles in uns schreit: „Geh an die Arbeit!“
Wenn wir nicht arbeiten, sind wir es gewohnt, unterhalten zu werden. Fernsehen, Internet, Videospiele und Handys füllen unsere Zeit genauso aus wie unsere Arbeit. Wenn wir kürzertreten, sind wir wie benommen. Erschöpft vom raschen Tempo des Lebens, vegetieren wir vor einem Bildschirm oder mit zugestöpselten Ohren dahin.
Wenn wir versuchen, still zu sein, werden wir von dem attackiert, was C. S. Lewis „das Königreich des Lärmes“ nannte.1 Egal wohin wir gehen, überall hören wir Hintergrundgeräusche. Und wenn wir den Lärm nicht geliefert bekommen, dann bringen wir ihn selbst auf unserem iPod mit.
Sogar unsere Gottesdienste sind von dieser rastlosen Energie gekennzeichnet. Der Stille vor Gott wird wenig Raum gegeben. Wir wollen etwas vom Gottesdienst haben, und darum muss immer etwas los sein. Die Stille ist uns unangenehm.
Ein äußerst raffiniertes Hindernis für das Gebet ist wahrscheinlich auch das am weitesten verbreitete. In unserer Kultur und auch in unseren Gemeinden schätzen wir Intelligenz, Kompetenz und Wohlstand. Weil wir im Alltag auch ohne Gott ganz gut zurechtkommen, erscheint uns das Gebet zwar ganz nett, aber unnötig. Schließlich können wir mit Geld das erreichen, was das Gebet bewirken soll, und das geht schneller und kostet weniger Zeit. Unser Vertrauen auf uns selbst und unsere Talente machen uns von Gott strukturell unabhängig. Folglich laufen Aufrufe zum Gebet bei uns ins Leere.
Der merkwürdige Charakter des Gebets
Noch schwieriger wird es, wenn wir darüber nachdenken, wie seltsam Beten eigentlich ist. Wenn wir telefonieren, dann hören wir eine Stimme und können antworten. Wenn wir beten, sprechen wir in die Luft. Nur verrückte Leute reden mit sich selbst. Wie reden wir mit einem geistigen Wesen, mit jemandem, der nicht mit hörbarer Stimme spricht?
Und wenn wir glauben, dass Gott mit uns durch das Gebet spricht, wie können wir seine Gedanken dann von unseren unterscheiden? Das Gebet ist nicht einfach zu begreifen. Wir ahnen zwar, dass der Heilige Geist irgendwie daran beteiligt ist, aber wir wissen nie genau, ob und wann beim Gebet ein Geist auftaucht und was das überhaupt bedeutet. Manche Leute scheinen viel vom Heiligen Geist zu haben. Wir nicht.
Richten wir unser Augenmerk einmal weg von Gott und auf uns selbst: Wo kommen wir in dem Ganzen vor? Können wir um alles bitten, was wir wollen? Und welchen Sinn macht das Beten überhaupt, wenn Gott schon im Voraus weiß, was wir brauchen? Warum sollen wir ihn langweilen? Es ist, als würden wir ihm auf die Nerven gehen. Wenn wir so über das Gebet nachdenken, dann wird die Sache immer komplizierter.
Ist das auch Ihre Erfahrung? Wenn ja, dann sind Sie damit ganz und gar nicht allein. Die meisten Christen sind frustriert, wenn es ums Beten geht!
Ein Besuch beim Gebetstherapeuten
Stellen wir uns einmal vor, wir gehen zu einem Gebetstherapeuten, um unser Gebetsleben in Ordnung zu bringen. Der Therapeut sagt: „Beginnen wir damit, uns Ihre Beziehung zu Ihrem himmlischen Vater anzusehen. Gott sagt: ‚Ich werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein‘ (2. Korinther 6,18). Was bedeutet es, dass Sie ein Sohn oder eine Tochter Gottes sind?“
Sie antworten, es bedeute, dass Sie freien Zugang zu Ihrem himmlischen Vater durch Jesus haben. Sie haben eine innige Gemeinschaft mit ihm, die nicht darauf basiert, dass Sie ein guter Mensch sind, sondern auf der Güte von Jesus. Doch nicht nur das. Jesus ist auch Ihr Bruder. Sie sind gemeinsam mit ihm ein Erbe.
Der Therapeut lächelt und sagt: „Das stimmt. Sie haben die Lehre der Gotteskindschaft sehr zutreffend beschrieben. Nun erzählen Sie mir mal, was es für Sie persönlich bedeutet, dass Sie mit Ihrem himmlischen Vater zusammen sind. Wie ist es, wenn Sie mit ihm...