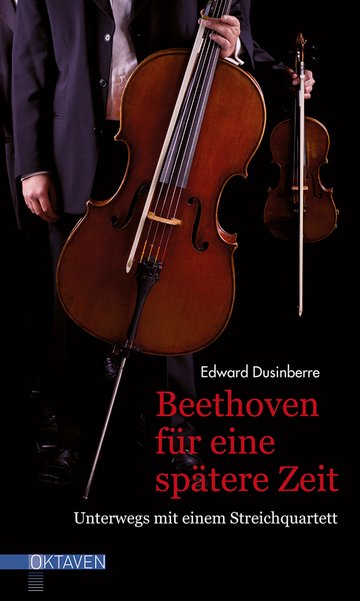PROLOG
OPUS 131
Kaum habe ich meine ersten Töne von Beethovens spätem Streichquartett gespielt, hustet ein Mann in der ersten Reihe der Wigmore Hall in London; das verheißt nichts Gutes. Ein Lehrer sagte mir einmal, Husten im Auditorium während eines Konzertes komme immer von einer langweiligen Interpretation. Wenn das zutrifft, hat sich diese Feststellung jetzt schon bewahrheitet. Ich frage mich, warum der Mann nicht aufsteht und geht. Vielleicht weiß er, dass es zwischen den sieben Sätzen von Opus 131 keine Pause gibt – wenn er hinausginge, würden ihn die Platzanweiser möglicherweise nicht mehr einlassen. Ich hoffe also, dass Langeweile und Gleichgültigkeit bald verfliegen werden.
Die Eröffnungsphrase von Opus 131 sollte nicht allzu schwierig sein. Als Erster Geiger des Takács-Quartetts spiele ich Beethovens vierzehntes Streichquartett1 nunmehr seit fast zwanzig Jahren.
Die ersten zwölf Töne spiele ich allein:
Der Rhythmus ist unkompliziert, das Tempo angenehm langsam, aber selbst der am einfachsten scheinende Melodiebogen ist eine Herausforderung; es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ihn zu spielen. Von meinen lieben Quartettkollegen habe ich während der vergangenen zwanzig Jahre zahlreiche Vorschläge bekommen. Wie vor allem sollte das Sforzando (im Beispiel auf S. 11 mit sf markiert) umgesetzt werden? Heißt die Anweisung, dass eine bestimmte Note mit Nachdruck gespielt oder dass sie scharf akzentuiert werden soll?
«Das klingt zu aggressiv. Könntest du es mit mehr Ausdruck versuchen?»
«Jetzt hört es sich zu leichtfertig an. Es ist nicht empfindsam genug.»
Und was für ein Tempo wähle ich?
«Wenn es zu langsam ist, fehlt ein wenig die Linienführung. Es ist ja erst der Anfang einer langen Geschichte.»
«Aber nicht so fließend, dass es lässig scheint.»
Oder wie gestalte ich die Dynamik und die Klangfarbe?
«Versuche ein bisschen leiser zu spielen: Es ist ein innerer, kein ausdrücklicher Kummer.»
«Nicht zaghaft – und auch nicht so, dass es dünn klingt.»
Bei Beethoven kann eine Melodie oder eine Phrase scheinbar widersprüchliche musikalische Anforderungen stellen. Dramatisch und doch dezent. Langsam, aber mit einer gewissen Zielgerichtetheit. Ein persönlicher Schmerz, der in einem Saal vor fünfhundert Menschen ausgedrückt wird. Kein Wunder, dass diese Eingangsmelodie zu Diskussionen führt: Meine Entscheidung wirkt sich auf die Möglichkeiten aus, die meine Kollegen haben, wenn sie mit der gleichen Phrase an der Reihe sind.
Einer nach dem anderen schließt sich mir an: der Zweite Geiger, Károly Schranz («Karcsi»), der eines der beiden ursprünglichen Mitglieder des Quartetts ist; Geraldine Walther, seit zehn Jahren unsere Bratschistin; und schließlich András Fejér, der Cellist des Quartetts seit seiner Gründung 1975 in Budapest. Wenn es nicht eine gewisse Übereinstimmung in unserer Herangehensweise an diese Melodie gibt, werden die Zuhörer unsicher sein, welchen Gesamteindruck wir vermitteln wollen. Und doch wünscht Beethoven nicht, dass die vier Präsentationen des Themas identisch klingen. Bei jedem Einsatz geht die Melodie in der Stimmlage nach unten. Sie beginnt im mittleren Tonspektrum der ersten Geige, dann bewegt sie sich bis zur tiefsten Saite in der zweiten Geige, darauf folgen der dunklere Klang der Bratsche und schließlich der volltönende Bass des Cellos: eine Intensivierung von Stimmengeflecht und Emotion, die sich aus dem Solo der ersten Geige entwickelt.
Auch wenn wir die Melodie grundsätzlich mit der gleichen Dynamik und im gleichen Tempo spielen, gestaltet sie jeder Einzelne leicht unterschiedlich, mit einer anderen Färbung: In Karcsis Sforzando schwingt der höchste Schmerz mit; Geris warmer Ton enthält beides: Trauer und Trost; András’ Version ist zurückhaltender, er spielt mit einem schlankeren Ton, der der Melodie eine introvertierte Note verleiht. Was ich für das Ganze beitrage, kann ich nicht beurteilen – vielleicht sollte ich das den bronchialen Herrn in der ersten Reihe fragen. Auch wenn es mir leid tut, dass das Konzert für ihn nicht vielversprechend beginnt, muss ich sagen, dass ständiges Husten mehr ablenkt als ein kurzer Zwischenfall, über den man auf der Bühne leicht hinweggehen kann – etwa ein Programm, das herunterfällt, oder ein Gesprächsfetzen, der lauter zu hören ist, als der Redner es ahnt, beispielsweise: «Feine Plätze haben wir heute Abend.»
Die Kombination von Miteinander und individuellem Ausdruck, wie die Eingangsphrase von Opus 131 sie verlangt, ist entscheidend für die Herausforderungen und den Erfolg beim Quartettspiel. Zu viele Köche mögen den Brei verderben, aber in einem Streichquartett kann nur dann eine zufriedenstellende Übereinstimmung erreicht werden, wenn alle vier Spieler dem Gericht ihre würzigen Zutaten beimischen. Während der letzten zehn Jahre habe ich das Glück, dieses Bestreben mit Karcsi, Geri und András zu teilen, die unentwegt Fragen stellen und sich immer bemühen, Wege zu finden, durch die wir unser Spiel verbessern können.
Während der morgendlichen Probe auf der Bühne der Wigmore Hall konzentrierte sich die unvermeidliche Diskussion über die Eingangsmelodie auf die Frage nach dem Tempo und darauf, wie es den Charakter der Musik beeinflusst. Geri und ich waren besorgt, dass wir immer langsamer wurden und deshalb zu «notig» klangen. Das war kein schmeichelhafter Begriff in unserem Probenvokabular. Er besagt, dass jede einzelne Note zu viel Gewicht hat – wie bei einem Satz, in dem jedes Wort ohne ersichtlichen Grund mit derselben Betonung gesprochen wird. Wir wollten die Aufmerksamkeit der Zuhörer nicht gleich zu Beginn des Stückes verlieren. Doch für András galt es als größte Sünde, zu flüssig zu spielen und unbedeutend oder oberflächlich zu klingen: Oft beginnt Beethoven mit einer kurzen, langsamen Einführung, aber sein kühner Entschluss, diese Idee auf einen ganzen Satz auszudehnen, sollte uneingeschränkt wahrgenommen werden.
Karcsi hielt sich aus der Diskussion heraus. Er bot sich stattdessen an, vom Saal aus zuzuhören. Wenn er die Bühne verließ, konnte er unser Spiel aus der Zuhörerperspektive beurteilen. Wir probierten eine langsamere und eine schnellere Version und bemühten uns, jede so überzeugend wie möglich zu präsentieren – schließlich könnte Karcsi die beiden Möglichkeiten nicht objektiv beurteilen, wenn ich während der langsameren Version, die András vorzog, wie ein Kind spielen würde, das sich auf einem unerwünschten Familienausflug nur widerwillig mitziehen lässt.
Die vorangegangene Diskussion hatte unser Spiel schon beeinflusst. Jetzt wollten Geri und ich unbedingt zeigen, dass wir ein rascheres Tempo durchaus mit genügend Tiefe kombinieren konnten. András hingegen konzentrierte sich darauf, so fließend wie möglich von einem Ton zum nächsten zu gehen. Damit wollte er demonstrieren, dass man durchaus langsam spielen kann, auch wenn man in zwei Schlägen pro Takt denkt.
«Der Unterschied ist nicht groß», verkündete Karcsi. «Es ist gut, wenn unser Bogenstrich gleich schnell bleibt. Wenn einer plötzlich mehr Bogen nimmt, klingen wir zu unruhig.» In diesem Fall hatte die Tatsache, dass wir uns gegenseitig die verschiedenen Anforderungen der Eingangsmusik bewusst machten, uns geholfen, unsere Herangehensweise zu vereinheitlichen.
Wenn wir uns wieder einmal ein Beethoven-Quartett vornehmen und erneut über so fundamentale Fragen wie das Tempo und den Charakter diskutieren, mag es so aussehen, als seien wir eine Gruppe, die diese Musik zum ersten Mal entdeckt. Ein Freund und Mitglied im Komitee der Kammermusikreihe der Corcoran Gallery, die in Washington D. C. stattfindet, lud uns einmal zu einer Probe in seinem Wohnzimmer ein. Bis dahin hatte er uns lediglich im Konzert gehört. Am Ende unserer Probe sagte er überrascht: «Leute, ihr hört euch manchmal an, als wüsstet ihr gar nicht, was ihr tut.»
Aber selbst wenn wir uns am Tag eines Konzerts auf eine nervenaufreibende nochmalige Diskussion einlassen, koste ich den Prozess aus, der uns dabei hilft, für eine Musik, die wir seit vielen Jahren aufführen, ein Gefühl von Unmittelbarkeit zu bewahren. Viele Stunden Vorbereitung mögen für ein Konzert förderlich sein, aber die spannendste Verbindung entsteht dann, wenn sowohl Zuhörer als auch Interpreten alle Zweifel beiseitelassen können und die Musik ganz neu entdecken. Das Erscheinen des Geistes zu Beginn von Hamlet wäre weniger eindrucksvoll, wenn der Schauspieler dem Publikum nebenbei zuflüsterte, dass diese Begegnung auch in einer früheren Matineevorstellung schon stattgefunden hat.
An diesem Abend profitiert unser Spiel des ersten Satzes von Opus 131 von der...