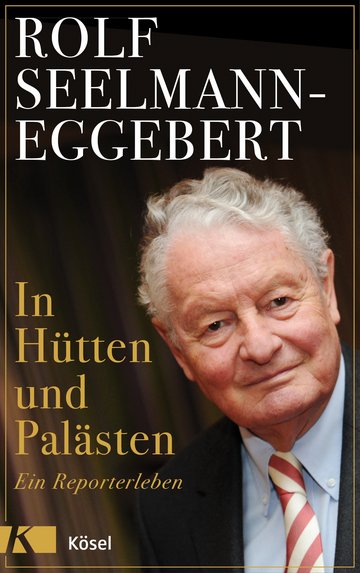Auf Safari
mit Prinz Philip
Dunst liegt über der westafrikanischen Hafenstadt Dakar, Senegal, sodass die zweimotorige Andover der königlichen Luftflotte erst kurz vor dem Aufsetzen für unsere Kamera sichtbar wird. Vor dem VIP-Pavillon, auf den die Maschine zurollt, keine Ehrengarde, keine Militärkapelle. Wenn er alleine reist, vermeidet der Herzog von Edinburgh gerne alles, was an den »großen Bahnhof« erinnert.
Wie er mit schnellen Schritten die Flugzeugtreppe hinabeilt, sportlich, braun gebrannt, straffe Haltung, könnte man ihn genauso gut für den Manager eines internationalen Konzerns halten, der mit eigenem Flugzeug auf Geschäftsreise ist. Die vierundsechzig Lebensjahre sieht man ihm nicht an. Am Fuß der Flugzeugtreppe ein kurzer Händedruck, ein freundliches Lächeln für die Gastgeber, eine Minute später setzt sich der Konvoi schwarzer Limousinen in Bewegung, sein Ziel: die Residenz von Staatspräsident Abdou Diouf, dem der Herzog einen Höflichkeitsbesuch abstattet.
»Und das ist alles?«, fragten Regisseur und Kameramann wie aus einem Mund. Ich tröstete die Kollegen. Wir hatten mit den Dreharbeiten für die Serie Royalty – ein Jahr im englischen Königshaus gerade erst begonnen.
In komplizierten Terminabsprachen mit dem Buckingham-Palast und der Genfer Zentrale der Naturschutzorganisation WWF war verabredet worden, dass wir Prinz Philip, Gemahl der englischen Königin Elizabeth II. und Herzog von Edinburgh, im Nationalpark von Djoudj filmen und am Abend desselben Tages auch unser Interview mit ihm in Dakar aufnehmen sollten. Weitere Einzelheiten müssten mit dem Herzog direkt geklärt werden. Deshalb stellte ich mich Prinz Philip nach der Pressekonferenz in Dakar vor – und erlebte gleich eine Überraschung. »Ihre dritte Frage ist zu politisch, die müssen Sie weglassen. Alle anderen Fragen sind in Ordnung«, sagte er ohne Umschweife. Ich hatte keine Ahnung, welche Frage er meinte. Die Fragen waren vor Wochen eingereicht worden, offenbar hatte er ein fabelhaftes Gedächtnis.
Von der Verleihung der Goldenen Kamera 1984 wusste ich, dass er gut Deutsch spricht. Ob wir das Interview auf Deutsch führen könnten? Er zögerte ein wenig. Schließlich hatte er vierzehn Tage überwiegend Französisch gesprochen, für Deutsch fehlte ihm die Übung, aber dann willigte er ein. Für Herausforderungen, die schnelles Umdenken erfordern, ist er immer zu haben gewesen.
Später schaute ich in meinen Unterlagen nach: Gegenstand der besagten dritten Frage war die Entwicklungshilfe und der von vielen Politikern der Dritten Welt vertretene Standpunkt, dass die beste Entwicklungshilfe eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung wäre. Insofern hatte der Herzog natürlich recht. Politisch war die Frage schon, nur: Manchmal greift er kontroverse Themen auch mit Vorbedacht auf, um die Diskussion voranzutreiben, selbst auf die Gefahr hin, sich unbeliebt zu machen.
Als Prinz Philip am späten Vormittag im Camp des Naturschutzparks eintraf, erwartete ihn ein gewaltiges Tamtam. Die Parkwächter und ihre Familien, Schulkinder und Dorfälteste bildeten ein großes, an einer Seite offenes Karree, das der Herzog in voller Länge abschritt. Er wusste, was er diesen Menschen schuldig ist, die zum Teil stundenlang durch Staub und Hitze gelaufen waren, um den hohen Besucher willkommen zu heißen. Die Frauen sangen und wiegten sich im Rhythmus der Trommeln – ein farbenprächtiges Bild, das auch mein Team versöhnte: nach dem eher nüchternen Empfang in Dakar endlich Afrika, wie es leibt und lebt. Leider blieb uns weniger Zeit in Djoudj, als uns lieb gewesen wäre. Denn am frühen Abend waren wir mit Prinz Philip zum Interview zurück in Dakar verabredet.
Während er mit seiner Andover zurückfliegen konnte, mussten wir die Hauptstadt mit unserem Minibus erreichen. Das war ein Problem, mit dem professionelle Beobachter des Königshauses ein ganzes Leben zu kämpfen haben. Nur selten gelingt es, bei einer Reise mit den königlichen Hoheiten Schritt zu halten. Wir waren damals froh, dass das nur ein Jahr lang unser Problem sein sollte. Tatsächlich wurde es eine halsbrecherische Fahrt. Bis kurz vor Saint-Louis war die Piste nicht befestigt. Als die Asphaltstraße begann, blies der Wind so kräftig vom Landesinneren, dass Sand und Staub die Sicht behinderten. In den Dörfern zwang uns das bunte Gewimmel von Mensch und Tier, praktisch Schritt zu fahren. Und zehn Kilometer vor Dakar war die Hauptstraße derart mit Buschtaxis, dreifach überladenen Minibussen und Lkws verstopft, dass uns nur übrig blieb, auf Nebenstraßen unser Glück zu versuchen.
Offenbar hatten sich die Frage, ob wir tatsächlich rechtzeitig zum Interview erscheinen würden, auch Prinz Philip und seine Begleiter gestellt. Denn als uns der Sicherheitsbeamte das Tor zur Botschaft öffnete, sagte er: »Sie haben es also doch geschafft!« Zehn Minuten später betrat der Herzog den Salon, wo wir zum Interview aufgebaut hatten, lächelte und meinte: »Gut gemacht!«, so als ob wir nach einem langen Wettlauf gerade die Ziellinie passiert hätten. Der Herzog trug Safarijacke und Schlips. Auf unsere Bitte hin nahm er Platz auf einem kleinen Sofa. »Aber dann bin ich doch zu weit von Ihrem Mikrofon entfernt«, erklärte er und rückte von der Ecke in die Mitte vor. Keine Frage, er ist ein ausgesprochener Medienprofi. Wann er denn Gelegenheit habe, Deutsch zu sprechen, fragte ich ihn, während das Team einleuchtete. Ich fragte ihn auf Deutsch, um ihm die Möglichkeit zu geben, vor dem Interview ein bisschen zu üben. »Sie wissen, dass ich Präsident der Internationalen Reiterlichen Vereinigung bin«, antwortete er, »und bei den Reitern gibt es viele, die Schwierigkeiten mit der englischen Sprache haben. Da vor allem spreche ich Deutsch.«
Beim Interview kam es vor, dass er mal einen Artikel verwechselte, dass ihm ein Wort nicht einfiel. Aber dafür, dass er nur ein Jahr im Internat Salem deutschem Spracheinfluss ausgesetzt war, beherrscht er die Sprache bemerkenswert gut. Prinz Philip, eigentlich ein griechischer Prinz, ist bei Verwandten aufgewachsen. Die Eltern hatten sich getrennt. Nach der Schließung seiner Internatsschule Salem am Bodensee ging er nach Großbritannien, wo Prinzessin Elizabeth auf ihn aufmerksam wurde, als sie mit ihren Eltern Dartmouth besuchte, die Kadettenanstalt der britischen Marine. Man sagte später, bei Elizabeth sei es damals Liebe auf den ersten Blick gewesen.
Nach dem Interview in Deutsch war er bereit, noch eine englische Fassung zu machen – auch darin ganz Medienprofi. Denn natürlich würden sich Zuschauer in Großbritannien und im Commonwealth sehr wundern, wenn der Herzog von Edinburgh bei einem Verkauf der Serie nicht ihre eigene Sprache spräche. Als alles vorüber war, verabschiedete sich Prinz Philip. Er wurde zu einem Dinner auf der Britannia erwartet, der königlichen Yacht, die inzwischen von Gambia nach Dakar weitergefahren war. »Ich hoffe, Sie können sich heute Abend gut erholen. Ich selber habe leider noch Gastgeberpflichten.«
Vierzehn Tage später sahen wir ihn wieder. Nach Zwischenaufenthalten in Mauretanien und Madeira war die königliche Yacht in den Tejo eingelaufen. Am Nachmittag fand an Bord der Britannia für die Journalisten, die über den Staatsbesuch in Portugal berichteten, ein Empfang statt. Auch das ARD-Team wurde vorgestellt. Er erkannte uns sofort. »Sie haben es also wieder einmal geschafft«, sagte er.
Dass mir ausgerechnet die Wellblechpisten des Senegal den Durchbruch bei meiner ersten Sendereihe über das englische Königshaus bescheren würden, hätte ich mir nie träumen lassen. Normalerweise drehte allenfalls das britische Fernsehen bei Hofe. Dass ein deutsches Team ein Exklusivinterview mit dem Herzog von Edinburgh bekam, war schon eher ungewöhnlich. In jungen Jahren hatte mein journalistischer Ehrgeiz einer möglichst breiten Afrikaberichterstattung gegolten. Später dann gab ich mir in Großbritannien Mühe, so tief in das Wesen der parlamentarischen Monarchie einzudringen, wie es einem Ausländer möglich ist. Dazu gehörte natürlich auch der Kontakt zu Mitgliedern der königlichen Familie. Nach Prinzessin Anne war der Herzog von Edinburgh der zweite Royal, den ich vors Mikrofon bekam. Damals ahnte ich nicht, dass noch viele derartige Interviews folgen würden und dass mir eine Karriere als »Königsfritze« im deutschen Fernsehen bevorstand.
Diesen Spitznamen hat mir übrigens das Nachrichtenmagazin Der Spiegel verpasst. Ich habe ihn manchmal übernommen. Hofberichterstatter? Adelsexperte? Ich wollte nicht der Jubeljournalist für alle Monarchien dieser Welt sein.
Aber irgendwie blieb diese Rolle an mir haften. Ich musste nicht nur ein Jahr mit den königlichen Hoheiten Schritt halten, sondern ein halbes Leben. Wenn ich heute meine Frau Barbara gelegentlich auf den Isemarkt in Hamburg begleite, um ihr beim Einkaufen zu helfen, passiert es immer mal wieder, dass mich jemand am Ärmel zupft und fragt: »Was machen Sie denn hier? Sie gehören doch nach London!« Wenn ich dann zu erklären versuche, dass ich mit meiner Familie schon vor über zwanzig Jahren in die Hansestadt zurückgekehrt bin, herrscht oft ungläubiges Staunen. Vielleicht tragen auch die Tweed-Stoffe und die blauen Blazer, in denen ich mich nun schon seit sechzig Jahren mit Vorliebe zeige, zu diesem britischen Image bei.
Viele Fernsehzuschauer glauben, wenn ich auf dem Flughafen in Heathrow ankomme, wartet schon eine Limousine auf dem Vorfeld, um mich zum Five o’Clock Tea mit Ihrer Majestät in den Buckingham-Palast zu bringen. Das ist leider nur eine Traumvorstellung....