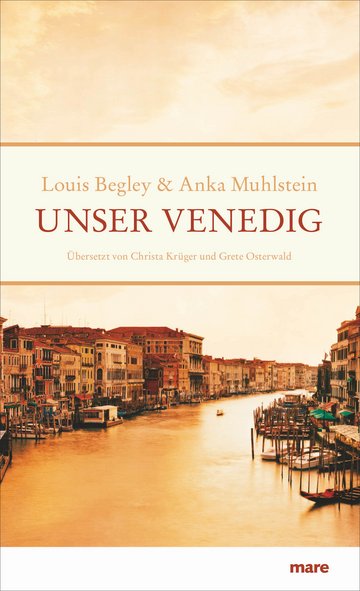Anka Muhlstein
Die Schlüssel zu Venedig
Seit zwanzig Jahren verbringen wir, mal im Frühling, mal im Herbst, zwei Wochen in Venedig. Diese Aufenthalte sind mit der Zeit Arbeitsferien im Sinne von Colette geworden – les vacances c’est travailler ailleurs – und geben meinem Mann die seltene Gelegenheit, ungestört, ohne ständige Unterbrechungen zu schreiben. Dabei ist er als Romancier in der glücklichen Lage, sich alles aus dem Kopf zu ziehen, während ich als bescheidene Biographin auf Bücher, Lexika und Enzyklopädien angewiesen bin. Da wir es aber verabscheuen, mit einer Handbibliothek zu reisen, schreibe ich kaum, sondern lese, korrigiere und lese noch einmal.
Früher war das anders. Ehe Louis 1989 zu schreiben begann, haben wir lange Spaziergänge gemacht, die oft ins Ungewisse führten, haben uns Gemälde angesehen, gingen in Konzerte oder versuchten, uns mit Überredungskunst Zutritt zu Orten zu verschaffen, die für Fremde wie uns normalerweise verschlossen blieben. Zu unseren größten Triumphen zählen ein Besuch in der Biblioteca Marciana, in der wir dank unserer frei erfundenen Freundschaft zum Direktor der New Yorker Public Library die Erstausgaben von Dante besichtigen durften, oder eine ruhige Stunde im Baptisterium von San Marco unter Führung eines offiziellen Aufsehers. Der hatte unseren Bitten gerührt nachgegeben und, als wir ihm danken wollten, elegant erwidert, unsere Freude an der Betrachtung «seiner» Schätze sei ihm eine tröstliche Entschädigung gewesen für den Anblick der Touristenhorden – il gregge di pecore –, die täglich in die Kathedrale einfielen und mit schleifenden Schuhsohlen den wunderbaren Fußboden verkratzten. Aber leider hatte unsere Methode nicht immer Erfolg. Der Wächter von San Sebastiano widerstand unserem Charme, unserem Status als Fernreisende und unserer Leidenschaft für Veronese. Jahrelang hatte er die Kirchentüren nur für eine kurze Messe geöffnet, und eine Ausnahme kam nicht in Frage. Unbeugsam blieben auch der Portier des Seminario Patriarcale und der Hüter des Konservatoriums.
Nach und nach aber lernten wir die Stadt kennen, und schließlich ging ich ohne Faltplan in der Hand spazieren. Zum einen hatte ich begriffen, dass man sich, ganz im Gegensatz zu meinem ersten Eindruck, in Venedig nicht verirren kann – man muss nur dem Strom folgen, um entweder unter dem berühmten Uhrturm vor San Marco oder am Fuß des Rialto zu landen –, und außerdem hatte ich bald meine persönlichen Wegweiser: Ein Schaufenster, ein Schild, eine Schnitzerei an einer Tür zeigten mir, wo ich abbiegen musste. Der eigentliche Sport bestand nun darin, gezielt den Touristen aus dem Weg zu gehen: Das Viertel um San Marco war bis zum frühen Abend ungenießbar. Um die Basilika zu betreten, musste man entweder zur Vesper gehen oder durch den Seiteneingang schlüpfen und den Aufpasser mit ernster Miene um Einlass zum pregare bitten. In der Gegend von Santa Madonna dell’Orto entdeckten wir ein stilles Venedig, bevölkert von Hausfrauen, Kindern und Rentnern in Pantoffeln, während uns beim Bummel am Cannaregio-Kanal geschäftiges Treiben und reges Leben entgegenschlug. Manche Plätze, etwa vor San Francesco della Vigna oder hinter dem Arsenal, waren beherrscht von den schnellen, zielstrebigen Schritten einheimischer Passanten, auch zu erkennen an ihrem Geschick, jedem noch so unverhofften Fußball auszuweichen. Venedig war uns vertraut geworden. Die überschäumende Neugierde der Anfänge hatte sich gelegt. Die tägliche Arbeit in den Nachmittagsstunden – der Morgen blieb für Spaziergänge reserviert – war der beste Beweis, wie sehr wir uns in der Lagunenstadt zu Hause fühlten. In dieser Hinsicht hatten wir uns verändert, aber es gab ein Prinzip, an dem wir eisern festhielten: Wir wollten niemanden sehen.
Grüppchenweise durch die Gassen ziehen, immer besorgt, dass keiner den Anschluss verliert; Verabredungen treffen, die unweigerlich schief gehen, weil die einen in das falsche Vaporetto gestiegen sind und die anderen die Gesuati- mit der Gesuiti-Kirche, den Palazzo Bembo mit dem Bembo-Boldù oder den Contarini mit zehn anderen Palazzi Contarini verwechselt haben; die Abende bei einem Gläschen Wein und Gesprächen über Politik mit Freunden verplaudern, zu denen wir in New York oder in Paris ständigen Kontakt hatten – nein, das wollten wir nicht, nicht hier, wo wir in Gedanken ganz mit unseren realen oder fiktiven Personen beschäftigt waren. Aber in der winzigen Lagunenstadt allen Menschen aus dem Weg zu gehen, ist eine Illusion.
Glücklicherweise haben wir ein Alibi in Gestalt einer reizenden Nichte, die Venedig zu ihrer Wahlheimat erkoren hat. Jeden Versuch, eine Verabredung vorzuschlagen, erwidern wir mit dem immer gleichen Satz: «Tut uns leid, wir sind zum Essen, zum Frühstück, zum Kaffeetrinken bei Marie.» Und so treffen wir niemanden außer denen, die wir täglich selbst aufsuchen: die Wirtsleute, die Padroni, und Kellner unserer Lieblingsrestaurants.
Auch wenn unsere Gewohnheiten etwas rigide wirken mögen, muss ich noch eine andere Vorliebe zugeben: Sobald wir ein Lokal finden, das uns gefällt, nisten wir uns vorbehaltlos ein. Wir sind glücklich, jeden Abend am selben Tisch zu sitzen: Das Menü birgt keine Überraschung mehr – für Louis gibt es ohnehin nichts Schöneres, als jeden Tag das Gleiche zu essen –, wir werden herzlich empfangen, sind zu Hause und haben doch den unschätzbaren Vorteil, nicht selbst Geschirr spülen zu müssen. Aber wie in ganz Italien wird auch in Venedig mit dem riposo settimanale nicht gespaßt, und alle Etablissements legen pro Woche zwei Ruhetage ein. Man braucht also ein ausgefeiltes Rotationssystem, um zu überleben. Im Lauf unserer zwanzig Jahre Venedig sind uns vier Restaurants ans Herz gewachsen, und die Begegnung mit ihren Padroni und dem Bedienungspersonal hat uns die Stadt und ihre Einwohner auf besondere Weise näher gebracht.
Don Ernesto war der erste, der uns in seinen Bann zog. In Venedig geht man früh zu Bett. Viele Touristen, die sich tagsüber in Scharen auf der Piazza San Marco tummeln, fahren abends aufs Festland zurück. Die Tagespläne der Reiseleiter beginnen meist in aller Herrgottsfrühe: Man kommt nicht zum Vergnügen, und die Kulturverpflichteten werden getrimmt, sich ab dem Morgengrauen auf Bildung einzustellen. Kein Wunder, dass ihre Abende eher kurz ausfallen. Einmal hatten wir uns Karten für die Oper besorgt, wollten aber ganz nach unserer Gewohnheit erst nach der Vorstellung essen. Also beschlossen wir, uns vorab bei einem Bummel durch das Viertel von La Fenice ein geeignetes Lokal zu suchen. In einer der umliegenden Gassen, die den etwas schaurigen Namen Calle dei assassini trug, entdeckten wir ein kleines Restaurant, so zurückgezogen und versteckt, dass wir fast vorbeigelaufen wären. Nichts als ein schmaler langer Raum, in hellem Holz gehalten, die Wände mit eingerahmten Banknoten bedeckt. Durch das Fenster sah man einen stattlichen beleibten Mann, dem ein hoch aufgeschossener jüngerer beim Tischdecken zur Hand ging. Ein zaghaftes Klopfen – schon blickte er auf und kam an die Tür. Ob wir zu später Stunde, also nach der Oper, noch bei ihm essen könnten, fragte Louis. «Da haben Sie Glück», erwiderte der Mann. «Heute singt die Anderson. Beatrice Cenci wird gegeben, oder? Natürlich erwarte ich Sie gern! Keine Sorge. Aber sagen Sie: Mögen Sie Wein, einen guten Roten?» Wir konnten genug Italienisch, um eine so einfache Frage zu verstehen und begeistert zu antworten. «Dann ist ja alles perfekt», sagte er. «Ich stelle Ihnen einen vino di riserva, capo di stato, bereit.»
Die Stimme und die Schönheit von June Anderson, die wir zum ersten Mal hörten, sind mir in berückender Erinnerung geblieben. Noch nachhaltiger aber hat sich mir die Szene unserer Ankunft bei Ernesto eingeprägt. Wir waren allein. Auf einem Tisch stand, gut gefüllt, eine landestypische Karaffe, daneben eine schwarze Flasche. Der italienische Wein, der schwere Rote, versteht sich, muss atmen, bevor man ihn trinkt. Ernesto hatte sich auf uns verlassen und eine große Flasche Amarone entkorkt und dekantiert. «Na, wie war unsere June? Hat sie gut gesungen? Wirklich schade, dass ich sie nicht hören konnte!» Dabei reichte er uns die Speisekarte. Eine Überraschung für Venedig: keinerlei Fisch, weder Krabben noch Garnelen oder Tintenfisch, stattdessen eine satte Auswahl an Fleisch. Deftige, in Essig gezogene panierte Schweinekoteletts, Pfeffersteaks, Rumpsteaks alla campagnola, aber auch, höchst unerwartet, Hamburger aus frischem, selbst gehacktem Rinderfilet, die Ernesto uns empfahl, ehe er wieder in dem Nebenraum verschwand, den ich kaum als Küche zu bezeichnen wage: winzig klein, voll gestellt mit Regalen und einem gewaltigen Sechs-Flammen-Herd, so eng, dass es unvorstellbar war, wie sich zwei Männer hier bewegen sollten, und noch unvorstellbarer, wie sie es fertig brachten, bis zu dreißig Gäste zu bekochen. Denn auch der lange Raum, in dem wir saßen, war nicht größer als ein halber Speisewagen. Aber er hatte eine...