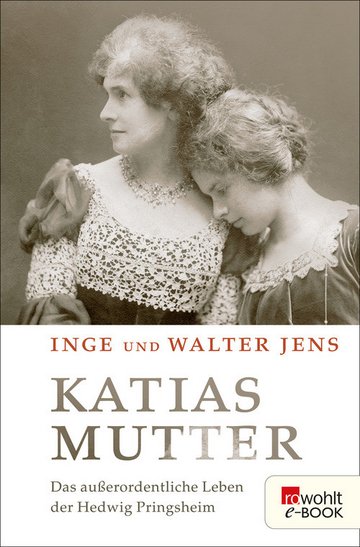KAPITEL 1
Im Hause Dohm
Es war mit Sicherheit eine der interessantesten – man könnte auch sagen: kuriosesten – Familien der preußischen Metropole, in die Hedwig Pringsheim am 13. Juli 1855 hineingeboren wurde. Ihr Vater, Ernst Dohm, Spross einer armen jüdischen Familie, war bereits als Kind getauft und von einer frommen Mutter sowie einer pietistischen Gönnerin zum Theologen bestimmt worden. Nach erfolgreich absolvierten Examenspredigten hatte er jedoch Talar und Beffchen an den Nagel gehängt und sich als Hauslehrer und Übersetzer durchgeschlagen, ehe er 1848 mit der Gründung der politisch-satirischen Zeitschrift Kladderadatsch endgültig ins literarisch-journalistische Genre wechselte. Sein profundes Wissen, sein ebenso stil- wie treffsicherer Witz und seine unterhaltlichen Fähigkeiten sowie eine offenbar beachtliche poetische Begabung verhalfen ihm schnell zu Ansehen und Beliebtheit.
Auch Hedwigs Mutter, deren Vornamen das Neugeborene erhielt, hatte in ihrer Ehe begonnen, sich als Schriftstellerin zu profilieren. Sie schrieb Novellen, Dramen und Gedichte, später auch Romane. Vor allem aber zog sie in öffentlichen Stellungnahmen und Essays gegen die These von der angeblich naturgegebenen Ungleichheit von Männern und Frauen zu Felde und wurde in den späten sechziger und siebziger Jahren, nachdem sie vier Kinder großgezogen hatte, zu einer der bekanntesten Kämpferinnen für die Zulassung der Frau zu allen berufsqualifizierenden Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten.
«Kämpferin»? Zumindest Hedwig, die älteste ihrer vier Töchter, sah die Mutter anders: «Schön war sie und reizend; klein und zierlich von Gestalt, mit großen, grünlich-braunen Augen und schwarzen Haaren, die sie auf Jugendbildnissen noch in schlichten Scheiteln aufgesteckt trug, später aber abgeschnitten hatte, und die dann halblang und gewellt ihr wunderbares Gesicht umrahmten. Zart war sie, schüchtern, empfindsam, ängstlich. Wer sie nur aus ihren Kampfschriften kannte und ein Mannweib zu finden erwartete, wollte seinen Augen nicht trauen, wenn ihm das holde, liebliche und zaghafte kleine Wesen entgegentrat. Aber ein Gott hat ihr gegeben, zu sagen, was sie gelitten, was sie in Zukunft ihren Geschlechts-Schwestern ersparen wollte.»
Der Roman Schicksal einer Seele vom Beginn des neuen Jahrhunderts oder die noch ein Dezennium später entstandenen Erinnerungen einer alten Berlinerin zeigen, dass Hedwig Dohms Einsatz für ihre Geschlechtsgenossinnen seine Wurzeln in den Leiden ihrer eigenen traurigen und glücklosen Kindheit hatte.
Zwischen einem «indolenten» Vater und einer Mutter «von unbeschreiblicher Verständnislosigkeit und engherziger Borniertheit» war sie im Kreis von ursprünglich 18 Geschwistern aufgewachsen, von denen acht Buben und acht Mädchen überlebten. Dem stets in seiner Fabrik beschäftigten Vater fehlten offenbar Zeit und Bildung, um die Bedürfnisse der sensiblen Tochter wahrzunehmen. Zwar sei er, wie Hedwig Dohm später betonte, künstlerisch nicht unbegabt gewesen, habe aber sein «erstaunliches» Zeichentalent, den milieuspezifischen Vorurteilen der Zeit folgend, nicht ausbilden dürfen. Auch seine Schulzeit sei auf das Minimum reduziert gewesen: «Mit vierzehn Jahren saß er bereits im Kontor der väterlichen Fabrik»: «ein stiller ergebener Herr», ein «Sonntagsvater», der seinen Kindern, wie die Tochter betont, niemals «einen Schlag gegeben» habe. Und doch: «Wir wußten nichts von ihm, er wußte nichts von uns.» – Als Kaufmann aber muss er erfolgreich gewesen sein, und dass er seine Braut erst nach der Geburt des zehnten Kindes heiratete, hatte mit Sicherheit keine ökonomischen Gründe.
In den Augen der Tochter wurde das Leben der Kinder ausschließlich durch die Mutter bestimmt; sie sei der «Herr im Hause» gewesen: eine robuste, aufbrausende und herrschsüchtige Frau, tüchtig im Haushalt, aber ohne jedes geistige Interesse und unfähig, Wärme und Zuneigung zu zeigen. Doch habe auch sie über eine künstlerische Begabung: Musikalität und eine schöne Stimme, verfügt.
Hätte man Vater und Mutter erlaubt, ihre Talente zu entwickeln, mutmaßte die lebenserfahrene Frauenrechtlerin 1912, das Familienleben im Hause Schleh «hätte sich wahrscheinlich ganz anders gestaltet» – ohne jene hierarchischen Maximen von der Herrschaft des Mannes über die Frau, der Eltern über die Kinder, der Hausfrau über ihre Dienstboten, die sich auch in der Erziehung niederschlugen. Was den Knaben selbstverständlich gewährt wurde: Bildung oder zumindest doch Ausbildung, körperliches Training, Rudern, Reiten, Schwimmen, blieb den Mädchen mit der gleichen Selbstverständlichkeit versagt. Ja, selbst das Lesen galt als schädlicher Müßiggang, der hinter Haus- und Handarbeiten zurückzustehen hatte. Allein die Schulpflicht wurde akzeptiert, wenn auch weniger als Chance, den Wissensdurst zu befriedigen, denn als gesetzlich verordneter Luxus, der zum erstmöglichen Zeitpunkt zu beenden war.
Nur mit Schaudern hat Hedwig Dohm später jener Zeit gedacht, da sie, statt lernen und lesen zu dürfen, gehalten war, in der «grünen Plüschstube» der «spießbürgerlichen Wohnung» nahe dem Halleschen Tor, «häßliche Teppiche» mit «großen, knalligen Blumen zu verzieren», «die nach einem Muster abgestickt» werden mussten, sodass sie sich gefragt habe, warum denn Mütter das Recht hätten, ihren Kindern so viel Herzeleid anzutun, und warum selbst sie, die doch «Kind wohlhabender Leute war», gezwungen wurde, «wie ein Sträfling» widrige Arbeiten verrichten zu müssen: «Warum mußte ich heimlich, als wär’s ein Verbrechen, lesen? Warum durfte ich nichts lernen? Meine Brüder wollten und mochten nichts lernen und wurden dazu gezwungen.»
Einen Ausweg aus dieser Misere versprach allenfalls die Ehe. Und so erwies es sich denn als glückliche Fügung, dass Freunde dem wohlhabenden jüdischen Fabrikanten Gustav Schlesinger – seit seiner Taufe Gustav Schleh – den «entgleisten Theologen» Ernst Dohm für die Rolle eines Sprachlehrers empfahlen, als Frau und Tochter Hedwig sich zum Besuch eines in Spanien verheirateten Sohnes und Bruders rüsteten. Obwohl der junge Mann nach eigenem Bekunden kein Wort Spanisch beherrschte, setzte er durch die Art seines Unterrichts die Damen des Hauses offenbar ausreichend instand, die Reise mit Gewinn zu absolvieren. Gewinn in doppelter Hinsicht: Ein Jahr nach der Rückkehr der Familie aus Spanien hielt der Hauslehrer – inzwischen angesehener, wenn auch schlecht besoldeter Chefredakteur des Kladderadatsch – um die Hand von Tochter Hedwig an, ein Unterfangen, dem, wie die Familiensaga berichtet, Fabrikant Schleh nur ungern und nach langem Zögern seine Zustimmung gab. Er hätte sich – so fast ein Jahrhundert später die Interpretation seiner Enkelin Hedwig Pringsheim – einen solideren Schwiegersohn gewünscht.
Ernst und Hedwig Dohm heirateten 1852. Zumindest die ersten Ehejahre brachten der jungen Frau jedoch nicht die Erfüllung ihrer Träume: «Kümmerlich und bescheiden» sei es zugegangen in der jungen Wirtschaft, berichtete Tochter Hedwig später, innerhalb weniger Jahre hätten sich fünf Kinder eingestellt: zunächst ein Junge, der jedoch mit zwölf Jahren an Scharlachfieber gestorben sei, dann «Jahr um Jahr ein Töchterchen, vier hübsche, vielversprechende Mädchen». Für eine sich derart vergrößernde Familie aber habe das knappe Gehalt nie gereicht, und da zusätzlich noch Mutter und Schwester zu versorgen gewesen wären, habe der Vater Schulden machen müssen: «Und wie es dann so geht mit Schulden, sie wachsen lawinengleich an, bis sie den schuldlos Schuldigen eines Tages verschütten.»
Die Mär vom schuldlos Schuldigen war indes nur ein Teil der Wahrheit. Zeitgenossen – auch jene, die Ernst Dohm wohl wollten – sahen die Sache anders: Zwar billigten auch sie ihrem Kollegen zu, dass er – was ihn selbst anging – nicht verschwenderisch war, sondern auch noch als Familienvater den Wert des Geldes nicht kannte und deshalb stets freigebiger war, als es seine Verhältnisse zuließen. In der Tat war stadtbekannt, dass Ernst Dohm immer mehr gab, als nötig war, und selbst notorischen «Schnorrern» auch dann keine Bitte abschlug, wenn er sicher wusste, dass er selber am nächsten Tage sich etwas borgen musste. Aber der eigentliche Grund der ständigen Geldmisere sei seine «Leidenschaft zum Glücks-Spiel» gewesen, eine Sucht, der Ernst Dohm offenbar viele Jahre lang verfallen war.
Davon allerdings ist in den Feuilletons, die Tochter Hedwig als alte Frau zwischen 1928 und 1932 für die Vossische Zeitung schrieb, nichts zu lesen. Im Gegenteil: Sie hat niemals aufgehört, ihren «überaus zärtlichen Vater» vehement gegen den Vorwurf der Schuldenmacherei zu verteidigen, und die gravierenden Folgen, die seine Schwäche zeitweilig für die Familie hatte, poetisch zu verklären: «Ich erinnere mich aus meiner frühesten Kindheit, daß immer so komische kleine geheimnisvolle Zettel an versteckten Stellen unserer Möbel klebten, manchmal verschwanden die Möbel sogar, manchmal kamen sie wieder; es war eine unseriöse und spannende Angelegenheit. Sehr deutlich entsinne ich mich des Tages, an dem unser Klavier abgeholt wurde, denn da waren wir schon größere Mädchen mit Musikunterricht. Während die in der Etage unter uns lebenden Freundinnen und frommen Beschützerinnen der Familie ihr Haupt verhüllten und bitterlich weinten, führten wir Kinder einen wilden Indianer- und Freudentanz um das arme kleine Piano herum auf, weil wir nun keine Klavierstunden mehr zu nehmen brauchten.»
Doch wie romantisch auch immer die Kinder ihre familiäre Situation empfunden haben mögen – ohne die...