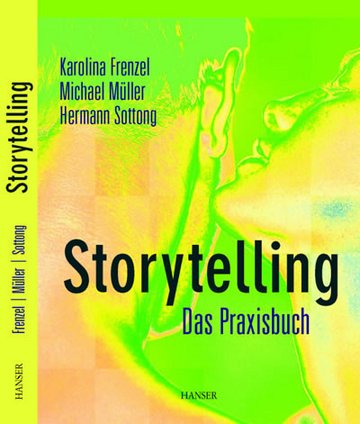Jeder ist ein Erzähler (S.193)
»Ich bin aber kein Storyteller!« Diese Einleitung schickte der Mitarbeiter eines Unternehmens warnend voraus, als wir ihn baten, für eine Storytelling-Studie aus seinem Arbeitsleben zu erzählen. Der Mann war ein ruhiger, im Vorgespräch etwas wortkarger Typ. Als später das Mikrofon ausgeschaltet wurde, war er selbst erstaunt: Über eine Stunde hatte er am Stück erzählt, was er in der Firma alles erlebt hatte.
Dass jemand sich das Erzählen erstmal nicht zutraut, kommt öfter vor. Dass aber jemand wirklich nicht erzählen kann, haben wir in zehn Jahren Storytelling-Praxis noch nicht erlebt. Natürlich macht es jeder ein bisschen anders: Manche holen etwas weiter aus, andere fassen sich kürzer, der eine fühlt sich gleich in seinem Element, der andere tastet sich erstmal an die ungewohnte Situation, ohne Skript und Folien zu anderen zu sprechen, heran.
Beim Erzählen gibt es gerade für diejenigen, die sonst keine großen Reden schwingen, dann oft überraschende Erlebnisse. Die Zuhörer sind aufmerksam dabei und verfolgen ihre Geschichte mit Spannung bis zum Ende, einige kommen danach auf sie zu, um ihnen zu sagen, warum die Geschichte sie berührt hat, dass sie vielleicht einmal etwas Ähnliches erlebt haben oder dass die Erzählung bei ihnen neue Gedanken, eine Idee oder eine Erinnerung ausgelöst hat. Jeder kann erzählen, vorausgesetzt, jemand anderer hört ihm interessiert zu.
Zum Erzählen vor Zuhörern gibt es deshalb keine alternativen »Trockenübungen«. Man kann eine Geschichte zwar im stillen Kämmerlein entwerfen, man kann an ihr feilen, sie ausprobieren sollte man aber immer, indem man sie jemandem erzählt. Der amerikanische Schriftsteller Ray Bradbury (von dem unter anderem die Romanvorlage für den Truffaut-Film »Fahrenheit 451« stammt) erzählt, wie sein Vater für ihn beim Erzählen plötzlich lebendig wurde:
Mein Vater und ich waren lange Zeit nicht gerade gute Freunde. Seine Sprache, seine täglichen Gedanken enthielten nichts Bemerkenswertes. Doch wann immer ich bat: Dad, erzähl mir von Tombstone, als du 17 warst, oder von den Weizenfeldern in Minnesota, als du 20 warst, begann er zu erzählen, wie er mit 16 von zu Hause fortgelaufen war und Anfang dieses Jahrhunderts nach Westen reiste, noch bevor die letzten Grenzen gezogen waren, als es statt Highways nur Pfade und Eisenbahnstrecken gab, als Nevada den Goldrausch erlebte.
Nicht in der ersten, der zweiten oder der dritten Minute geschah diese Sache mit Dads Stimme – noch war die richtige Modulation nicht vorhanden, noch kamen die richtigen Worte nicht. Doch nachdem er fünf oder sechs Minuten gesprochen und seine Pfeife angezündet hatte, kehrte ganz plötzlich die alte Leidenschaft zurück, die alten Tage, die Lieder, das Wetter, der Anblick der Sonne, der Klang der Stimmen, die Güterwagen, die tief in der Nacht vorbeifuhren, die Gefängnisse, die Spuren, die sich in der Ferne im goldenen Staub verloren, die Zeit, als der Westen sich öffnete – alles, alles, und dann der Tonfall, der Augenblick, die vielen Augenblicke der Wahrheit und darin die Poesie. Die Muse war plötzlich zu meinem Dad gekommen. (Bradbury 2003, Seite 48 f.)