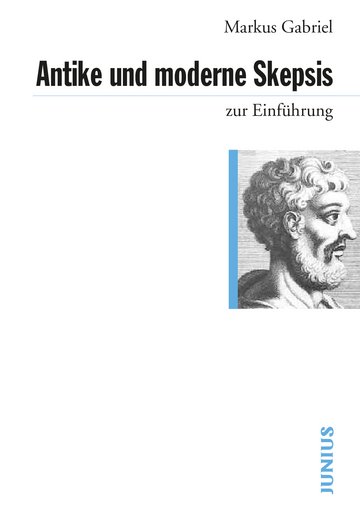2. Das Traumargument bei Platon und das skeptische Problem der Aparallaxie
Die erste explizite Formulierung eines epistemologischen Traumarguments findet sich in Platons Dialog Theaitetos (Tht. 157e1-158d10), der als die Urschrift der Erkenntnistheorie gelten kann. Damit sind entscheidende Weichen für die weitere Entwicklung der Skepsis gestellt. In diesem Dialog wird nämlich die Frage erörtert, was Wissen eigentlich sei. Platon antizipiert hier eine Vielzahl erkenntnistheoretischer Positionen, die erst im 19. und 20. Jahrhundert philosophisch detailliert entwickelt worden sind. Die tragische Dimension des Wissens und der Differenz von Sein und Schein tritt dabei in den Hintergrund, obwohl man bei genauerem Hinsehen in der literarischen Komposition des Dialogs Spuren der existenziellen Dimension der Frage nach dem wirklichen Sein finden wird.
Im Theaitetos werden nacheinander drei Definitionen von ›Wissen‹ diskutiert und widerlegt. Platons Traumargument findet sich dabei im ersten Teil des Dialogs, in dem die Definition von Wissen als Wahrnehmung diskutiert und ad absurdum geführt wird. Das Traumargument dient in diesem Zusammenhang nicht, wie später bei Descartes, dazu, die Wahrnehmung als Quelle von Wissen insgesamt infrage zu stellen und ein irrtumsimmunes Fundament des Wissens zu suchen. Freilich ist Platon weit davon entfernt, empirisches Wissen überhaupt als Wissen sensu stricto gelten zu lassen. Das Traumargument richtet sich bei Platon genau besehen gegen die Identifikation von Wahrnehmung und Wissen, der zufolge nur Wahrnehmung Wissen ist. Es gehört somit in den Kontext einer Kritik des radikalen Sensualismus, der behauptet, dass alles Wissen Wahrnehmung sei.
Platons Traumargument besagt, dass wir hic et nunc im Akt einer bestimmten Wahrnehmung von etwas kein Merkmal (tekmêrion, kritêrion) dafür an der Hand haben, dass wir den Gehalt, der sich uns präsentiert, wirklich wahrnehmen und nicht bloß träumen oder halluzinieren. Im Akt der Wahrnehmung kann demnach nicht sichergestellt werden, dass es sich überhaupt um einen Akt der Wahrnehmung handelt. Die Wahrnehmung ist nämlich konstitutiv betriebsblind, da sie sich auf etwas anderes als sich selbst bezieht. Wer etwas wahrnimmt, nimmt nicht deshalb auch schon wahr, dass er es wahrnimmt (und demnach nicht halluziniert). Wir sind also fallibel in der Frage, ob wir etwas wahrnehmen, auch und gerade, wenn wir meinen, etwas wahrzunehmen. Ob wir etwas wahrnehmen, können wir nämlich nicht dadurch entscheiden, dass wir es wahrnehmen, da wir im Akt der Wahrnehmung nicht sicherstellen können, dass wir wirklich wahrnehmen und nicht bloß träumen.
Mit diesem Argument richtet sich Platon gegen den Infallibilismus des Protagoras. Platon versteht Protagoras so, dass dieser in seinem Buch über Wahrheit (alêtheia) behauptet habe: »wie alles mir erscheint, so sei es auch für mich, und wie es wiederum dir erscheint, so sei es auch für dich« (Tht. 152a7-9). Sein und Schein könnten nicht getrennt werden, da wir keinen Zugang zum Seienden haben, der nicht durch unsere Überzeugungen, d.h. durch unser Fürwahrhalten, vermittelt ist. Wir können nicht feststellen, was der Fall ist, ohne eine Überzeugung dahingehend zu haben, dass es der Fall ist. Da wir aus unseren Überzeugungen nicht aussteigen können, gibt es Protagoras zufolge für uns sensu stricto überhaupt keine Wahrheit (Sein) unabhängig von unserem Fürwahrhalten, der Doxa, die Platon – in der Tradition der Eleaten – mit dem Schein gleichsetzt. Dies bringt der berühmte Homo-Mensura-Satz zum Ausdruck: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, daß (bzw. wie) sie sind, der nicht seienden, daß (bzw. wie) sie nicht sind.« (DK 80 B 1)
Diesen Satz deutet Platon als die Aufhebung der Differenz von Sein und Schein, die letztlich das Interesse des Sophisten Protagoras sei. Denn dieser lehre für Geld die Kunst des logischen Scheins, die Rhetorik, die an die Stelle des Wissens des Wahren, d.h. des Seienden, den Schein der Wahrheit setze und seinen Schülern dazu verhelfe, die Überzeugungen der Mitmenschen zu manipulieren.
Wenn es aber wahr ist, dass alles Seiende nur relativ auf unsere Überzeugungen etwas Seiendes ist und wir aus unseren Überzeugungen nicht aussteigen können, dann hat es auch keinen Sinn mehr, im Sinne eines metaphysischen Realismus nach dem wahren Sein zu suchen. Denn dieses kommt gar nicht unabhängig von unseren Überzeugungen, jedenfalls nicht unabhängig von der Überzeugung vor, dass es das wahre Sein gibt. Die doxastische Relativität des Seienden führt dazu, dass die Annahme des wahren Seins und damit die Differenz von Sein und Schein fallen gelassen werden muss. Denn auch die Überzeugung, dass das wahre Sein sich vom Schein unterscheidet, ist relativ auf unsere Überzeugungen wahr und kann demnach nicht vorbehaltlos als die Wahrheit über das Sein selbst gelten.
Gegen die Annahme, Wissen stamme aus der Wahrnehmung, wendet das Traumargument ein, dass wir selbst in die scheinbar rein rezeptive Wahrnehmung die Differenz von Sein (Wahrheit) und Schein (Irrtum) investieren. Zwar mag uns im Akt der Wahrnehmung irgendetwas zunächst einmal irrtumsimmun als intentionales Korrelat gegeben sein, d.h., wenn wir etwa meinen, einen Apfel zu sehen, so haben wir die Vorstellung eines Apfels, wie auch immer diese zustande gekommen sein mag. Genau dies bedeutet aber auch schon, dass wir in der Frage, ob wir wirklich etwas wahrnehmen oder bloß meinen, etwas wahrzunehmen, fallibel sind. Wenn wir nämlich lediglich träumten, dass dieses und jenes der Fall wäre, so hätten wir ipso facto keinen wissensförmigen Zugriff mehr auf die betreffende Sache. Wenn wir etwa träumen, dass ein Apfel vom Baum fällt und im Traum der Überzeugung sind, dass ein Apfel vom Baum fällt, so folgt daraus nicht, dass wir einen Apfel wahrgenommen haben, der vom Baum fällt. Träumen und Wahrnehmen sind zwei inkompatible Vollzüge.
Diese Beobachtung führt Platon dazu, als Erster einen klaren Unterschied zwischen zwei Bedeutungen des griechischen Ausdrucks für Wahrnehmung (aisthêsis) zu machen. ›Aisthêsis‹ bedeutet nämlich einerseits die bloße Empfindung im Wahrnehmungsvorgang, d.h. das sensorisch unmittelbar Gegebene. Andererseits bedeutet ›aisthêsis‹ aber auch Wahrnehmung im Sinne des Korrelats eines Urteils, das einen Gehalt so präsentiert, als ob er unabhängig vom Akt der Wahrnehmung der Fall ist. Die Bestimmtheit einer Wahrnehmungsvorstellung rührt demnach nicht daher, dass wir etwas rezeptiv empfinden, also etwa einen Ton hören oder irgendeine Geschmacksempfindung haben. Damit wir einen bestimmten Ton hören oder einen bestimmten Geschmack empfinden können, müssen wir nämlich imstande sein, diese Empfindung von anderen Empfindungen derselben und anderer Art zu unterscheiden. Wer sieht, dass die Akropolis sich vor ihm auftürmt, sollte imstande sein, die Akropolis vom roten Meer oder von einer Katze zu unterscheiden, und gleichzeitig auch nicht Gefahr laufen, seinen Gesichtseindruck der Akropolis mit einem Ton oder einem Tasterlebnis zu verwechseln.
Demnach gibt es keine Wahrnehmung ohne Urteil, d.h. ohne einen Akt der Unterscheidung, obgleich es durchaus eine irrtumsimmune Basis der Wahrnehmung, die Empfindung, geben mag. In offenkundiger Anlehnung an Heraklits These vom allgemeinen Logos (dem xynon), unterscheidet Platon die privaten Empfindungen (idia pathê) von den Wahrnehmungen, die von einem zentralen allgemeinen Punkt, dem koinon, aus bestimmt werden. Dieser später sogenannte sensus communis ist nach Platon das Denken, die dianoia, welche ein Urteil (krisis) dahingehend fällt, dass dem Eindruck, dieses oder jenes sei der Fall, etwas korrespondiert, das tatsächlich der Fall ist. Auf diese Weise unterscheidet sich der Schleier der Empfindungen – die traumartigen Empfindungen, die sich uns irgendwie präsentieren – vom wachen Wahrnehmungsurteil, das nicht auf bloße Rezeptivität gegründet werden kann. Denn Wahrnehmung und Empfindung sind nicht dasselbe.
Hätte Protagoras hingegen recht, so wären wir Platon zufolge unseren Empfindungen in der Wahrnehmung ausgeliefert, d.h., wir würden alles für wahr halten, was sich uns irgendwie präsentiert, und wären darin überdies infallibel. Auf diese Weise droht aber ein radikaler Solipsismus, in dessen Folge sich die Allgemeinheit des Logos völlig ins Nichts auflösen würde. Die Differenz von Sein und Schein wird also benötigt, wenn wir miteinander kommunizieren und in einer gemeinsamen Welt leben wollen. Der Logos erschließt uns die Welt, und zwar so, dass wir in unserem Zugang zur Welt vermittels der Wahrnehmung fallibel sind.
In dieser Einsicht kann man eine der großartigen Entdeckungen Platons sehen, die bis in unsere Zeit gültig ist: Der Solipsismus scheitert an seiner Unfähigkeit, sich zu artikulieren. Er untergräbt die Möglichkeit der Kommunikation, weil er uns in unsere Überzeugungen einschließt, die letztlich nicht einmal mehr Überzeugungen sind. Denn wer von etwas überzeugt ist, hält es für wahr. Fürwahrhalten orientiert sich aber,...