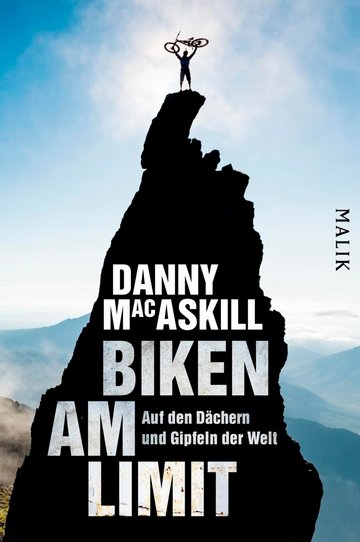Szene eins
Aufblende.
Tag/Außen. Las Palmas de Gran Canaria, Küstenklippen.
Street-Trial-Fahrer und Filmemacher Danny MacAskill bereitet sich auf seinen bisher dramatischsten Stunt vor: einen Frontflip von einer Rampe auf der Klippe, einen nervenzerfetzenden tollkühnen Sprung, der ihn über ein Feld von Felsblöcken in der Brandungszone gut fünfzehn Meter tiefer und weiter hinaus ins Meer tragen wird – wenn er gelingt.
Wir sehen Danny sich langsam der Sprungschanze nähern; er fährt unter einem leuchtend blauen Himmel über die Dächer von Las Palmas. Er trägt sein Drop-and-Roll-T-Shirt und den Red-Bull-Schutzhelm, auf dem oben eine GoPro-Kamera montiert ist.
Blick durch den Kamerasucher: Danny springt von der letzten Dachkante auf einen Gerüstturm, der sich als Anfang der Sprungschanze herausstellt. Er landet, tritt in die Pedale, so fest er kann, die Absprungkante nähert sich rasch. Dahinter der Horizont, dann diese Felsblöcke und der Sturz in die Brandung …
Cascadia, 2015
Sterben ist keine Option
Nichts würde mich davon abhalten, diese Klippe hinunterzuspringen, weder die schäumende Brandung oder die zerklüfteten Felsen, die in der Ebbeströmung ihre entblößten Zähne zeigten, noch der Abgrund selbst – fünfzehn Meter hin oder her. Ich würde über diese Kante hinausfliegen, ob es meinem Rad gefiel oder nicht.
Ich war umzingelt von Kameras, alle mit guter Sicht auf das, was der Banger des neuen Videos werden sollte. Eine saß oben auf meinem Schutzhelm, eine weitere kreiste an einer summenden Drohne über mir. Jede einzelne Linse war darauf aus, ins Bild zu setzen, was ich da vorhatte: eine spektakuläre Schlusssequenz für unser Video Cascadia. Dafür würde ich zuerst Schwung holen, so viel ich nur konnte. Die Startrampe aus Gerüststangen war in einer schmalen Gasse von Las Palmas de Gran Canaria aufgebaut. Mit dem Anlauf, den sie mir lieferte, würde ich dann über eine Klippe rasen, direkt hinunter in den Abgrund – und ins Meer stürzen. Klasse, was?
Als ich mir den Stunt ein paar Wochen vorher ausgedacht hatte, war ich mir meiner Sache ziemlich sicher gewesen, aber als der Tag dann da war, wurde mir doch mulmig. Auf einmal fürchtete ich, mein rasender Anlauf, oder vielmehr der auf einmal viel zu langsame Anlauf, würde mich nicht über die Felsen unmittelbar vor der Küste hinaustragen. Da war das Wasser teilweise nur viereinhalb Meter tief, ziemlich knapp bemessen, wenn ich da aus fünfzehn Metern hineinbombte. Das Meer dahinter sah auch nicht besser aus. Es war ziemlich zerwühlt, brodelte beängstigend und legte auf einmal Felsblöcke frei, an die sich Dutzende Krabben klammerten. Vielleicht sollte ich meine Flugbahn noch einmal überdenken? Komme ich überhaupt auf die richtige Geschwindigkeit? Auf jeden Fall stand mir ein schmerzhafter Aufprall bevor, wenn ich aus so großer Höhe ins Wasser fiel. Und danach? Keine Ahnung.
Und dann passierte es. Klick. Nach einer Stunde Herumgrübeln sagte mir auf einmal eine Stimme in meinem Kopf: Mach es. Ich knallte auf die Rampe und trat in die Pedale, was das Zeug hielt. Die Häuser flogen nur so vorbei, ich hörte nur noch das Klappern der Gerüststangen unter meinen Reifen.
Clang-a-lang!
Clang-a-lang!!
Die Welt sprang auf mich zu – Sonnenuntergang, Horizont, Meer –, als die Reifen über die Felskante hinausschossen. Wind schlug mir ins Gesicht. Und dann …
Nichts.
Nur Stille.
Und Erleichterung.
Ich bin keineswegs verrückt.
Klar, meine viralen Videos auf YouTube sehen so aus. Es wundert mich nicht, wenn du mich für wahnsinnig hältst, aber in Wirklichkeit sind all meine Stunts genau geplant und vorausberechnet; sobald ich ein Rad unter mir habe, weiß ich genau, was ich damit hinkriege, indem ich meine Fähigkeiten voll ausnutze, aber eben nicht überschreite. Vielleicht sieht das aus, als treibe mich die Todessehnsucht – verständlich, wenn ich mich gerade über eine Klippe ins Meer stürze oder von einem Hochhaus zum nächsten springe –, aber ich gehe eigentlich kaum Risiken ein, zumindest keine leichtsinnigen.
Vielmehr sind all meine Stunts nicht nur sorgfältig vorbereitet, sondern gelingen regelmäßig auch erst nach endlosen Stunden, in denen ich mir den Kopf zermartert habe. Ich brauche ewig, bis ich innerlich so weit bin, die Rampe hinaufzurasen und einen Bump-Frontflip oder einen Tiretap-Tailwhip aus großer Höhe hinzukriegen. Den größten Teil eines Drehtags verbringe ich immer damit, mich darüber zu ärgern, dass ich es wieder nicht bringe, den Sprung einfach zu machen, ohne vorher endlos darüber nachzugrübeln. Ich wünschte, ich könnte damit besser umgehen. Ehrlich, das ist manchmal richtig lästig.
Klar habe ich Angst. Ich leide allerdings unter keiner Phobie – weder vor Höhe noch Geschwindigkeit, nicht einmal vor Spinnen –, in der Hinsicht habe ich Glück. Außerdem ist meine Beziehung zu Schmerzen ziemlich gestört – ich spüre sie eigentlich nicht. Schürfwunden, Prellungen, Brüche machen mir kaum etwas aus. Das ist praktisch, wenn man einen Lebensstil pflegt, bei dem Stürze und Überschläge sozusagen dazugehören. Nur bei Street Trials – wenn ich auf Treppen, Parkbänken und Geländern dahinfetze, gewöhnlich rasend schnell und mit großen Sprunghöhen – bekomme ich manchmal doch ein paar Probleme mit den Nerven.
Für alle, die vielleicht nicht so genau wissen, was Trials sind, möchte ich es kurz erklären: Die Szene begann mit echten Wettrennen, in denen Mountainbiker einen Hindernisparcours in möglichst kurzer Zeit absolvierten. Der Haken dabei? Sie durften mit den Füßen den Boden nicht berühren. Bei den Wettbewerben führte der Parcours über Baumstämme, Felsen, Mauern oder Autowracks. Ab dem Durchfahren des Startgatters tickte die Uhr für jeden Teilnehmer, der sich durch den betreffenden Abschnitt arbeitete, und jedes Mal, wenn er mit den Füßen auf den Boden kam, gab es einen Strafpunkt, dab genannt. Man durfte pro Abschnitt höchstens fünf dabs kassieren. Später war die Regel dann, dass man im Zeitlimit bleiben musste, und wer die wenigsten Strafpunkte hatte, gewann.
Street Trials entwickelten sich aus diesen Trial-Rennen, aber sie sind kein Wettbewerb. Es ging nicht mehr darum, eine bestimmte Anzahl von Hindernissen in einer bestimmten Zeit zu überwinden, sondern einfach nur, dass der Mountainbiker sehr kreativ mit Gegenständen umging, die wir alle kennen. (Stell dir die ganz normalen Bushaltestellen, Telefonzellen und Rolltreppen auf deinem Weg zur Arbeit vor.) Diese Stunts wurden dann oft gefilmt und kamen auf VHS-Kassetten oder DVD heraus. Heute stellt man sie gerne ins Internet, und wenn der Mountainbiker Glück hat, werden sie von einer Menge Leute gesehen und zu »viralen Hits«.
Nun ist es nicht ganz einfach, Street Trials zu fahren. Erstens warten unzählige Prellungen und Brüche auf einen. Ich mache das schon mein ganzes Leben lang, und es sind viele Videos dabei herausgekommen, aber die Angst vor dem Sturz bleibt, besonders bei unbekannten Situationen. Ich habe einmal einen Frontflip – einen Salto vorwärts – vom Wehrgang des Edinburgh Castle riskiert, und das ging mir schon ganz schön an die Nieren. Dann war da dieser Sprung von einem einsturzgefährdeten ehemaligen Schlachthof in einer verfallenen argentinischen Stadt. Auf einer Seite lauerte drei Meter unter mir ein mürbes Dach auf mich, der Beginn meiner Line auf diesem Gebäude, und auf der anderen Seite ging es vier, fünf Meter im freien Fall hinunter auf nackten Beton. Da spürte ich den Stress doch ziemlich heftig. Oder der eiserne Staketenzaun in Edinburgh, den ich einmal entlanggefahren bin – wäre ich da ausgerutscht, hätte ich mich an einer sehr empfindlichen Stelle aufspießen können.
Wenn ich mich innerlich auf einen Stunt vorbereite, muss ich es schaffen, den Schalter umzulegen – den Schalter der Entschlossenheit, wie ich ihn nenne. Das ist der Moment, in dem ich von ängstlichem Zaudern zu positivem Wagemut übergehe, aber bis dahin fahre ich oft stundenlang unentschlossen im Kreis. Manchmal führe ich sogar Selbstgespräche, um mit der extremen Belastung fertigzuwerden, wenn ich zum Beispiel einen Sprung von zehn, fünfzehn Meter Tiefe vor mir habe oder die Landung nach einem Hindernissprung, die gemeine Folgen haben kann, wenn ich sie vermassele. In solchen Situationen bin ich immer voller Selbstzweifel. Die Angst kriecht in mir hoch. Dann ist es an mir, den Schalter umzulegen und zu tun, was ich mir vorgenommen habe.
Ich stelle meine Füße auf die Pedale und spüre einen regelrechten Energieschub. In ...