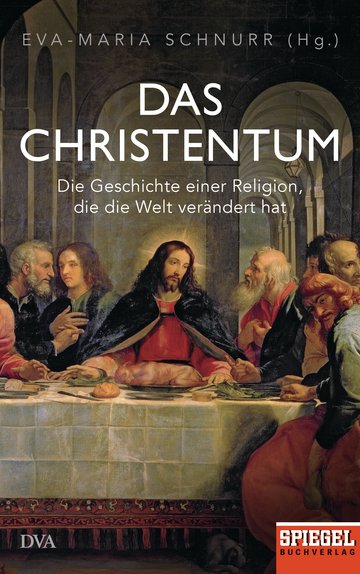Helden der Transzendenz
Seit Langem ist das Christentum die führende Weltreligion – trotz vieler Rangeleien um Konfessionen und Ketzer. Es liegt wohl an seiner inneren Vielfalt und der Fähigkeit, sich unentwegt selbstkritisch neu zu erfinden.
Von Johannes Saltzwedel
Der Angeklagte war gut vorbereitet. Man bezichtige ihn also, er lehne die religiösen Überzeugungen seiner Mitbürger ab? Dabei glaube er doch an dämonische Mächte. Geradezu spöttisch wies Sokrates, Athens berühmt-berüchtigter Fragekünstler, den Vorwurf der Gottlosigkeit zurück. Vergebens: Das Gericht verurteilte ihn zum Tod. Die mögliche Flucht lehnte er ab; kurz darauf trank er im Gefängnis den Schierlingsbecher.
Das war 399 v. Chr. Ziemlich genau zwei Jahrtausende später stand wieder ein angeblicher Gotteslästerer vor dem Tribunal. Giordano Bruno, ehemals Mönch, hatte gelehrt, das Universum sei unendlich und beherberge zahllose Welten. Obendrein hatte er laut seinen Anklägern die Göttlichkeit Jesu, Marias Jungfräulichkeit, die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi sowie die ewige Verdammnis geleugnet. Am 17. Februar 1600 wurde Bruno auf dem Campo de’ Fiori in Rom verbrannt.
Beide gingen aufrecht in den Tod: Sokrates verlangte beim Schlussplädoyer gar, man solle ihn fortan wie einen Ehrenbürger im Rathaus beköstigen. Und Bruno, auch nach jahrelangen Gefängnisqualen ungebrochen, drehte den Spieß diagnostisch um: »Möglich, dass ihr mit größerer Furcht das Urteil gegen mich sprecht, als ich es annehme.«
Etwas Entscheidendes allerdings trennt die beiden Ketzer. Sokrates sah sich beschuldigt, »die Götter nicht zu glauben, welche der Staat glaubt, sondern allerlei neues Dämonisches« – Paragrafen aber konnten die Ankläger nicht zitieren. Brunos Inquisitoren hingegen folgten haarklein den kirchen- und zivilrechtlichen Handbüchern. Während der Athener Denker durchaus Chancen gehabt hätte, freigesprochen zu werden, trieben die römischen Rechtskenner ihr Opfer im Namen des dreieinigen Gottes nach allen Regeln dogmatischer Kunst in die Enge.
In der hellenischen Welt des Sokrates wohnte nach alter Ansicht jedem Stadtstaat ein übernatürliches Wesen inne, aber auch jeder Quelle und jedem Gewächs. So gut wie alles war irgendwie heilig oder göttlich. Glaube äußerte sich im Vollzug, im Ritual; alles Weitere blieb Einweihungswissen.
Zu Brunos Zeit dagegen war die kirchliche Lehre genauestens festgeschrieben. Über Jahrhunderte hatten Theologen die Prüfung dessen, was sich christlich nennen durfte, immer weiter verfeinert. Mit jemandem, der zu dieser Lehre in Widerspruch geriet, verfuhren die Wächter des Glaubens nicht zimperlich – gerade jetzt nicht: Nach erbitterten Konfessionskriegen sah sich die römische Kirche in Abwehrstellung. Von 1545 bis 1563 hatte sie im Konzil von Trient noch einmal ihren Anspruch bekräftigt, allein selig machend zu sein, auch wenn die Zweifel daran spätestens seit Luthers Reform nicht mehr verstummten.
Wie hatte es so weit kommen können? Hatte nicht das Christentum in der spirituellen Vielfalt der Spätantike als Gemeinschaft der Nächstenliebe eine klare Alternative zu den eher moralfreien Götterwelten der Römer und Griechen sein wollen? Anfangs ein Ableger des Judentums, war die neue Religion als monotheistische Heilslehre aufgetreten, die ein baldiges Endgericht Gottes erwartete und ihren Anhängern nach der Mühsal des irdischen Daseins Erlösung verhieß. Die »frohe Botschaft« (so die Übersetzung von »Evangelium«) verkündete, die Jesus-Gläubigen seien durch den Opfertod und die Auferstehung ihres Heilands von Sündenschuld gereinigt. Warum hatte dies in engstirnigen Dogmatismus und Ketzerjagd umschlagen können?
Wer das erklären will, muss die erstaunliche Entwicklung des Christentums in Rechnung stellen. Durch seinen Aufstieg zur Staatsreligion im Römischen Reich und seinen Provinzen 380 n. Chr. bewirkte es eine der größten Umwälzungen in der Menschheitsgeschichte – mit so vielen Aspekten, dass man nur einige zu nennen braucht, um das Maß des mentalen Wandels anschaulich zu machen.
Da ist der völlige Umschwung im Weltverständnis überhaupt: Zuvor hatten nur ein paar versprengte Sektierer das Leben als leidvolle Prüfung vor dem befreienden Übertritt ins Jenseits betrachtet; nun aber war die Lehre von der letztlich sündhaft-verfallenen irdischen Welt öffentliches Credo, das Gebet an den Erlöser amtlicher Ritus.
Da ist die tiefe Umgestaltung des Soziallebens: Am Anfang der Kaiserzeit, inmitten einer faszinierenden Glaubensvielfalt, galten Christen als beargwöhnte Sekte mit anarchischen Neigungen, die man bändigen, ja bekämpfen musste. Seit dem römischen Kaiser Konstantin dem Großen wurde aus den einst Verfolgten die neue Führungsschicht; im Zerfall des Reiches übernahmen Bischöfe oft sogar die weltliche Herrschaft ihrer Region.
Schon der Wechsel zu einer Buchreligion, die Berufung auf heilige Schriften, die man nun sammelte, übersetzte, auslegte und kommentierte, veränderte einschneidend den Charakter der christlichen Spiritualität. Aber vor allem auch den Denkhaushalt krempelte das Christentum radikal um. Dass der allmächtige Gott wie schon bei den Juden kein Bildnis von sich dulden mochte, verstörte viele Gläubige; der als schmählich geltende Kreuzestod des Erlösers, die Geschichte von seiner Auferstehung und erst recht die schwer verständliche Trinitätslehre von der Einheit zwischen Gott Vater, Sohn Jesus und dem Heiligen Geist befremdeten ebenso.
Und doch war die frühere Vielfalt von Mythen und Kulten erstaunlich rasch durch neue, christliche Konzepte überlagert. An die Stelle von Orakelsprüchen, wie man sie zu Sokrates’ Zeiten in Dodona oder am Apollon-Heiligtum von Delphi erlangen konnte, trat die Erwartung der nahen Wiederkunft Christi, dazu die Prophetenweisheit des aus dem Judentum übernommenen Alten Testaments. Heilige Schriften bürgten nun dafür, wie Göttliches und Menschliches zusammenhing. Man opferte keine Tiere mehr, aber Altäre samt Gebetshandlungen gab es weiterhin. Nach und nach wurde es gute Sitte, als Sünder Beichte abzulegen und Buße zu tun. Den Platz antiker Kraftgestalten wie Herakles, die als göttlich verehrt worden waren, übernahmen Apostel, Märtyrer und andere Vorbilder. Wo zuvor Göttinnen überirdische Macht ausgeübt hatten, wandte man sich jetzt an Maria und weibliche Heilige.
Die bunte Bilder- und Sagenwelt der polytheistischen Antike wurde durch schlichte Symbole ersetzt, allen voran das Kreuz. In feindlicher Umgebung fanden Christen im Zeichen des Fisches zueinander: Die Figur aus zwei Rundbogen signalisierte das griechische Wort »Ichthys« (Fisch) – unter Eingeweihten das Kürzel für »Iesous Christos Theou Hyios Soter« (Jesus Christus, Gottes Sohn, der Erlöser). Aber auch das Bild von Jesus als gutem Hirten, der seine Schafe weiden lässt, war früh verbreitet.
Zu dieser neuen Bildwelt – die auf kultivierte Griechen und Römer ziemlich einfältig wirkte – kam ein radikal anderer Umgang mit der Sprache. Seit Jahrhunderten war Redekunst die Basis nicht nur des politischen Umgangs, sondern der höheren Bildung überhaupt gewesen. Nun sollten plötzlich krude in griechischer Allerweltsprosa verfasste Texte aus dem Vorderen Orient ehrwürdiger sein als alle Tragödien, Versepen und anderen Wortkunstwerke zum Ruhm der olympischen Götterwelt, zudem wahrer, nützlicher und trostreicher als die in langen Schultraditionen ausgefeilte, meist auch für Lebenskunst zuständige Philosophie.
Christliche Intellektuelle, zum Beispiel der wohl in der Gelehrtenmetropole Athen geborene Clemens von Alexandria (um 150 bis um 215), bemühten sich zwar um Vermittlung – so wurde Jesus bei Clemens, wie schon im Johannes-Evangelium, reichlich abstrakt zum »Logos« (Sinn) der Welt. Dennoch klang der »sermo humilis«, die niedere Sprachform der christlichen Texte, in den Ohren hellenistisch kultivierter Menschen noch lange barbarisch simpel.
Anhänger fand die Heilslehre in besseren Kreisen eher, weil sie die Werte des Lebens neu sortierte. An die Stelle des Glücks im Hier und Jetzt trat das Versprechen künftiger Seligkeit, die man nur durch geistliche Sorge um sich selbst, Reinigung von Sünden und klares Bekenntnis erlangen konnte. War bislang die Zukunft weitgehend ungewiss, so lief die Geschichte nun – vor allem in der maßgeblichen Sicht des Apostels Paulus – auf ein Finale zu, bei dem jeder seine moralische Bilanz empfing. Das wirkungsvolle Buch des Kirchenvaters Augustinus über den »Gottesstaat« machte daraus sogar eine strikte Zwei-Reiche-Lehre.
Sobald dieser Rigorismus, von eifrigen Predigern propagiert, nach über drei Jahrhunderten des Misstrauens und der Unterdrückung auch offiziell als Weltsicht anerkannt war, trat man durch das christliche Bekenntnis nicht nur in einen Kreis ein, der sich auserwählt fühlte – buchstäblich als Elite –, man rückte zunehmend auch sozial auf die Gewinnerseite. Stolz verzeichneten christliche Annalen, wie »heidnische« Herrscher sich taufen ließen und damit ihrem Volk ein Beispiel gaben. Region um Region schwenkte die Kultur auf christliche Maßstäbe ein; das war der eigentliche Durchbruch.
Möglich wurde er allerdings nur, weil Ritus und Glaubensleben gut organisiert waren und die Glaubensoberen weder Bündnisse mit weltlichen Herrschern scheuten noch sich selbst allein auf den geistlichen Bereich beschränkten. Noch heute erinnert das Gefüge vor allem der katholischen Kirche in vielem an die Würde des...