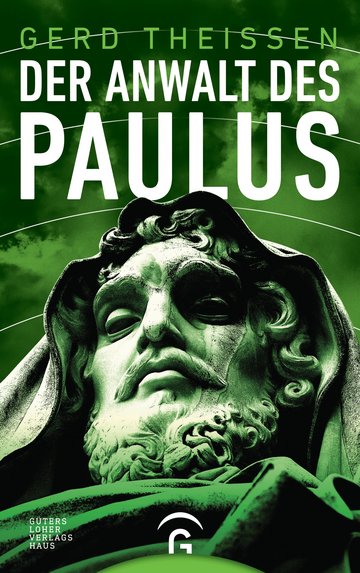1. EIN GEFÄHRLICHER AUFTRAG
Rom schwitzte unter einem hitzeflimmernden Himmel. Die Pinien gaben Schatten ohne Kühlung. Keine Wolke milderte die Sonnenglut, und die sonst so pulsierende Stadt wirkte träge und matt. Wer konnte, zog sich in sein Haus zurück und wartete, bis gegen Abend das Leben zurückkehrte. In den Häusern atmete man die abgedunkelte Kühle, die die Mauern spendeten.
Erasmus tat, was er an solchen Tagen am liebsten tat: nichts. Nichtstun ist eine Form intensiven Daseins – das hatte ihm Philodemus beigebracht, sein jüngerer Freund, ein Anhänger Epikurs.1 Erasmus folgte dessen Philosophie der Freude in der Freizeit, bei der Arbeit aber der stoischen Lehre, für die Pflichterfüllung das Wichtigste ist.2 Das war notwendig, denn er musste als Anwalt auch Angeklagte verteidigen, die er insgeheim verabscheute. So etwas verlangt Selbstdisziplin. Heute wollte er nicht an seine Klienten denken, sondern am besten an gar nichts. Er hörte in seinem Inneren die Stimme seines Freundes: »Entferne alles aus dir, was dich beunruhigt, konzentriere dich auf die reine Gegenwart, dann lebst du eine kurze Zeit wie die Götter, die glücklich in sich selbst ruhen und sich durch nichts in der Welt beunruhigen lassen.« Erasmus selbst dachte anders über die Götter. Seine stoische Philosophie sagte ihm: Es gibt nur eine Gottheit. Sie ist allgegenwärtig und wohnt in ihm als Gewissen, das sagt, was seine Pflicht ist. Übereinstimmung mit seinem Gewissen war ihm wichtiger als jedes Vergnügen. Aber natürlich träumte er davon, dass beides zusammenfällt: Pflichterfüllung und Lebensfreude.
Erasmus war mit 16 Jahren nach Rom gekommen, um Rhetorik und Recht zu studieren. Jetzt war er schon seit ein paar Jahren als Anwalt tätig. Er bewohnte auf dem Quirinalhügel nördlich des Kapitols ein Haus in Familienbesitz. Das war bei den teuren Mieten in Rom eine gute Starthilfe gewesen. Das Haus, ein kleines Atriumhaus mit hellem Innenhof, war repräsentativ genug, um in ihm als Anwalt Klienten zu empfangen, aber signalisierte gleichzeitig Bescheidenheit. Man spürte sofort: Hier wohnt keiner der ganz Reichen. Erasmus lebte dort zusammen mit seinem Sklaven Tertius, der ihm den Haushalt machte und als Schreiber ausgebildet war. Er erledigte die Korrespondenz bei seinen Anwaltsgeschäften, schrieb Verträge, Briefe und Anträge. Sie kannten sich seit ihrer Kindheit. Zusammen waren sie auf dem Landgut seines Vaters in Latium südlich von Rom aufgewachsen, nicht weit von der Hafenstadt Tarracina. Über die Via Appia waren sie zu Fuß in zwei Tagen zuhause. Als Kinder hatten sie den Standesunterschied zwischen sich kaum bemerkt. Die Eltern des Erasmus behandelten die im eigenen Haus geborenen Sklaven wie ihre Kinder und ihre unmündigen Kinder wie kleine Sklaven. Sie waren überzeugt, dass es zwischen Sklaven und Freien keinen Unterschied gebe. Denn sie gehörten zum Freundeskreis des Philosophen Musonius.3 Der lehrte als Stoiker, man solle Sklaven als Menschen betrachten, die von Natur aus frei sind und nur durch Schicksal Sklaven geworden sind. Daher dürfe man Sklaven nie die Hoffnung auf Freiheit nehmen. In der Regel wurden sie in Rom etwa im Alter von 30 Jahren freigelassen, waren aber danach auch weiterhin zu Dienstleistungen für ihre ehemaligen Herren verpflichtet.
Erasmus hatte bei einem der berühmtesten Juristen seiner Zeit, dem Senator Gaius Cassius Longinus, studiert. Der hatte ihm eingeprägt: Aufgabe des römischen Reiches ist es, durch eine Rechtsordnung den Frieden zu sichern und das Zusammenleben von vielen verschiedenen Menschen zu ermöglichen. Cassius Longinus war mit dem Attentäter Cassius, der gemeinsam mit Brutus Caesar ermordet hatte, verwandt. Er war in seinem Herzen Republikaner und stolz darauf, dass sich das Recht auch gegen tyrannische Menschen durchsetzt.4 Daneben hatte Erasmus wie seine Eltern Lehrvorträge bei Musonius gehört und war Anhänger der stoischen Philosophie geworden. Jetzt war er schon ein paar Jahre als Anwalt tätig und hatte einige schwierige Prozesse gewonnen.
Doch daran wollte er jetzt nicht denken. Jetzt sollte ihn die Gegenwart ganz erfüllen. Aber das fiel schwer. Mit Macht zogen ihn seine Gedanken in die Zukunft. In ein paar Wochen würden seine Eltern Cornelius und Cornelia gemeinsam ihren 45. und 40. Geburtstag feiern. Die Geburtstage lagen nur wenige Tage auseinander. Da musste er zeigen, dass er in seinem Rhetorikstudium etwas gelernt hatte! Alle Gäste erwarteten von ihm eine Rede. Aber was sollte er sagen? Das Thema sollte die Ehe sein – mit Gedanken des Musonius. Der lehrte: Ehepartner sollen die besten Freunde sein, alles gemeinsam haben, sich in allem unterstützen und gern zusammen leben. Nur war das für seine Eltern nichts Neues. Das alles hatten sie oft bei Musonius gehört. Seine Rede musste noch etwas Besonderes enthalten, was für seine Eltern und seine Beziehung zu ihnen charakteristisch war.
In seiner Einleitung wollte er ihnen erst einmal danken. Seine Eltern hatten ihm den in Rom ungewöhnlichen Namen »Erasmus« gegeben. Das griechische Wort »Erasmios« bedeutet ›Geliebter‹ und ›Ersehnter‹. Seine Eltern hatten ihn gewollt. Sie hatten ihm das Gefühl gegeben, erwünscht zu sein. Ein besseres Geschenk kann man seinen Kindern nicht geben.5
Hauptsächlich aber wollte er die Ehephilosophie des Musonius auf die Eltern anwenden. Sein Vater war ein Pragmatiker. Die Ideale unserer Philosophen, meinte er, seien sehr gut, aber oft wenig praktikabel. Man solle niemandem etwas abverlangen, was ihn überfordert – das sei für ihn einer der wichtigsten Grundsätze des römischen Rechts .6 Wenn Stoiker z.B. die Seelenruhe anpreisen, die Überwindung aller Affekte, die Ausrottung des Zorns und der Begierde, so seien das so hohe Ideale, dass nur alle paar Jahrhunderte ein Mensch sie verwirklichen könne. Genauso dachte Cornelia. Erasmus wollte beide damit überraschen, dass er ihre Philosophie in wenigen Grundsätzen zusammenfasste. Dazu aber hatte er erst vage Ideen.
Sollte er den Grundsatz formulieren: Es gibt keine Sondermoral für Männer oder Frauen? Für alle gilt: Du sollst niemanden verletzen, sollst jedem das Seine geben, sollst so leben, dass du geachtet wirst!7 Oder war das nicht alles trivial? Moral versteht sich eigentlich von selbst.
Sollte er die Maxime: »Behandle den anderen so, wie du wünschst, von ihm behandelt zu werden!«8 auf die Ehe anwenden? Das könnte etwa so lauten: Verlange von deinem Partner nur, was erfüllbar ist, damit er nichts Unerfüllbares von dir verlangt! Aber klang das nicht allzu nüchtern?
Oder sollte er seine eigene Lebensweisheit zum Besten geben: Lebe gut mit dir selbst zusammen! Wenn du dich nicht selbst ertragen kannst, fällt es anderen schwer, dich zu ertragen. Mit dieser Lebensmaxime hatte er sich freilich manchmal verteidigt, wenn er gefragt wurde, warum er noch nicht geheiratet hatte. Auch das war noch nicht die große zündende Idee.
Am besten fand er zurzeit den Gedanken: Die besten Ehepartner sind die, die auch mit dem zweitbesten Partner gut zusammenleben könnten. Im Leben trifft man immer einen, den man für noch besser hält. Dieser Grundsatz erspart den Test darauf, ob das auch wirklich stimmt.
Eine Abwandlung desselben Gedankens wäre: Die besten Partner haben als Verliebte die Erfahrung gemacht: Liebe macht blind. Aber die Ehe war für sie eine wirksame Therapie gegen diese Blindheit. Wenn Ehepartner sich nach wiedererlangter Sehkraft mit Liebe ansehen, sind sie ein glückliches Paar.
Bei dieser Rede gab es freilich ein Problem: Je überzeugender er seine Ehephilosophie ausbreiten würde, umso mehr würde er seinen Eltern das Stichwort zu der Frage geben: Wann heiratest du? Sollte er ihnen dann sagen, dass er eine junge Frau im Blick hatte, dass es da aber Probleme gab? Sie würden wissen wollen, wer diese Frau sei und warum er als erfolgreicher Anwalt Schwierigkeiten habe, diese Frau für sich zu gewinnen. Erasmus rief ihr Bild in sich wach. Seine Gedanken wanderten durch die Gassen Roms zu dem Haus, in dem sie wohnte. Was sie in diesem Augenblick wohl tat? Ob sie an ihn dachte? Ob sie wünschte, er möge an sie denken? Ob sie auch dachte, er würde jetzt an sie denken? Und wenn es nicht so war: Was könnte er tun, dass sie an ihn dachte und noch öfter an ihn denkt. Er fing an, von ihr zu träumen. Kein Zweifel, er war verliebt. Dabei war sie keine Schönheit der Art, wie man sie auf den Statuen Roms sah. Ihr Aussehen hatte etwas Herbes, das sich in weiches Licht verwandelte, wenn ihre Augen funkelten – keine Venus, keine Puppe, kein Schmusekätzchen, aber ein wunderbarer Mensch. Ihre Worte drangen tief in sein Inneres.
Plötzlich wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Er hörte Geräusche im Hauseingang und meinte, die Stimme Nathans zu hören. Nathan war der Vorsteher einer jüdischen Synagoge in Rom. Er hatte ihn im Kreis des Musonius kennengelernt. Auf seine Bitten hin hatte er vor zwei Jahren jüdische Priester in einem Prozess verteidigt, die als Gefangene aus Jerusalem noch Rom geschickt worden waren. Darüber waren sie Freunde geworden. Wenn Nathan ihn mitten in dieser großen Hitze aufsuchte, dann musste etwas passiert sein! Da kam auch schon Tertius und meldete Nathan an. Der betrat schwitzend das Zimmer. Anstatt ihn wie sonst mit vielen Worten zu begrüßen, kam er gleich zur Sache:
»Erasmus, entschuldige, dass ich dich überfalle. Wir brauchen dich. Kannst du noch einmal einen Fall für die jüdische Gemeinde übernehmen?«
Erasmus seufzte innerlich: Jetzt musste er von romantischen...