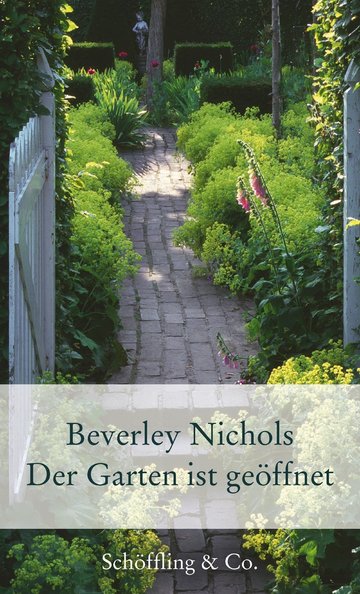I
Das Wüten des Winters
»Das Wetter in England« – schrieben meine Freunde den ganzen bitterkalten Winter über mit ermüdender Eintönigkeit – »ist absolut unbeschreiblich.« Und fuhren damit fort, es in aller Ausführlichkeit zu beschreiben.
Ich selbst konnte dabei nicht mitreden, da ich mich auf einer Vortragsreise durch Amerika befand, wo das Wetter, wie alle annahmen, nicht »unbeschreiblich« war. In gewisser Weise hatten sie recht. Nichts wäre mir leichter gefallen, als den Tornado zu beschreiben, der genau im Augenblick meiner Ankunft mit minus 25 Grad Celsius über Detroit herfiel, mich im wahrsten Sinn des Wortes packte und in einen mit Schneematsch gefüllten Rinnstein katapultierte, wo ich von einer Ambulanz aufgelesen und ins Krankenhaus abtransportiert wurde, damit man mich röntgen und bandagieren und mir eine Spritze gegen Kiefersperre verpassen konnte, eine Vorsichtsmaßnahme, die wohl verhindern sollte, dass meine Zähne auf dem Podium, auf dem ich eine Stunde später erwartet wurde, urplötzlich anfingen zu klappern, um sich dann unlösbar ineinander zu verbeißen.
Ähnlich leicht wäre es mir gefallen, die Eiseskälte zu beschreiben, die den ganzen mittleren Westen erfasst hatte. »Wie tief ist der Boden gefroren?«, fragte ich nach einem meiner Vorträge eine Dame aus Cleveland. Sie hatte ganz in Schwarz gekleidet in der ersten Reihe gesessen und mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil sie aussah, als habe sie etwas verloren. Ihre Antwort verriet mir, dass das tatsächlich der Fall war. »Mindestens einen Meter zwanzig tief, wie ich zufällig weiß«, antwortete sie. »Ich habe nämlich gerade meine Köchin beerdigt.« Die Stars der amerikanischen Bühne, Alfred Lunt und Lynn Fontane, konnten diese Aussage sogar noch überbieten. In ihrem Garten, versicherten mir die beiden, war der Boden viel tiefer gefroren, und sie mussten nicht auf so extreme Maßnahmen wie das Beerdigen einer Köchin zurückgreifen, um das in Erfahrung zu bringen.
Doch derartige Details behielt ich in meinen Briefen nach Hause für mich, denn im Lauf der Wochen zeigte sich, dass es dort tatsächlich ziemlich schlimm aussah. In abgelegenen Gegenden mussten Soldaten eingesetzt werden, im Dartmoor fielen die sonst so robusten Ponys einfach tot um, und in Richmond, nur ein paar Meilen von meinem Cottage entfernt, fror die Themse zum ersten Mal seit Menschengedenken komplett zu. Zufälligerweise war auch der Mississippi zugefroren, aber in Amerika rechnet man mit diesen Dingen, in England nicht. In England ist das Wetter oft trübselig und immer unvorhersehbar, aber selten melodramatisch. Ein Beispiel, das mir die missliche Lage meiner Freunde zu Hause am deutlichsten vor Augen führte, erreichte mich mit dem Brief einer befreundeten alten Dame, die in einem einsamen Cottage in den Downs von Sussex lebte. Sie machte sich schreckliche Sorgen um die armen Vögel, schrieb sie, und hatte sie so gut es ging gefüttert, obwohl das nicht immer leicht war, weil die Straßen auf dem Land manchmal tagelang unpassierbar waren. Trotzdem waren die Vögel immer schwächer geworden und hatten teils kaum noch die Kraft wegzufliegen, nachdem sie an den Brotrinden und Speckschwarten herumgepickt hatten.
»Inzwischen jedoch«, schrieb sie, »ist mir klar geworden, wie dumm ich war. Sie brauchten nämlich nicht nur Futter, sondern auch Wasser. Also habe ich Schüsseln aufgestellt und Teelichter darüber gehängt, die gerade so viel Wärme abgeben, dass das Wasser nicht friert. Die Konstruktion ist ein durchschlagender Erfolg, und ich kann nur hoffen, dass mein Vorrat an Teelichtern noch eine Weile reicht.« Es war der letzte Brief, den ich je von ihr erhielt. Ein paar Tage später fand man sie vor der Tür ihres Cottage, wo sie ausgerutscht und hingefallen war. Neben ihr lag eine dick vereiste Packung Teelichter. So lange es im guten alten England noch solche Charaktere gibt, kann es trotz des Wetters kein so furchtbar schlechter Ort zum Leben sein.
Aber was war mit dem Garten?
Das war die Frage, die ich mir zunehmend beunruhigt stellte, als immer mehr Briefe eintrudelten, die von tragischen, komischen oder kaum glaubhaften Ereignissen berichteten. Als Gärtner hatte ich einen sehr persönlichen Grund für diese Frage, denn seit ich das erste Mal einen Garten betrat, war ich von den Winterblühern geradezu besessen. Stolz hatte ich immer geprahlt, in jedem Garten, den ich je angelegt hatte, sei ich an jedem einzelnen Tag des Jahres in der Lage gewesen, ein Sträußchen für meinen Schreibtisch zu pflücken, und seien es nur ein paar kretische Schwertlilien, Iris unguicularis (syn. I. stylosa), deren noch geschlossene Knospen ich aus Schneewehen ausbuddelte. (Trotz jahrelanger Propaganda meinerseits gibt es immer noch viel zu viele Gärtner, die diese Blumen nicht in ihrem Garten haben, obwohl man sie tatsächlich aus halbmeterhohen Schneewehen retten und ins Haus holen kann, wo sie ihre orchideenartigen Blüten binnen einer Stunde öffnen.) Aber was, wenn der Schnee anderthalb Meter hoch lag, was anscheinend mancherorts der Fall war, und was, wenn sich der Frost bis unter die Wurzeln vorgekrallt hätte? Mein Freund und langjähriges Faktotum, Mr Gaskin, hatte geschrieben, er hätte sich über den Rasen zum Gewächshaus vorgraben müssen wie zu einer belagerten Festung. Als einen Punkt von noch größerer Wichtigkeit hatte er hinzugefügt, was er im Hinblick auf die sanitären Bedürfnisse von Four und Five tun solle, sei ihm ein absolutes Rätsel.
Four und Five sind meine kätzischen Gefährten, sechzehn und achtzehn Jahre alt.1 Normalerweise benutzen sie bei einem Kälteeinbruch, wenn der Boden gefroren ist, die aufgeschütteten Kohlen im Geräteschuppen, aus dem sie mit geschwärzten Pfoten und leicht hochnäsigen Gesichtern wieder zum Vorschein kommen, wie Damen in einem Restaurant, dessen Toiletten nicht allerhöchsten Ansprüchen genügen. Nun jedoch waren auch die Kohlenberge zu einer stahlharten, eisigen Masse erstarrt, und sie waren gezwungen gewesen, die Sandkiste zu benutzen, die sie unter normalen Umständen verschmähten. Doch selbst die war gefroren, mit dem Ergebnis, dass Four in die Badewanne »gemacht« hatte. Das war nun wirklich eine Schlagzeile wert, die durch die Tatsache, dass ein dreißig Zentimeter langer Eiszapfen den Warmwasserhahn der Wanne zierte, in die Four »gemacht« hatte, noch mehr Dramatik gewann.
Konnte nach all diesen Extremen überhaupt noch etwas vom Garten übrig sein, auch wenn es endlich angefangen hatte zu tauen? Nun … bald würde ich es wissen.
Der Rückflug nach England verlief ereignislos. Zumindest kam es mir dank der besänftigenden Eigenschaften eines Zaubertrunks, den mir mein New Yorker Freund Dr. Morgenbesser verordnet hatte, so vor. Dieses erstaunliche Elixir sieht aus wie Crème de Menthe und schmeckt auch so, hat aber eine bedeutend wohltuendere Wirkung: Obwohl das Flugzeug jeden Augenblick zu explodieren droht, sinkt man nach einem einzigen Schlückchen entspannt in seinen Sitz, auf dem Gesicht ein Lächeln, das dem nicht unter Drogen stehenden Beobachter leicht dümmlich vorkommen muss. »Es besteht kein Grund zur Beunruhigung«, krächzt die Stimme des Piloten über den Lautsprecher – eine Bemerkung, die normalerweise selbst das wackerste Herz mit Angst und Schrecken erfüllt. Man selbst jedoch nickt in einem Nebel wohlwollender Zustimmung vor sich hin. Was bitte sollte Grund zur Beunruhigung sein? Sicher, eins der Triebwerke ist ausgefallen, Blitze umzucken den Rumpf, es riecht durchdringend nach Kerosin und von hinten sind ein paar sehr eigenartige Geräusche zu vernehmen, die sich nicht ausschließlich auf die Gruppe betrunkener Russen zurückführen lassen, die, wahrscheinlich mit irgendwelchen infernalischen Apparaturen ausgerüstet, in letzter Minute an Bord kamen. Aber Beunruhigung? Was für ein absurder Gedanke! Nichts ist beunruhigend. Alles ist gut in der besten aller Welten, und Tod, wo ist dein Stachel? Das Kinn sackt nach unten, und kurz bevor man wegdämmert fragt man sich, wieso man drei Sicherheitsgurte umhat, die allesamt ein wenig verschwommen aussehen.
Aber eigentlich hatte ich vor, ein Gartenbuch zu schreiben. Also wollen wir kurz vor Mitternacht in London landen, wo der Mond hell am Himmel steht. Wir wollen über schmale, gewundene Straßen heimwärts fahren und alle Empfindungen durchleben, die jedem rückkehrenden Reisenden vertraut sind. Wir wollen in die baumgesäumte Straße einbiegen, die am menschenleeren Common von Ham vorbeiführt, und das Gattertürchen zum winzigen Vorplatz vor der Haustür öffnen. Und dann, bevor wir unseren Hausschlüssel zücken oder das Licht einschalten, wollen wir uns bücken, mit kalten Fingern auf der nassen Erde herumtasten, den Strunk einer geliebten Pflanze packen und kräftig daran ziehen.
Erleichtert seufzen wir auf. Denn beim Ziehen leistete der Strunk erbitterten Widerstand und rührte sich keinen Millimeter. Vielleicht, vielleicht war es um die Dinge ja doch nicht ganz so schlecht bestellt, wie wir befürchtet hatten.
Dieses eigenartige Verhalten ist vermutlich typisch für den rückkehrenden Reisenden, wenn dieser gleichzeitig auch Gärtner ist. Das Bedürfnis, sich zu vergewissern, was mit den Blumenbeeten los ist, lässt alle anderen Belange in den Hintergrund treten. Ich kannte einmal einen Mann, dessen Frau ihm genau deswegen mit Scheidung drohte. Er war drei Monate weg gewesen, und sie hatte ihm während seiner Abwesenheit ein Baby geschenkt. Merkwürdigerweise nahm sie an,...